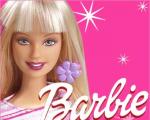Das Thema eines literarischen Werkes. Bild in Kunst und Literatur
Es gibt eine untrennbare logische Verbindung.
Was ist das Thema der Arbeit?
Wenn Sie das Thema der Arbeit ansprechen, versteht jeder intuitiv, worum es geht. Er erklärt nur aus seiner Sicht.
Das Thema eines Werkes ist das, was einem bestimmten Text zugrunde liegt. Auf dieser Grundlage ergeben sich die meisten Schwierigkeiten, da es unmöglich ist, sie eindeutig zu bestimmen. Jemand glaubt, dass das Thema der Arbeiten - die dort beschrieben werden - das sogenannte Lebensmaterial ist. Zum Beispiel das Thema Liebesbeziehungen, Krieg oder Tod.
Das Thema kann auch die Probleme der menschlichen Natur genannt werden. Das heißt, das Problem der Persönlichkeitsbildung, moralische Prinzipien oder der Konflikt von guten und schlechten Taten.
Ein weiteres Thema kann eine verbale Basis sein. Natürlich findet man selten Werke über Worte, aber darum geht es hier nicht. Es gibt Texte, in denen das Wortspiel im Vordergrund steht. Es genügt, an die Arbeit von V. Khlebnikov "Changeling" zu erinnern. Sein Vers hat ein Merkmal - die Wörter in der Zeile werden in beiden Richtungen gleich gelesen. Aber wenn Sie den Leser fragen, was der Vers eigentlich war, wird er wahrscheinlich nichts Verständliches antworten. Denn das Highlight dieser Arbeit sind die Zeilen, die sowohl von links nach rechts als auch von rechts nach links gelesen werden können.
Das Thema der Arbeit ist eine facettenreiche Komponente, und Wissenschaftler stellen die eine oder andere Hypothese dazu auf. Wenn wir von etwas Universellem sprechen, dann ist das Thema eines literarischen Werkes die „Grundlage“ des Textes. Das heißt, wie Boris Tomashevsky einmal sagte: "Das Thema ist eine Verallgemeinerung der wichtigsten, signifikanten Elemente."
Wenn der Text ein Thema hat, dann muss es eine Idee geben. Eine Idee ist die Absicht des Schreibers, die ein bestimmtes Ziel verfolgt, also das, was der Schreiber dem Leser präsentieren möchte.
Bildlich gesprochen ist das Thema des Werks das, was den Schöpfer dazu gebracht hat, das Werk zu schaffen. Sozusagen die technische Komponente. Die Idee wiederum ist die „Seele“ des Werkes, sie beantwortet die Frage, warum diese oder jene Schöpfung entstanden ist.
Wenn der Autor vollständig in das Thema seines Textes eingetaucht ist, es wirklich fühlt und von den Problemen der Charaktere durchdrungen ist, dann wird eine Idee geboren - ein spiritueller Inhalt, ohne den die Seite des Buches nur eine Ansammlung von Strichen und Kreisen ist .

Finden lernen
Du kannst zum Beispiel eine Kurzgeschichte erzählen und versuchen, ihr Hauptthema und ihre Hauptidee zu finden:
- Der Herbstregen verhieß nichts Gutes, besonders spät in der Nacht. Alle Bewohner einer Kleinstadt wussten davon, deshalb waren die Lichter in den Häusern längst ausgegangen. In allen außer einem. Es war ein altes Herrenhaus auf einem Hügel außerhalb der Stadt, das als Waisenhaus genutzt wurde. Bei diesem fürchterlichen Regenguss fand die Lehrerin ein Baby auf der Schwelle des Gebäudes, sodass es im Haus zu einem fürchterlichen Aufruhr kam: Füttern, baden, sich umziehen und natürlich ein Märchen erzählen – das ist schließlich das Haupttradition des alten Waisenhauses. Und wenn einer der Einwohner der Stadt gewusst hätte, wie dankbar das Kind sein würde, das auf der Türschwelle gefunden wurde, hätte er auf das leise Klopfen an der Tür geantwortet, das an diesem schrecklichen Regenabend in jedem Haus ertönte.
In dieser kurzen Passage können zwei Themen unterschieden werden: verlassene Kinder und das Waisenhaus. Tatsächlich sind dies die Hauptfakten, die den Autor gezwungen haben, den Text zu erstellen. Dann können Sie sehen, dass die einleitenden Elemente erscheinen: ein Findelkind, eine Tradition und ein schreckliches Gewitter, das alle Einwohner der Stadt dazu zwang, sich in ihren Häusern einzuschließen und das Licht auszuschalten. Warum spricht der Autor über sie? Diese einleitenden Beschreibungen werden die Hauptidee der Passage sein. Sie können so zusammengefasst werden, dass der Autor über das Problem der Barmherzigkeit oder Selbstlosigkeit spricht. Mit einem Wort versucht er jedem Leser zu vermitteln, dass man bei jedem Wetter menschlich bleiben muss.

Wie unterscheidet sich ein Thema von einer Idee?
Das Thema hat zwei Unterschiede. Erstens bestimmt es die Bedeutung (Hauptinhalt) des Textes. Zweitens kann das Thema sowohl in großen Werken als auch in kleinen Kurzgeschichten aufgedeckt werden. Die Idee wiederum zeigt das Hauptziel und die Aufgabe des Schreibers. Wenn Sie sich die vorgestellte Passage ansehen, können Sie sagen, dass die Idee die Hauptbotschaft des Autors an den Leser ist.
Das Thema einer Arbeit zu bestimmen ist nicht immer einfach, aber eine solche Fähigkeit ist nicht nur im Literaturunterricht, sondern auch im Alltag nützlich. Mit seiner Hilfe wird es möglich sein, Menschen zu verstehen und eine angenehme Kommunikation zu genießen.
Vladimir Vysotsky hat es geschafft, in einem kurzen, glänzenden Leben die Herzen von Millionen von Landsleuten zu gewinnen. Die heisere Stimme des "singenden" Dichters zur unveränderlichen Gitarre ist den Älteren gut in Erinnerung, seine Arbeit ist auch für junge Menschen interessant.
Vysotskys Lieder sind nicht nur literarisches, sondern auch folkloristisches Material. Ihre Sprache hat eine erstaunliche Eigenschaft - sie ist für jeden verständlich. Und hier geht es nicht um Armut oder Primitivität, im Gegenteil, es ist emotional und metaphorisch. Vladimir Semenovich hat viele aktuelle Themen angesprochen, wenden wir uns nur einigen zu.
Eine wesentliche Schicht von Vysotskys Werk sind "alltägliche" Texte, die sarkastisch die kleinbürgerliche Lebensweise und menschliche Laster lächerlich machen. Er schrieb über den Spießer, basierend auf seinen eigenen Beobachtungen und Eindrücken.
Zu den bekannten Werken gehören „Morgensport“ und „Reden vor dem Fernseher“. Diese Gedichte sind mit einem faszinierenden umgangssprachlichen Vokabular von Comic-Bildern gefüllt.
Oft wandte sich der Autor der Volkskunst zu und schuf auf ihrer Grundlage echte Meisterwerke, wie den Zyklus "Black Eyes", "Ivan da Marya", Märchen. Vysotsky war auch politischen Fragen nicht gleichgültig, weshalb er lange Zeit unter der strengen Kontrolle der sowjetischen Zensur arbeiten musste. Trotz der Verbote nahm sich Vysotsky jedes für ihn interessante Thema an und sang buchstäblich über alles. In seinen Liedern gibt es keine Lügen, Lügen und Pathos, also glaubte ihm das Publikum, weil seine Werke im Einklang mit ihren Herzen waren.
Der Dichter selbst schätzte sein Talent und betrachtete es als Geschenk Gottes. Die Fähigkeit, Lieder, Gedichte und die Art ihrer Aufführung zu schreiben, wurde zu seinem unschätzbaren Schatz, einem goldenen Pass zur Unsterblichkeit.
Ein weiteres Thema, das oft in den Werken von Vysotsky zu hören ist, war das Problem einer gebrochenen Seele. In seinen tragischen Texten ist immer eine Vorahnung, ein Gefühl des Absturzes in den Abgrund. Beim Schreiben des Gedichts "Fussy Horses" verwendete der Autor eine Metapher, indem er das Leben eines Menschen mit dem Laufen von Pferden verglich.
Die Zeilen von Vysotskys Werken haben sich bereits in unserer Sprache aufgelöst, sind zu Lehrbüchern geworden und haben den Test der Zeit bestanden. Bis heute begeistern sie Zuhörer und Leser: Wir werden nicht müde zu lachen, zu weinen, uns an ferne Freunde und tote Soldaten zu erinnern. Seine Arbeit lässt einen über das Leben nachdenken, in dem es vor allem darum geht, die unbezwingbaren Pferde rechtzeitig aufzuhalten, um wenigstens Zeit zu haben, am Abgrund zu stehen ...
In literarischen Werken wird der Begriff „ Thema"hat zwei Hauptinterpretationen:
1)Thema- (von einem anderen griechischen Thema - das, was die Grundlage ist) das Thema des Bildes, jene Tatsachen und Phänomene des Lebens, die der Schriftsteller in seiner Arbeit festgehalten hat;
2) Hauptproblem in die Arbeit setzen.
Oft werden diese beiden Bedeutungen im Begriff "Thema" kombiniert. So wird im „Literary Encyclopedic Dictionary“ folgende Definition gegeben: „Thema ist ein Kreislauf von Ereignissen, die das Lebenselixier epischer und dramatischer Werke bilden und gleichzeitig dazu dienen, philosophische, soziale, epische und andere ideologische Probleme aufzuwerfen“ ( Literarisches Enzyklopädisches Wörterbuch, herausgegeben von Kozhevnikov V. M., Nikolaeva P. A. - M., 1987, S. 347).
Manchmal wird das „Thema“ sogar mit der Idee der Arbeit identifiziert, und der Beginn einer solchen terminologischen Mehrdeutigkeit wurde offensichtlich von M. Gorki gelegt: „Das Thema ist eine Idee, die aus der Erfahrung des Autors stammt und von seinem Leben angeregt wird , sondern schmiegt sich noch ungeformt in das Gefäß seiner Eindrücke.“ Natürlich hat Gorki als Schriftsteller zunächst die untrennbare Einheit aller inhaltlichen Elemente gespürt, aber für die Zwecke der Analyse ist gerade dieser Ansatz ungeeignet. Ein Literaturkritiker muss klar zwischen den Begriffen „Thema“, „Problem“, „Idee“ und – was am wichtigsten ist – den „Ebenen“ des künstlerischen Inhalts dahinter unterscheiden und eine Doppelung von Begriffen vermeiden. Eine solche Unterscheidung wurde von G.N. Pospelov (Ein ganzheitlich-systemisches Verständnis literarischer Werke // Fragen der Literatur, 1982, Nr. 3) und wird derzeit von vielen Literaturkritikern geteilt.
In Übereinstimmung mit dieser Tradition wird das Thema verstanden als Gegenstand künstlerischer Reflexion, jene Lebenscharaktere und -situationen (die Beziehung der Charaktere) sowie die Interaktion einer Person mit der Gesellschaft als Ganzes, mit der Natur, dem Leben usw.), die sozusagen aus der Realität in ein Werk und eine Form übergehen objektive Seite Sein Inhalt. Thema in diesem Sinne - alles, was Gegenstand des Interesses, des Verständnisses und der Bewertung des Autors geworden ist. Thema fungiert als eine Verbindung zwischen primärer Realität und künstlerischer Realität(das heißt, es scheint gleichzeitig zu beiden Welten zu gehören: der realen und der künstlerischen).
Die Analyse des Themas konzentriert sich auf über die Auswahl der Tatsachen der Realität durch den Autor als Anfangsmoment des Autorkonzepts funktioniert. Anzumerken ist, dass dem Thema manchmal unzumutbar viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, als ob es bei einem Kunstwerk vor allem um die Realität geht, die sich darin widerspiegelt, während eigentlich der Schwerpunkt einer sinnvollen Analyse in einem Ganzen liegen sollte anderes Flugzeug: nicht das Autor reflektiert, A wie hast du verstanden reflektiert. Eine übertriebene Beschäftigung mit dem Thema kann aus einem Gespräch über Literatur ein Gespräch über die in einem Kunstwerk widergespiegelte Wirklichkeit machen, und das ist bei weitem nicht immer notwendig und fruchtbar. (Wenn wir "Eugen Onegin" oder "Tote Seelen" nur als Illustration des Lebens des Adels des frühen 19. Jahrhunderts betrachten, dann wird alle Literatur zur Illustration für ein Geschichtslehrbuch. Dies ignoriert die ästhetische Besonderheit von Kunstwerken , die Originalität der Sicht des Autors auf die Realität, besondere sinnvolle Aufgaben Literatur).
Theoretisch ist es auch falsch, der Auseinandersetzung mit dem Thema den Vorrang zu geben, da es sich, wie bereits erwähnt, um die objektive Seite des Inhalts handelt und folglich die Individualität des Autors, sein subjektiver Umgang mit der Realität, hier nicht zum Ausdruck kommen kann diese Inhaltsebene in ihrer Gesamtheit. Die Subjektivität und Individualität des Autors auf der Ebene der Themen kommen nur in zum Ausdruck Auswahl an Lebensphänomenen, was natürlich noch nicht erlaubt, ernsthaft über die künstlerische Originalität dieses besonderen Werkes zu sprechen. Vereinfacht kann man sagen, dass das Thema der Arbeit durch die Beantwortung der Frage „Worum geht es in dieser Arbeit?“ bestimmt wird. Aber von der Tatsache, dass das Werk dem Thema Liebe, dem Thema Krieg usw. gewidmet ist. Sie können nicht so viele Informationen über die einzigartige Originalität des Textes erhalten (zumal sich häufig eine beträchtliche Anzahl von Schriftstellern ähnlichen Themen zuwendet).
In der Literaturkritik haben sich längst die Definitionen von „philosophischer Lyrik“, „bürgerlich (oder politisch)“, „patriotisch“, „Landschaft“, „Liebe“, „freiheitsliebend“ etc. eingebürgert, die letztlich treffend sind Angaben zu den Hauptthemen der Werke . Daneben gibt es Formulierungen wie „das Thema Freundschaft und Liebe“, „das Thema Mutterland“, „das militärische Thema“, „das Thema des Dichters und der Poesie“ usw. Offensichtlich gibt es eine beträchtliche Anzahl von Gedichten, die demselben Thema gewidmet sind, sich aber gleichzeitig erheblich voneinander unterscheiden.
Es sollte beachtet werden, dass es in einem bestimmten künstlerischen Ganzen oft nicht einfach ist, zwischen ihnen zu unterscheiden Reflexionsobjekt(Thema) und Bildobjekt(eine vom Autor gezeichnete spezifische Situation). In der Zwischenzeit ist dies erforderlich, um formale und inhaltliche Verwechslungen zu vermeiden und die Genauigkeit der Analyse zu gewährleisten. Betrachten Sie einen typischen Fehler dieser Art. Das Thema der Komödie A.S. Griboedovs "Wehe aus Witz" wird oft als "Chatskys Konflikt mit der Famus-Gesellschaft" definiert, während dies kein Thema, sondern nur ein Thema des Bildes ist. Sowohl Chatsky als auch die Famus-Gesellschaft wurden von Griboyedov erfunden, aber das Thema kann nicht vollständig erfunden werden, wie darauf hingewiesen wurde, es „kommt“ aus der Lebensrealität in die künstlerische Realität. Um direkt auf das Thema „rauszukommen“, müssen Sie öffnen Figuren, in Figuren verkörpert. Dann wird die Definition des Themas etwas anders klingen: der Konflikt zwischen dem fortschrittlichen, aufgeklärten und leibeigenen, unwissenden Adel in Russland in den 10-20er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Der Unterschied zwischen dem Reflexionsobjekt und dem Motiv des Bildes ist sehr deutlich sichtbar in funktioniert mit bedingt-fantastische Bildsprache. Man kann nicht sagen, dass in der Fabel von I.A. Krylov "Der Wolf und das Lamm" das Thema ist der Konflikt zwischen dem Wolf und dem Lamm, dh das Leben der Tiere. In einer Fabel ist diese Absurdität leicht zu spüren, und daher wird ihr Thema normalerweise richtig definiert: Dies ist das Verhältnis der Starken, der Macht hat, und der Wehrlosen. Die Art der Bildsprache ändert jedoch nichts an der strukturellen Beziehung zwischen Form und Inhalt. Daher ist es bei Werken, die in ihrer Form lebensecht sind, erforderlich, das Thema zu analysieren und tiefer als die dargestellte Welt zu den Merkmalen der Charaktere vorzudringen in den Charakteren und der Beziehung zwischen ihnen verkörpert.
Bei der Analyse von Themen wird traditionell zwischen Themen unterschieden spezifisch historisch Und ewig.
Spezielle historische Themen- dies sind Charaktere und Umstände, die durch eine bestimmte sozio-historische Situation in einem bestimmten Land geboren und bedingt sind; sie wiederholen sich nicht über eine bestimmte Zeit hinaus, sie sind mehr oder weniger lokalisiert. Dies sind zum Beispiel das Thema der „überflüssigen Person“ in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts, das Thema des Großen Vaterländischen Krieges usw.
Ewige Themen sie halten wiederkehrende Momente in der Geschichte verschiedener nationaler Gesellschaften fest, sie wiederholen sich in unterschiedlichen Modifikationen im Leben verschiedener Generationen, in verschiedenen historischen Epochen. Das sind zum Beispiel die Themen Freundschaft und Liebe, Beziehungen zwischen den Generationen, das Thema Mutterland und so weiter.
Situationen, in denen ein einzelnes Thema organisch ist, sind nicht ungewöhnlich verbindet sowohl konkrete historische als auch ewige Aspekte, ebenso wichtig für das Verständnis des Werks: Dies geschieht beispielsweise in „Schuld und Sühne“ von F.M. Dostojewski, „Väter und Söhne“ von I.S. Turgenjew, „Meister und Margarita“ M.A. Bulgakow usw.
In den Fällen, in denen der konkrete historische Aspekt des Themas analysiert wird, sollte eine solche Analyse so historisch spezifisch wie möglich sein. Um auf das Thema genau einzugehen, ist es notwendig, darauf zu achten drei Parameter: richtig sozial(Klasse, Gruppe, soziale Bewegung), zeitlich(zugleich ist es wünschenswert, die entsprechende Epoche zumindest in ihren wichtigsten bestimmenden Trends wahrzunehmen) und National. Nur die exakte Bezeichnung aller drei Parameter erlaubt eine zufriedenstellende Analyse des konkreten historischen Themas.
Es gibt Werke, in denen nicht ein, sondern mehrere Themen herausgegriffen werden können. Ihre Gesamtheit wird genannt Themen. Nebenthemen "arbeiten" normalerweise für die Hauptlinie, bereichern ihren Klang und helfen, sie besser zu verstehen. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten, das Hauptthema hervorzuheben. In einem Fall ist das Hauptthema mit dem Bild der Hauptfigur verbunden, mit ihrer sozialen und psychologischen Sicherheit. So ist das Thema einer herausragenden Persönlichkeit unter dem russischen Adel der 1830er Jahre, das mit dem Bild von Pechorin verbundene Thema, das Hauptthema im Roman von M.Yu. Lermontovs „Ein Held unserer Zeit“ geht sie alle fünf Geschichten durch. Die gleichen Themen des Romans wie das Thema Liebe, Rivalität, das Leben einer weltlichen Adelsgesellschaft sind in diesem Fall zweitrangig und helfen, den Charakter des Protagonisten (dh das Hauptthema) in verschiedenen Lebenssituationen und Situationen zu enthüllen. Im zweiten Fall durchläuft sozusagen ein einziges Thema das Schicksal einer Reihe von Charakteren - zum Beispiel organisiert das Thema der Beziehung zwischen dem Individuum und den Menschen, der Individualität und dem "Schwarm" -Leben die Handlung und die thematischen Linien des Romans von L. N. Tolstoi „Krieg und Frieden“. Hier wird sogar ein so wichtiges Thema wie das Thema des Vaterländischen Krieges von 1812 zu einem sekundären Hilfsthema, das für das Hauptthema „arbeitet“. In diesem letzteren Fall wird das Finden des Hauptthemas zu einer entmutigenden Aufgabe. Daher sollte die Analyse des Themas mit den thematischen Linien der Hauptfiguren beginnen und herausfinden, was sie intern genau verbindet - dies ist das verbindende Prinzip und wird das Hauptthema der Arbeit sein.
Das Bild ist ein in Kunst, Literatur und Kunst- und Literaturwissenschaft zentraler Begriff, der jedoch mehrdeutig und schwer zu definieren ist. Sie verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen Kunst und Wirklichkeit, die Rolle des Künstlers bei der Entstehung eines Werks, die inneren Gesetzmäßigkeiten der Kunst und legt gewisse Aspekte der künstlerischen Wahrnehmung offen.
Schwierigkeiten bei der Formulierung des Konzepts führen dazu, dass eine Reihe von Wissenschaftlern es für "obsolet" halten und vorschlagen, es als unnötig vollständig abzuschaffen. Inzwischen ist es unmöglich, Wörter wie "Bild", "Imagination", "Verwandlung" usw. aus der Sprache zu entfernen. Sie haben etwas gemeinsam, nämlich die "innere Form" - das Bild (zur "inneren Form" siehe die Werke von A. Potebnya).
Die Identität von innerer Form und Bild in der Kunst ist im Wesentlichen dieselbe wie die Identität von Form und Inhalt.
Die Bedeutung des Bildes ist das Bild selbst, das sich im Prozess seiner Erstellung dem Autor und seiner Neuschöpfung erklärt - dem Leser (ein solches Verständnis ist A. Bely, M. Heidegger, O. Pas inhärent). Aus dieser Sicht „zeigt“ Kunst das Sein nicht, sondern „liefert“ es direkt. Gleichzeitig ist es auch ein Mittel zur Erkenntnis sowohl der nicht-künstlerischen als auch der ästhetischen Realität: jener „Ort“ (dieser Bereich), an dem sich beide Realitäten „treffen“, sich überschneiden. In nicht-künstlerischen Wissensgebieten ist eine ähnliche Struktur vorbildlich.
Im weitesten Sinne kann als künstlerisches Bild jede Form bezeichnet werden, in der der Künstler die von ihm wahrgenommenen und für sein Bewusstsein bedeutsamen Ereignisse, Objekte, Prozesse, Phänomene des Lebensflusses und seine eigene Wahrnehmung von ihnen verkörperte. Man spricht oft von der „Spiegelung“ der Realität in der Kunst mit Hilfe eines Bildes, von der Transformation des menschlichen Lebens im Lichte des ästhetischen Ideals des Autors, das mit Hilfe der Fantasie geschaffen und im Bild verkörpert wird.
Die Hauptfunktionen des künstlerischen Bildes sind ästhetisch, kognitiv und kommunikativ. Mit ihrer Hilfe entsteht eine individuelle ästhetische Realität. Das Bild in der Kunst fungiert gegenüber der Wirklichkeit nicht als deren Kopie, es „verdoppelt“ sie nicht. Es überträgt das Ideal des Autors auf den Leser, den Betrachter. Trotz der Subjektivität des Weltbildes des Autors drückt es auch etwas Universelles aus – sonst würde ein Kunstwerk keine anderen Leser (Zuschauer) als seinen eigenen Schöpfer finden. Dieses "Universelle" ist sehr oft ein künstlerisches Bild.
Die Literaturgeschichte bringt neue figurative Systeme hervor, die durch das Aufkommen neuer Methoden in der Kunst entstehen. Es gibt also Bilder des Klassizismus, Sentimentalismus, Romantik, kritischen Realismus, Naturalismus, Symbolismus, Expressionismus, verschiedener anderer Schulen der Moderne usw.
Die visuelle Bedeutung des uns interessierenden Begriffs widerspricht nicht der sprachlichen Bedeutung, sondern besteht untrennbar mit ihr.
Die Vorstellungskraft des Lesers ist ebenso Realität wie das, was in den "Lebensformen selbst" existiert. Der Mensch kann nicht auf etwas reagieren, das nicht existiert; Jedes Phantom, das eine Reaktion hervorruft, ist hauptsächlich in der Vorstellung vorhanden, und dies und nicht seine Abwesenheit in der realen Welt von Objekten, Phänomenen usw. bestimmt seine Wirksamkeit. Der Begriff „Plastik“ bezieht sich auf das sinnlich Wahrnehmbare – Musik wird beispielsweise nicht gesehen, sondern gehört, was uns nicht daran hindert, von musikalischer Plastizität zu sprechen. So wie im Wort der Umgangssprache objektiver, „sichtbarer“ Anfang, Klangschein und Bedeutung koexistieren, so schließen sich im poetischen Bild „Bild“ Plastizität und poetischer Sinn des Wortes nicht aus.
Das poetische Bild ist tatsächlich ein Ideogramm, ähnlich der altägyptischen oder sumerischen Schrifteinheit. Es verursacht eine visuelle Assoziation in den Köpfen sowohl des Dichters als auch des Lesers und ist in diese Assoziation als eine, wenn auch schematisierte, Zeichnung eingeprägt, die die Wahrnehmung sowohl von Konzepten als auch von Bildern („Bildern“) anregt. Gleichzeitig entsteht der poetische Sinn und Sinn des Wortes: aus dem allgemeinen Literarischen wird es zum Poetischen. Das poetische Bild wird nicht eindeutig gelesen, sondern jedes Mal neu „entwirrt“, „gebaut“.
Struktur und Eigenschaften des Bildes
Das Bild als etwas „Sichtbares“ richtet sich an die emotionale Wahrnehmung, an das Fühlen und wird sinnlich wahrgenommen. Es hängt sowohl mit den Phänomenen der nicht-künstlerischen Realität zusammen, die in ihm aufeinanderprallen, einander ähnlich werden, zu einem künstlerischen Ganzen verschmelzen, als auch mit den Wörtern der literarischen Sprache, die neue Bedeutungen erhalten. Die Struktur des Bildes umfasst das, was transformiert wird (etwas Alltagsrealität, Objekt, Phänomen, Prozess usw.), das, was transformiert wird (dies ist nur ein beliebiges künstlerisches Sprachmittel - vom Vergleich zum Symbol), und was als Ergebnis entsteht .
In seiner allgemeinsten Form hat ein Bild die folgenden Eigenschaften:
- es erregt eine direkte Reaktion, ein "Gefühl" des Lesers (aktiviert und "startet" die ästhetische Wahrnehmung);
- es ist konkret, „plastisch“ (diese Definition wird heute in der Analyse der bildenden Künste (Malerei, Skulptur usw.) und nicht der musikalischen (Musik, Poesie usw.) verwendet. Die Frage nach dem Inhalt des Begriffs „Plastizität“ in Bezug auf das Wort: intuitiv wird sie als Attribut sowohl eines musikalischen als auch eines literarischen Werks empfunden) und gerade wegen dieser Eigenschaften ist sie ein ästhetisches Phänomen;
- das Bild ist ein Zwischenglied zwischen 1) äußeren Phänomenen, 2) Gefühlen und 3) menschlichem Bewusstsein;
- also bunt, greifbar, konkret, als „Subjekt“ der Wirklichkeit und nicht abstrakt rational.
Wir können über den Unterschied zwischen dem Bild in Poesie und Prosa sprechen. Das Bild in der Prosa bildet eher ein Phänomen der Welt nach, verleiht ihm Integrität und interpretiert es als künstlerische Idee. In der Prosa (mit Ausnahme solcher Übergänge von Poesie zu Prosa, wie "Gedichte in Prosa", zum Beispiel Turgenev usw.) ist die Transformation der Realität als absoluter Triumph der Interpretation des Autors unmöglich. Dabei sollte die Weltanschauung des einzelnen Autors weitgehend mit der des Lesers übereinstimmen.
Arten von Bildern
Künstlerische Bilder können auch nach jenen Objekten klassifiziert werden, die eine ästhetische Transformation erfahren und dadurch in einem Kunstwerk erscheinen.
Verbales (sprachliches) Bild: "Schwarzes Boot, das den Reizen fremd ist" (K. Balmont); Achse, Wespe, Osip in Mandelstams Gedichten; „Überall ist weder hell noch dunkel, / und in Harmonie: ein Auge – eine Ikone – ein Fenster. - / Das Versprechen eines prophetischen Zeichens, / Als ob alles, was passiert, auf dem Spiel steht “(V. Perelmuter). Hier wird das Hauptaugenmerk auf lexikalische Einheiten gelegt, die interne Form von Wörtern wird häufig aktualisiert.
- Bild-Personifikation, Bezeichnung oder Zeichen, manchmal sogar Identifizierung, hauptsächlich basierend auf Metaphorisierung. So bedeutet der „Dolch“ in der russischen Poesie traditionell „Dichter“, Tschechows „Möwe“ ist das Zeichen von Nina Sarechnaya (hier wird das Bild zum Symbol, aber die figurative Natur selbst geht in solchen Fällen nicht verloren). Eine separate typisierte menschliche Persönlichkeit beginnt, eine figurative Natur zu besitzen.
- Ein Bildfragment, wenn ein separater Teil oder ein bestimmtes Phänomen einen charakterisierenden, verallgemeinernden Charakter erhält. Die Haupttechnik hier ist die Metonymie. Bei S. Krzhizhanovsky „brach die Sonne mit parallelen Strahlen in die Querbalken der Fenster aller vier Stockwerke des Titsa-Geschäfts“ („Meeting“). Strahlen sind ein separates Attribut der Sonne, aber das ganze Objekt wird hier durch dieses Attribut offenbart.
- Eine Bildverallgemeinerung (z. B. "das Bild des Mutterlandes", "das Bild der Freiheit" in den Werken dieses und jenes Autors (Autoren)). Ein abstraktes oder sehr breites Konzept, das sich durch konkrete Realitäten offenbart, erfährt eine Transformation.
- Das Bild des Autors (als Erzähler oder einer der Helden, Charaktere) in der Arbeit. Hier haben die meist implizit im Text enthaltenen Einschätzungen des Autors Vorrang.
- Das Bild einer bestimmten Person, des Helden (Charakter) der Arbeit, der Träger und Verkörperung bestimmter Qualitäten und Eigenschaften ist. Es enthält einzigartig-individuelle und verallgemeinerungstypische Merkmale, d.h. es sieht nicht aus wie alle anderen und ist mit vielen realen Menschen vereint. Zum Beispiel das Bild von Tatyana in "Eugene Onegin", Chatsky in der Komödie "Woe from Wit" usw. In diesem Fall besteht es aus verschiedenen Komponenten, die bei der Analyse der Arbeit aufgedeckt werden. Dies ist das Aussehen, der Charakter (manifestiert sich in Bezug auf die Welt, in Beziehungen zu anderen Helden, Charakteren), das Sprachporträt, die Einstellung zu menschlichen Generationen (zum Beispiel hat der Held Kinder: In Goncharovs Roman "Oblomov" ist das wichtig Stolz nach dem Tod von Oblomov adoptiert sein Kind) usw. Die künstlerischen Details, die diesen oder jenen Helden begleiten, sind von großer Bedeutung. So wird Prinz Andrei im Roman "Krieg und Frieden" entweder von der alten Eiche in Otradnoye oder vom "Himmel von Austerlitz" begleitet, und dies arbeitet aktiv daran, das Bild des Helden zu schaffen.
- Das Bild (im eigentlichen Sinne des "Bildes") der Welt, ihres Zustands, ihres Phänomens.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den meisten Fällen die einzelnen Spielarten des künstlerischen Bildes nebeneinander bestehen. Sie bilden einen ganzheitlichen künstlerischen Eindruck.
Es ist interessant, den an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelten Begriff des künstlerischen Bildes zu analysieren. V. Bryusov, sowohl Dichter als auch Literaturtheoretiker. Das metaphysische Wesen der Poesie verwirklicht sich aus seiner Sicht gerade im künstlerischen Bild, das als synthetisierendes Erkenntnismittel (im Gegensatz zum weltlich-wissenschaftlichen - Analysierenden) agiert. Es ist eine Art "Synthese der Synthesen": Indem es verschiedene Vorstellungen über verschiedene Phänomene zu einem Ganzen verknüpft, kann es als ein besonderes synthetisches Urteil über die Welt angesehen werden ("Synthetics of Poetry", 1924).