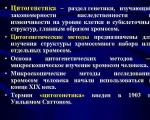Er schrieb über den Alltag. Alltagsleben der mittelalterlichen Rus (basierend auf moralisierender Literatur)
Die Widersprüche zwischen der Abstraktheit der allgemeinen Gesetze der Wissenschaft (einschließlich der Geschichte) und dem konkreten Leben der einfachen Menschen dienten als Grundlage für die Suche nach neuen Ansätzen im historischen Wissen. Die Geschichte spiegelt das Allgemeine wider, weicht vom Besonderen ab und achtet auf die Gesetze und allgemeinen Entwicklungstendenzen. Für einen einfachen Menschen mit seinen spezifischen Lebensumständen und Einzelheiten, mit den Besonderheiten seiner Wahrnehmung und Erfahrung der Welt war kein Platz mehr, er war abwesend. Der individualisierte Alltag eines Menschen, die Sphäre seiner Erfahrungen, die konkreten historischen Aspekte seines Wesens gerieten aus dem Blickfeld der Historiker.
Historiker haben sich dem Studium des Alltagslebens zugewandt, um den oben genannten Widerspruch zu lösen. Dazu trägt auch die aktuelle Situation in der Geschichte bei.
Die moderne Geschichtswissenschaft durchläuft einen tiefgreifenden inneren Wandel, der sich in einem Wandel intellektueller Orientierungen, Forschungsparadigmen und der Sprache der Geschichte selbst manifestiert. Die aktuelle Situation des historischen Wissens wird zunehmend als postmodern charakterisiert. Nachdem die Geschichtsschreibung die „Offensive des Strukturalismus“, die in den 60er Jahren zum „neuen Szientismus“ wurde, und die „linguistische Wende“ oder „semiotische Explosion“ in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts überstanden hatte, musste sie die Auswirkungen des postmodernen Paradigmas erleben, das seinen Einfluss auf alle Bereiche des humanitären Wissens ausdehnte. Die Situation der Krise, deren Höhepunkt die westliche Geschichtswissenschaft in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebte, erlebt heute die russische Wissenschaft.
Auch der Begriff der „historischen Realität“ selbst wird überarbeitet und damit die eigene Identität des Historikers, seine Berufssouveränität, die Kriterien für die Verlässlichkeit der Quelle (die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verschwimmen), der Glaube an die Möglichkeit historischen Wissens und der Wunsch nach objektiver Wahrheit. Bei dem Versuch, die Krise zu lösen, entwickeln Historiker neue Ansätze und neue Ideen, einschließlich der Hinwendung zur Kategorie „Alltag“ als einer der Optionen zur Überwindung der Krise.
Die moderne Geschichtswissenschaft hat Wege gefunden, die historische Vergangenheit anhand ihres Subjekts und Trägers – der Person selbst – besser zu verstehen. Als möglicher Ansatz hierfür gilt eine umfassende Analyse der materiellen und sozialen Formen des Alltags eines Menschen – seines Lebensmikrokosmos, der Stereotypen seines Denkens und Verhaltens.
In den späten 80er und frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts kam es in Anlehnung an die westliche und inländische Geschichtswissenschaft zu einem starken Interesse am Alltagsleben. Es erscheinen erste Werke, in denen vom Alltag die Rede ist. Im Almanach „Odysseus“ erscheint eine Artikelserie, in der versucht wird, den Alltag theoretisch zu begreifen. Dies sind Artikel von G.S. Knabe, A.Ya. Gurewitsch, G.I. Zvereva. Interessen sind auch die Argumentation von S.V. Obolenskaya im Artikel „Jemand Josef Schaefer, ein Soldat der Nazi-Wehrmacht“ über Methoden zur Erforschung der Alltagsgeschichte am Beispiel der Betrachtung der individuellen Biografie eines gewissen Josef Schaefer. Ein gelungener Versuch einer umfassenden Beschreibung des Alltagslebens der Bevölkerung in der Weimarer Republik ist das Werk von I.Ya. Bisca. Anhand einer umfangreichen und vielfältigen Quellenbasis beschrieb er das tägliche Leben verschiedener Bevölkerungsgruppen in Deutschland in der Weimarer Zeit recht ausführlich: sozioökonomisches Leben, Bräuche, spirituelle Atmosphäre. Er liefert überzeugende Daten, konkrete Beispiele, Lebensmittel, Kleidung, Lebensbedingungen usw. Wenn in den Artikeln von G.S. Knabe, A.Ya. Gurewitsch, G.I. Zvereva gibt ein theoretisches Verständnis des Begriffs „Alltag“, dann die Artikel von S.V. Obolenskaya und die Monographie von I.Ya. Biska sind historische Werke, in denen die Autoren versuchen, anhand konkreter Beispiele zu beschreiben und zu definieren, was „Alltag“ bedeutet.
Die begonnene Hinwendung einheimischer Historiker zur Erforschung des Alltagslebens hat in den letzten Jahren abgenommen, da es an Quellen und einem ernsthaften theoretischen Verständnis für dieses Problem mangelt. Es sollte daran erinnert werden, dass man die Erfahrungen der westlichen Geschichtsschreibung – England, Frankreich, Italien und natürlich Deutschland – nicht ignorieren kann.
In den 60-70er Jahren. 20. Jahrhundert Es bestand ein Interesse an der Forschung im Zusammenhang mit der Erforschung des Menschen, und in dieser Hinsicht waren deutsche Wissenschaftler die ersten, die mit der Erforschung der Geschichte des Alltagslebens begannen. Der Slogan lautete: „Vom Studium der Staatspolitik und der Analyse globaler gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse wenden wir uns kleinen Lebenswelten zu, dem Alltag der einfachen Menschen.“ Es entstand die Richtung „Alltagsgeschichte“ bzw. „Geschichte von unten“. Was versteht und versteht man unter Alltag? Wie interpretieren Wissenschaftler es?
Es ist sinnvoll, die wichtigsten deutschen Alltagshistoriker zu nennen. Der Klassiker auf diesem Gebiet ist natürlich ein soziologischer Historiker wie Norbert Elias mit seinen Werken „Über den Begriff des Alltagslebens“, „Über den Prozess der Zivilisation“, „Hofgesellschaft“; Peter Borscheid und sein Werk „Gespräche zur Geschichte des Alltags“. Besonders erwähnen möchte ich den Historiker, der sich mit den Themen der Neuzeit beschäftigt – Lutz Neuhammer, der an der Fernuniversität Hagen arbeitet und sich schon sehr früh, bereits 1980, in einem Artikel in der Zeitschrift „Geschichtsdidaktik“ mit der Geschichte des Alltags beschäftigte. Dieser Artikel trug den Titel „Notizen zur Geschichte des Alltagslebens“. Bekannt für sein weiteres Werk „Lebenserfahrung und kollektives Denken. Üben Sie „Oral History“.
Und ein Historiker wie Klaus Tenfeld beschäftigt sich sowohl mit theoretischen als auch mit praktischen Fragen der Alltagsgeschichte. Sein theoretisches Werk trägt den Titel „Schwierigkeiten im Alltag“ und ist eine kritische Auseinandersetzung mit der tagesgeschichtlichen Strömung mit einer hervorragenden Bibliographie. Die Publikation von Klaus Bergman und Rolf Scherker „Geschichte im Alltag – Alltag in der Geschichte“ besteht aus einer Reihe von Werken theoretischer Natur. Auch der Essener Dr. Peukert, der eine Reihe theoretischer Arbeiten veröffentlichte, beschäftigt sich sowohl theoretisch als auch praktisch mit der Problematik des Alltagslebens. Eines davon ist „Eine neue Geschichte des Alltagslebens und der historischen Anthropologie“. Folgende Werke sind bekannt: Peter Steinbach „Alltag und Dorfgeschichte“, Jürgen Kokka „Klassen oder Kulturen? Durchbrüche und Sackgassen in der Arbeitsgeschichte sowie Martin Broszats Bemerkungen zum Werk von Jürgen Kokk und ihre interessante Arbeit zu den Problemen der Alltagsgeschichte im Dritten Reich. Es gibt auch ein verallgemeinerndes Werk von J. Kuscinski „Geschichte des Alltagslebens des deutschen Volkes. 16001945“ in fünf Bänden.
Ein Werk wie „Geschichte im Alltag – Alltag in der Geschichte“ ist eine Sammlung von Werken verschiedener Autoren, die sich dem Alltag widmen. Berücksichtigt werden folgende Probleme: Alltag der Arbeiter und Bediensteten, Architektur als Quelle der Geschichte des Alltags, Geschichtsbewusstsein im Alltag der Moderne usw.
Besonders hervorzuheben ist, dass in Berlin (3.-6. Oktober 1984) eine Diskussion zum Problem der Alltagsgeschichte stattfand, die am letzten Tag unter dem Motto „Geschichte von unten – Geschichte von innen“ stand. Und unter diesem Titel wurden unter der Herausgeberschaft von Jürgen Kokk die Diskussionsmaterialien veröffentlicht.
Die Sprecher der neuesten Bedürfnisse und Trends im historischen Wissen zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Vertreter der Annales-Schule – das sind Mark Blok, Lucien Febvre und natürlich Fernand Braudel. „Annalen“ in den 30er Jahren. 20. Jahrhundert Wenn sie sich dem Studium eines Arbeiters zuwenden, wird das Thema ihrer Studie die „Geschichte der Massen“ im Gegensatz zur „Geschichte der Sterne“, eine Geschichte, die nicht „von oben“, sondern „von unten“ sichtbar ist. Es wurden die „Geographie des Menschen“, die Geschichte der materiellen Kultur, die historische Anthropologie, die Sozialpsychologie und andere entwickelt, die bisher im Schatten der Richtung der historischen Forschung standen.
Mark Blok beschäftigte sich mit dem Problem des Widerspruchs zwischen dem unvermeidlichen Schematismus des historischen Wissens und dem lebendigen Gefüge des realen historischen Prozesses. Seine Arbeit zielte darauf ab, diesen Widerspruch aufzulösen. Insbesondere betonte er, dass der Fokus der Aufmerksamkeit des Historikers auf einer Person liegen sollte, und er beeilte sich sofort, sich selbst zu korrigieren – nicht eine Person, sondern Menschen. Im Blickfeld von Blok liegen typische, überwiegend masseartige Phänomene, bei denen Wiederholbarkeit erkennbar ist.
Der vergleichend-typologische Ansatz ist in der Geschichtsforschung der wichtigste, doch in der Geschichte entsteht das Regelmäßige durch das Besondere, das Individuelle. Verallgemeinerung ist mit Vereinfachung, Begradigung verbunden, das lebendige Gefüge der Geschichte ist viel komplexer und widersprüchlicher, daher vergleicht Blok die verallgemeinerten Merkmale eines bestimmten historischen Phänomens mit seinen Varianten, zeigt es in einer individuellen Erscheinungsform und bereichert so das Studium, indem es es mit spezifischen Varianten sättigt. So schreibt M. Blok, dass das Bild des Feudalismus keine von der lebendigen Realität abstrahierte Sammlung von Zeichen ist: Es ist auf den realen Raum und die historische Zeit beschränkt und basiert auf Beweisen aus zahlreichen Quellen.
Eine von Bloks methodischen Ideen war, dass das Studium eines Historikers keineswegs mit der Sammlung von Material beginnt, wie oft angenommen wird, sondern mit der Formulierung eines Problems, mit der Entwicklung einer vorläufigen Liste von Fragen, die der Forscher den Quellen stellen möchte. Nicht zufrieden mit der Tatsache, dass die Gesellschaft der Vergangenheit, sagen wir die mittelalterliche, es sich in den Kopf gesetzt hat, durch den Mund von Chronisten, Philosophen, Theologen über sich selbst zu informieren, kann der Historiker durch die Analyse der Terminologie und des Vokabulars der erhaltenen schriftlichen Quellen diesen Denkmälern viel mehr sagen. Wir stellen einer fremden Kultur neue Fragen, die sie sich selbst nicht gestellt hat, wir suchen in ihr nach Antworten auf diese Fragen, und eine fremde Kultur antwortet uns. Während der dialogischen Begegnung der Kulturen behält jede von ihnen ihre Integrität, aber sie werden gegenseitig bereichert. Historisches Wissen ist ein solcher Dialog der Kulturen.
Das Studium des Alltagslebens beinhaltet die Suche nach grundlegenden Strukturen in der Geschichte, die die Reihenfolge menschlichen Handelns bestimmen. Diese Suche beginnt bei den Historikern der Annales-Schule. M. Blok verstand, dass unter dem Deckmantel der von den Menschen verstandenen Phänomene verborgene Schichten einer tiefen sozialen Struktur liegen, die die Veränderungen an der Oberfläche des gesellschaftlichen Lebens bestimmt. Die Aufgabe des Historikers besteht darin, die Vergangenheit zum „Herauslassen“ zu bringen, das heißt zum Ausdruck zu bringen, was sie nicht erkannte oder nicht sagen wollte.
Eine Geschichte zu schreiben, in der lebende Menschen agieren, ist das Motto von Blok und seinen Anhängern. Die kollektive Psychologie erregt ihre Aufmerksamkeit auch deshalb, weil sie das gesellschaftlich bedingte Verhalten von Menschen zum Ausdruck bringt. Eine neue Frage für die Geschichtswissenschaft war damals die menschliche Sensibilität. Man kann nicht so tun, als würde man Menschen verstehen, ohne zu wissen, wie sie sich fühlen. Ausbrüche von Verzweiflung und Wut, rücksichtsloses Handeln, plötzliche mentale Brüche – sie bereiten Historikern, die instinktiv dazu neigen, die Vergangenheit nach den Schemata ihres Geistes zu rekonstruieren, viele Schwierigkeiten. M. Blok und L. Febvre sahen ihr „Reservat“ in der Geschichte der Gefühle und Denkweisen und entwickelten diese Themen mit Begeisterung weiter.
M. Blok hat Umrisse der Theorie der „Zeit von großer Dauer“, die später von Fernand Braudel entwickelt wurde. Vertreter der Annales-Schule befassen sich vor allem mit der Zeit großer Länge, das heißt, sie untersuchen die Strukturen des Alltagslebens, die sich im Laufe der Zeit nur sehr langsam oder eigentlich gar nicht verändern. Gleichzeitig ist das Studium solcher Strukturen die Hauptaufgabe eines jeden Historikers, da sie das Wesen des täglichen Lebens eines Menschen, die Stereotypen seines Denkens und Verhaltens, die sein tägliches Leben regeln, aufzeigen.
Die direkte Thematisierung der Alltagsproblematik im historischen Wissen ist in der Regel mit dem Namen Fernand Braudel verbunden. Das ist ganz natürlich, denn das erste Buch seines berühmten Werkes „Materialwirtschaft und Kapitalismus des 18.-18. Jahrhunderts“. und heißt: „Die Strukturen des Alltags: das Mögliche und das Unmögliche.“ Er schrieb darüber, wie das Alltagsleben erkannt werden kann: „Das materielle Leben besteht aus Menschen und Dingen, Dingen und Menschen. Dinge zu studieren – Nahrung, Wohnungen, Kleidung, Luxusgüter, Werkzeuge, Geld, Pläne von Dörfern und Städten – kurz alles, was einem Menschen dient – ist die einzige Möglichkeit, sein tägliches Leben zu erleben. Und die Bedingungen des alltäglichen Lebens, der kulturelle und historische Kontext, in dem sich das Leben eines Menschen abspielt, seine Geschichte, haben einen entscheidenden Einfluss auf das Handeln und Verhalten der Menschen.
Fernand Braudel schrieb über den Alltag: „Der Ausgangspunkt für mich war“, betonte er, „der Alltag – die Seite des Lebens, in die wir eingebunden waren, ohne es zu merken, eine Gewohnheit oder gar eine Routine, diese Tausenden von Handlungen, die wie von selbst ablaufen und enden, deren Umsetzung keiner Entscheidung bedarf und die in Wahrheit fast ohne Beeinträchtigung unseres Bewusstseins ablaufen.“ Ich glaube, dass die Menschheit zu mehr als der Hälfte in einen solchen Alltag vertieft ist. Unzählige Handlungen, vererbt, kumulativ ohne Reihenfolge. Das Wiederholen bis ins Unendliche, bevor wir auf die Welt kamen, hilft uns zu leben – und unterwirft uns gleichzeitig, indem es im Laufe unseres Daseins viel für uns entscheidet. Hier geht es um Motive, Impulse, Stereotypen, Handlungsmethoden und Handlungsweisen sowie verschiedene Arten von Verpflichtungen, die zum Handeln zwingen und die manchmal, und häufiger als man denkt, bis in die längste Zeit zurückreichen.
Darüber hinaus schreibt er, dass diese alte Vergangenheit mit der Gegenwart verschmilzt und er selbst sehen und anderen zeigen wollte, wie diese Vergangenheit, eine kaum beachtete Geschichte – wie eine verdichtete Masse gewöhnlicher Ereignisse – im Laufe der langen Jahrhunderte der Vorgeschichte in das Fleisch der Menschen selbst eingedrungen ist, für die die Erfahrungen und Wahnvorstellungen der Vergangenheit zur Alltäglichkeit und alltäglichen Notwendigkeit geworden sind und sich der Aufmerksamkeit der Beobachter entziehen.
Die Werke von Fernand Braudel enthalten philosophische und historische Reflexionen über den mit einem Zeichen gekennzeichneten Alltag des materiellen Lebens, über die komplexe Verflechtung verschiedener Ebenen der historischen Realität, über die Dialektik von Zeit und Raum. Der Leser seiner Werke sieht sich mit drei verschiedenen Plänen, drei Ebenen konfrontiert, in denen dieselbe Realität auf unterschiedliche Weise erfasst wird, sich ihr Inhalt und ihre räumlich-zeitlichen Eigenschaften ändern. Wir sprechen von flüchtiger ereignispolitischer Zeit auf der höchsten Ebene, von viel längerfristigen sozioökonomischen Prozessen auf einer tieferen Ebene und von nahezu zeitlosen natürlich-geografischen Prozessen auf der tiefsten Ebene. Darüber hinaus ist die Unterscheidung zwischen diesen drei Ebenen (tatsächlich sieht F. Braudel in jeder dieser drei Ebenen mehrere weitere Ebenen) keine künstliche Zerlegung der lebendigen Realität, sondern deren Betrachtung in unterschiedlichen Brechungen.
In den untersten Schichten der historischen Realität, wie in den Tiefen des Meeres, dominieren Beständigkeit, stabile Strukturen, deren Hauptelemente Mensch, Erde, Raum sind. Die Zeit vergeht hier so langsam, dass es fast bewegungslos erscheint. Auf der nächsten Ebene – der Ebene der Gesellschaft, der Zivilisation, der Ebene, die die sozioökonomische Geschichte studiert – gibt es eine Zeit mittlerer Dauer. Zum Schluss noch die oberflächlichste Schicht der Geschichte: Hier wechseln sich Ereignisse ab wie Wellen im Meer. Sie werden in kurzen chronologischen Einheiten gemessen – dies ist eine politische, diplomatische und ähnliche „Ereignis“-Geschichte.
Für F. Braudel ist die Sphäre seiner persönlichen Interessen eine nahezu unverrückbare Geschichte der Menschen in ihrer engen Beziehung zu dem Land, auf dem sie wandeln und das sie ernährt; die Geschichte des immer wiederkehrenden Dialogs des Menschen mit der Natur, der so hartnäckig ist, als wäre er außerhalb der Reichweite der Schäden und Schläge der Zeit. Eines der Probleme des Geschichtswissens bleibt bis heute die Haltung gegenüber der Behauptung, dass die Geschichte als Ganzes nur im Vergleich zu diesem grenzenlosen Raum nahezu unverrückbarer Realität, in der Identifizierung langfristiger Prozesse und Phänomene, verstanden werden könne.
Was ist also der Alltag? Wie kann es definiert werden? Versuche einer eindeutigen Definition blieben erfolglos: Der Alltag wird von manchen Wissenschaftlern als Sammelbegriff für die Manifestation aller Formen des Privatlebens verwendet, andere verstehen darunter die sich täglich wiederholenden Handlungen des sogenannten „grauen Alltags“ oder die Sphäre des natürlichen unreflexiven Denkens. Der deutsche Soziologe Norbert Elias stellte 1978 fest, dass es keine genaue und klare Definition des Alltags gibt. Die Art und Weise, wie dieser Begriff heute in der Soziologie verwendet wird, umfasst die unterschiedlichsten Schattierungen, die für uns jedoch immer noch unerkannt und unverständlich bleiben.
N. Elias hat versucht, den Begriff „Alltag“ zu definieren. Dieses Thema interessiert ihn schon lange. Manchmal zählte er selbst zu denjenigen, die sich mit diesem Problem befassten, da er in seinen beiden Werken „Hofgesellschaft“ und „Über den Prozess der Zivilisation“ Themen behandelte, die sich leicht den Problemen des Alltags zuordnen lassen. Aber N. Elias selbst betrachtete sich nicht als Spezialist für das Alltagsleben und beschloss, dieses Konzept zu klären, als er eingeladen wurde, einen Artikel zu diesem Thema zu schreiben. Norbert Elias hat vorläufige Listen einiger Anwendungen des Konzepts zusammengestellt, die in der wissenschaftlichen Literatur zu finden sind.
Napoleon Bonaparte ist die umstrittenste und interessanteste Figur in der französischen Geschichte. Die Franzosen verehren und vergöttern ihn als Nationalhelden.
Und es spielt keine Rolle, dass er den Vaterländischen Krieg von 1812 in Russland verloren hat, Hauptsache, er ist Napoleon Bonaparte!
Für mich persönlich ist er eine Lieblingsfigur der französischen Geschichte. Ich hatte immer Respekt vor seinem Talent als Kommandant – der Einnahme von Toulon im Jahr 1793, Siegen in den Schlachten von Arcole oder Rivoli.
Deshalb werde ich heute über das tägliche Leben der Franzosen zur Zeit Napoleon Bonapartes sprechen.
Sie werden sagen, dass es seit undenklichen Zeiten möglich war, dieses Thema chronologisch vorzugehen und schrittweise aufzudecken. Und ich sage, es ist langweilig, und mein Blog wird zu einem französischen Geschichtsbuch, und dann werden Sie aufhören, es zu lesen. Daher werde ich zunächst über die interessantesten und nicht der Reihe nach sprechen. Es ist so viel interessanter! Ist es wahr?
Wie lebten die Menschen zur Zeit Napoleon Bonapartes? Finden wir es gemeinsam heraus...
Über Sèvres-Porzellan.
Wenn wir über die französische Industrie sprechen, dann war die Glaswaren-, Töpfer- und Porzellanproduktion die fortschrittlichste Produktion.
Porzellanprodukte aus der Fabrik in Sèvres bei Paris erlangten weltweite Berühmtheit ( berühmtes Sèvres-Porzellan). Diese Manufaktur wurde 1756 vom Schloss in Vincennes verlegt.
Als Napoleon Kaiser wurde, begannen sich im Porzellangeschäft die Tendenzen des Klassizismus durchzusetzen. Sevres-Porzellan wurde mit exquisiten Ornamenten verziert, die meist mit einem farbigen Hintergrund kombiniert wurden.
Nach dem Abschluss des Friedens von Tilsit (1807) schenkte Napoleon dem russischen Kaiser Alexander I. wenige Monate später einen prächtigen olympischen Gottesdienst (im Bild). Sèvres-Porzellan wurde auch von Napoleon auf der Insel St. Helena verwendet.
Über Arbeiter.
Nach und nach begab sich die Industrie in Frankreich auf die maschinelle Produktion. Das metrische Maßsystem wurde eingeführt. Und im Jahr 1807 wurde das Handelsgesetzbuch geschaffen und verkündet.
Dennoch wurde Frankreich nicht zum Weltmarktführer, aber die Löhne der Arbeiter stiegen nach und nach und Massenarbeitslosigkeit wurde vermieden.
In Paris verdiente ein Arbeiter 3-4 Franken pro Tag, in der Provinz 1,2-2 Franken pro Tag. Französische Arbeiter begannen, häufiger Fleisch zu essen und sich besser zu kleiden.
Über Geld.
Wir alle wissen, dass sie jetzt in Frankreich die Währung verwenden Euro €. Aber am häufigsten vergessen wir frühere Währungen, vielleicht erinnern wir uns nur an sie Franc und ein seltsames Wort "Ecu".
Korrigieren wir das und erkundigen uns sozusagen nach den alten französischen Währungseinheiten.
Also, Livres, Francs, Napoleons – was für hübsche Namen, oder?
Buch war bis zur Einführung des Franc im Jahr 1799 die Währung Frankreichs. Wussten Sie, dass die Teilnehmer der Ägyptenexpedition, die 1798 begann, ein Gehalt erhielten? Ja, und das ist so, nur dann nannten sie es Gehalt. So erhielten berühmte Wissenschaftler 500 Livres im Monat und gewöhnliche 50 Livres.
Und 1834 wurden auf Livres lautende Münzen aus dem Umlauf genommen.
Franc war ursprünglich aus Silber und wog nur 5 Gramm. Dieses sogenannte Keimfranken im März 1803 in Umlauf gebracht und blieb bis 1914 stabil! (Bild rechts)
 Und hier napoleondor war eine Goldmünze, die 20 Franken entsprach und 5,8 Gramm reines Gold enthielt. Diese Münzen werden seit 1803 geprägt.
Und hier napoleondor war eine Goldmünze, die 20 Franken entsprach und 5,8 Gramm reines Gold enthielt. Diese Münzen werden seit 1803 geprägt.
Und der Ursprung des Namens ist sehr einfach, denn auf der Münze waren Bilder von Napoleon I. und später Napoleon III. zu sehen. Diese Goldmünze ist überhaupt nicht einfach, denn sie konnte in verschiedenen Variationen geprägt werden – doppelte Napoleons (40 Franken), 1/2 Napoleondors (10 Franken) und 1/4 (5 Franken).
Du fragst, wie Louis Und Ecu?
Diese Münzen gingen schneller aus dem Umlauf. Beispielsweise wurde der Louis d'or (französische Goldmünze) erstmals unter Ludwig XIII. geprägt und beendete sein „Leben“ im Jahr 1795.
A Ecu existierten seit dem 13. Jahrhundert, zunächst waren es Gold, dann Silber, und Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie aus dem Verkehr gezogen. Doch hinter der Fünf-Franken-Münze blieb der Name „Ecu“.
Dennoch trafen Liebhaber der Belletristik diesen Namen oft auf den Seiten von Büchern französischer Schriftsteller.
Über Essen.
Waren die Hauptnahrungsmittel der Franzosen früher Brot, Wein und Käse, dann im 19. Jahrhundert Kartoffel aus Amerika importiert. Dadurch wächst die Bevölkerung, da in ganz Frankreich aktiv Kartoffeln angebaut werden, was eine große Ernte bringt.
Malt farbenfroh die Vorteile von Kartoffeln J.J. Menü, ein Bewohner des Departements Isère (fr. Isère) im Südosten Frankreichs:
„Diese frei verortete, gepflegte und wohlhabende Kultur in meinem Besitz hat mir viele Vorteile gebracht; die Kartoffel erwies sich als sehr profitabel, sie fand Verwendung auf dem Tisch der Besitzer, Arbeiter und Bediensteten, sie diente als Futter für Hühner, Truthähne, Schweine; es reichte für die Anwohner und zum Verkauf usw. Was für eine Fülle, was für ein Vergnügen!“
Ja, und Napoleon selbst bevorzugte alle Gerichte - mit Zwiebeln gebratene Kartoffeln.
Kein Wunder also, dass die einfache Kartoffel zum Lieblingsgericht aller Franzosen geworden ist. Zeitgenossen schreiben, dass sie auf einer Dinnerparty waren, bei der alle Gerichte ausschließlich aus Kartoffeln zubereitet wurden. So!
Über Kunst.
Was fordern die Menschen? Rechts - „Meal'n'Real!“
Wir sprachen über das tägliche Brot bzw. die Kartoffeln, die einen festen Platz im Leben der Franzosen einnahmen. Jetzt lernen wir etwas über Brillen – über spirituelle Nahrung.
Generell muss man das sagen Napoleon Bonaparte unterstützte aktiv das Theater, Schauspieler und Dramatiker. In der Mode, Kunst und Architektur dieser Zeit ist der Stileinfluss stark ausgeprägt "Reich". Napoleon mag Schauspiel.
Er sprach mit dem Dichter darüber Goethe:
„Die Tragödie sollte eine Schule für Könige und Nationen sein; Das ist die höchste Stufe, die ein Dichter erreichen kann.“
Die Schirmherrschaft des Theaters erstreckte sich nach und nach auf bestimmte Schauspielerinnen, die Mätressen der ersten Personen des Staates wurden: Teresa Bourgoin – Innenministerin Chaptal, und Mademoiselle Georges – Napoleon selbst.
Dennoch, Entwicklung des Theaters im Kaiserreich ist in vollem Gange, dominiert dort Talma. Ein talentierter Eingeborener aus einer Familie von Zahnärzten. Er erhielt eine hervorragende Ausbildung und führte sogar noch einige Zeit die Arbeit seines Vaters fort, indem er in seiner Freizeit auf kleinen Bühnen spielte. 
In einem schönen Moment beschloss Talma, sein Leben zu ändern und machte seinen Abschluss an der Königlichen Schule für Rezitation und Gesang in Paris. UND im Jahr 1787 debütierte erfolgreich auf der Theaterbühne „Comedy Francaise“ in Voltaires Theaterstück Mahomet. Bald wurde er in den Aktionärskreis des Theaters aufgenommen.
Talma brach mit der lächerlichen jahrhundertealten Theatertradition, nach der die Schauspieler die Helden verschiedener Epochen in den Kostümen ihrer Zeit darstellten – in Perücken und Samt!
UND theatralisch „revolutionär“ führte nach und nach antike, mittelalterliche, orientalische und Renaissance-Kostüme ins Theater ein! ( François Joseph Talma abgebildet als Nero im Gemälde von E. Delacroix).
Talma trat aktiv für die Wahrhaftigkeit der Rede in allem ein, auch in der Diktion. Seine Ansichten entstanden unter dem Einfluss der französischen und englischen Aufklärer. Und von den ersten Tagen der Großen Revolution an versuchte er, ihre Ideen auf der Bühne zu verkörpern. Das Schauspieler geleitet eine Truppe revolutionär gesinnter Schauspieler, die 1791 die Comédie Française verließ. Und sie gründeten das Theater der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, das später zum Theater der Republik in der Richelieu-Straße wurde.
Das „alte“ Theater oder das Theater der Nation inszenierte Stücke, die für die Behörden anstößig waren. Und die Revolutionsregierung schloss es, die Schauspieler wurden ins Gefängnis geworfen. Sie entgingen jedoch der Hinrichtung, weil ein Beamter des Ausschusses für öffentliche Sicherheit ihre Papiere vernichtete.
Nach dem Sturz Robespierres schlossen sich die Reste der Truppen beider Theater zusammen, und Talma musste sich vor der Öffentlichkeit rechtfertigen, indem er sich gegen den revolutionären Terror aussprach.
Dies sind die hellen Veränderungen, die dank talentierter, fürsorglicher Menschen im Theater stattgefunden haben.
Und es ist erwähnenswert, dass die Franzosen nicht nur Tragödien sahen! N.M. Karamzin schrieb in seinen Briefen eines russischen Reisenden über fünf Theater – die Bolschoi-Oper, das Französische Theater, das Italienische Theater, das Graf-von-Provence-Theater und das Varieté.
Abschließend möchte ich hinzufügen ein paar interessante Fakten :
- Die Jahre des Imperiums umfassen die ersten Experimente auf diesem Gebiet Fotos.
– Und natürlich der Ruhm des Nationalen Parfümerie ist riesig, und wenn ein Franzose damit in einem anderen Land beginnt, wird er auf jeden Fall Erfolg haben!
Frankreich nimmt unter den Parfümeuren der Welt immer noch einen herausragenden Platz ein. Was ist es wert Parfümhaus Fragonard in der südlichen Stadt Grasse. Übrigens kann jeder das historische Museum der Fabrik besuchen und die alte Ausrüstung der Parfümeure mit eigenen Augen sehen.
P.S. Mit dieser schönen Bemerkung beende ich meine Geschichte über das tägliche Leben der Franzosen zur Zeit Napoleon Bonapartes. Und wer noch mehr Details zu diesem Thema wissen möchte, dem kann ich Andrey Ivanovs faszinierendes Buch „Das tägliche Leben der Franzosen unter Napoleon“ empfehlen.
Wenn Sie Lust haben, eine Frage zu stellen, Ihre Meinung zu äußern oder ein neues Thema für einen Artikel vorzuschlagen, schreiben Sie alles gerne in die Kommentare 😉
Vielen Dank, dass Sie meine Artikel und Videos mit Ihren Freunden in sozialen Netzwerken teilen. Klicken Sie auf soziale Symbole Netzwerke unter dem Artikel, abonnieren Sie meine Konten, um über die Neuigkeiten des Projekts zu erfahren.
Komposition
Der Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ von Iwan Alexandrowitsch Gontscharow war eines der ersten russischen realistischen Werke, das vom Alltag der einfachen Leute erzählt. Der Roman zeigt Bilder der russischen Realität in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, typische Lebensumstände eines Menschen dieser Zeit.
Der Roman wurde 1847 veröffentlicht. Es erzählt vom Schicksal des jungen Provinzials Alexander Aduev, der zu seinem Onkel nach St. Petersburg kam. Auf den Seiten des Buches spielt sich mit ihm eine „gewöhnliche Geschichte“ ab – die Verwandlung eines romantischen, reinen jungen Mannes in einen umsichtigen und kalten Geschäftsmann.
Aber diese Geschichte wird von Anfang an sozusagen von zwei Seiten erzählt – aus der Sicht Alexanders selbst und aus der Sicht seines Onkels Peter Aduev. Bereits beim ersten Gespräch wird deutlich, wie gegensätzlich die Natur der beiden ist. Alexander zeichnet sich durch ein romantisches Weltbild, Liebe zur gesamten Menschheit, Unerfahrenheit und einen naiven Glauben an „ewige Eide“ und „Versprechen der Liebe und Freundschaft“ aus. Er ist fremd und ungewohnt in der kalten und entfremdeten Welt der Hauptstadt, wo auf relativ kleinem Raum eine große Zahl völlig gleichgültiger Menschen zusammenlebt. Selbst die familiären Beziehungen in St. Petersburg sind viel trockener als die, die er in seinem Dorf gewohnt war.
Alexanders Begeisterung bringt seinen Onkel zum Lachen. Aduev Sr. spielt ständig und sogar mit einigem Vergnügen die Rolle einer „Wanne mit kaltem Wasser“, wenn er Alexanders Begeisterung mäßigt: Entweder befiehlt er, die Wände seines Büros mit Gedichten zu bekleben, oder er wirft das „materielle Versprechen der Liebe“ aus dem Fenster. Petr Aduev selbst ist ein erfolgreicher Industrieller, ein nüchterner, praktisch denkender Mann, der jedes „Gefühl“ für überflüssig hält. Gleichzeitig versteht und schätzt er Schönheit, weiß viel über Literatur und Theaterkunst. Er stellt Alexanders Überzeugungen seine eigenen gegenüber, und es stellt sich heraus, dass sie ihrer Wahrheit nicht beraubt werden.
Warum sollte er eine Person lieben und respektieren, nur weil diese Person sein Bruder oder Neffe ist? Warum sollte man die Verse eines jungen Mannes fördern, der offensichtlich kein Talent hat? Wäre es nicht besser, ihm rechtzeitig einen anderen Weg zu zeigen? Schließlich versuchte Peter Aduev, Alexander auf seine Weise zu erziehen, ihn vor zukünftigen Enttäuschungen zu schützen.
Das beweisen drei Liebesgeschichten, in die Alexander verfällt. Jedes Mal kühlt die romantische Hitze der Liebe in ihm immer mehr ab und trifft auf die grausame Realität. Alle Worte, Taten und Taten von Onkel und Neffe stehen also sozusagen in ständigem Dialog. Der Leser vergleicht, vergleicht diese Charaktere, denn es ist unmöglich, das eine zu bewerten, ohne das andere zu betrachten. Aber es erweist sich auch als unmöglich zu entscheiden, welche davon richtig ist?
Es scheint, dass das Leben selbst Peter Aduev hilft, seinem Neffen seinen Fall zu beweisen. Nach ein paar Monaten in St. Petersburg ist von Aduev Jr.s schönen Idealen nichts mehr übrig geblieben – sie sind hoffnungslos gebrochen. Als er ins Dorf zurückkehrt, schreibt er seiner Tante, Peters Frau, einen bitteren Brief, in dem er seine Erfahrungen und Enttäuschungen zusammenfasst. Dies ist ein Brief eines reifen Mannes, der viele Illusionen verloren hat, aber sein Herz und seinen Verstand bewahrt hat. Alexander lernt eine grausame, aber nützliche Lektion.
Aber ist Pjotr Aduev selbst glücklich? Nachdem er sein Leben rational organisiert hat und nach den Berechnungen und festen Prinzipien eines kalten Geistes lebt, versucht er, seine Gefühle dieser Ordnung unterzuordnen. Nachdem er eine hübsche junge Frau zu seiner Frau gewählt hat (hier ist sie eine Vorliebe für Schönheit!), möchte er ihre Lebenspartnerin nach seinem Ideal erziehen: ohne „dumme“ Sensibilität, übermäßige Impulse und unvorhersehbare Emotionen. Doch Elizaveta Alexandrowna stellt sich unerwartet auf die Seite ihres Neffen und spürt in Alexander eine Seelenverwandtschaft. Sie kann nicht ohne Liebe leben, ohne all diese notwendigen „Exzesse“. Und als sie krank wird, erkennt Pjotr Aduev, dass er ihr in keiner Weise helfen kann: Sie ist ihm lieb, er würde alles geben, aber er hat nichts zu geben. Nur die Liebe kann sie retten, und Aduev Sr. weiß nicht, wie man liebt.
Und als ob er die Dramatik der Situation noch weiter beweisen wollte, erscheint im Nachwort Alexander Aduev – kahlköpfig, rundlich. Er hat, für den Leser etwas unerwartet, alle Prinzipien seines Onkels gelernt und verdient viel Geld und wird sogar „für Geld“ heiraten. Als Onkel ihn an seine vergangenen Worte erinnert. Alexander lacht nur. In dem Moment, in dem Aduev Sr. den Zusammenbruch seines harmonischen Lebenssystems erkennt, wird Aduev Jr. zur Verkörperung dieses Systems und nicht zu seiner besten Version. Sie haben sozusagen die Plätze getauscht.
Das Problem, sogar die Tragödie dieser Helden besteht darin, dass sie die Pole der Weltanschauungen blieben, sie konnten keine Harmonie erreichen, das Gleichgewicht dieser positiven Prinzipien, die in beiden von ihnen waren; Sie verloren den Glauben an hohe Wahrheiten, weil das Leben und die umgebende Realität sie nicht brauchten. Und leider ist dies eine häufige Geschichte.
Der Roman regte die Leser zum Nachdenken über die scharfen moralischen Fragen an, die das russische Leben zu dieser Zeit aufwarf. Warum fand der Prozess der Wiedergeburt eines romantisch denkenden jungen Mannes zum Bürokraten und Unternehmer statt? Ist es wirklich notwendig, nach dem Verlust der Illusionen aufrichtige und edle menschliche Gefühle loszuwerden? Diese Fragen beschäftigen den Leser heute. I.A. Auf all diese Fragen gibt uns Goncharov in seinem wunderbaren Werk Antworten
Weitere Schriften zu diesem Werk
„Goncharovs Idee war umfassender. Er wollte der modernen Romantik im Allgemeinen einen Schlag versetzen, schaffte es jedoch nicht, das ideologische Zentrum zu bestimmen. Statt der Romantik verspottete er provinzielle Versuche der Romantik“ (nach dem Roman von Goncharov „Gewöhnliche Geschichte“ von I.A. Goncharov „Verlust romantischer Illusionen“ (basierend auf dem Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“) Der Autor und seine Figuren im Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ Der Autor und seine Figuren in I. A. Goncharovs Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ Die Hauptfiguren von I. Goncharovs Roman „Ordinary History“. Der Protagonist von I. Goncharovs Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ Zwei Lebensphilosophien im Roman von I. A. Goncharov „Ordinary History“ Onkel und Neffe von Adueva im Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ Wie man lebt? Das Bild von Alexander Aduev. Petersburg und die Provinzen in I. Goncharovs Roman „Gewöhnliche Geschichte“ Rezension des Romans von I. A. Goncharov „Eine gewöhnliche Geschichte“ Reflexion historischer Veränderungen in Goncharovs Roman „Ordinary History“ Warum heißt der Roman von I.A. Goncharov „Ordinary History“? Russland im Roman von I. A. Goncharov „Ordinary History“ Die Bedeutung des Titels des Romans von I. Goncharov „Ordinary History“. Die Bedeutung des Titels des Romans von I. A. Goncharov „Ordinary History“ Vergleichende Merkmale der Hauptfiguren von I. Goncharovs Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ Altes und neues Russland im Roman von I. A. Goncharov „Gewöhnliche Geschichte“ Gewöhnliche Geschichte von Alexander Aduev Merkmale des Bildes von Alexander Aduev Vergleichende Merkmale von Ilja Iljitsch Oblomow und Alexander Adujew (Merkmale der Charaktere in Goncharovs Romanen) Über Goncharovs Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ Die Handlung von Goncharovs Roman Goncharov I. A. „Eine gewöhnliche Geschichte“ Vergleichende Merkmale der Helden des Romans von I. A. Goncharov „Ordinary History“ Die Geschichte des Schreibens von Goncharovs Roman „Cliff“ Alexander und Pjotr Iwanowitsch Aduev im Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ Der Autor und seine Figuren im Roman Die Bedeutung des Titels des Romans von I. Goncharov Der Roman „Eine gewöhnliche Geschichte“ (erste Kritik, erster Ruhm) Das Bild von Alexander Aduev, St. Petersburg und den Provinzen Der Held des Romans „Eine gewöhnliche Geschichte“Das Problem des Alltagslebens eines Menschen hat seinen Ursprung in der Antike – nämlich, als ein Mensch die ersten Versuche unternahm, sich selbst und seinen Platz in der Welt um ihn herum zu erkennen.
Allerdings waren die Vorstellungen über das Alltagsleben in der Antike und im Mittelalter überwiegend mythologisch-religiöser Natur.
Der Alltag eines alten Menschen ist also von Mythologie durchdrungen, und die Mythologie wiederum ist mit vielen Merkmalen des Alltagslebens der Menschen ausgestattet. Die Götter sind verbesserte Menschen, die dieselben Leidenschaften leben, nur mit größeren Fähigkeiten und Möglichkeiten ausgestattet. Die Götter kommen leicht mit Menschen in Kontakt und die Menschen wenden sich bei Bedarf an die Götter. Gute Taten werden direkt auf der Erde belohnt und schlechte Taten werden sofort bestraft. Der Glaube an Vergeltung und die Angst vor Strafe bilden die Mystik des Bewusstseins und damit der täglichen Existenz eines Menschen, die sich sowohl in elementaren Ritualen als auch in den Besonderheiten der Wahrnehmung und des Verständnisses der umgebenden Welt manifestiert.
Man kann argumentieren, dass die alltägliche Existenz eines antiken Menschen zweigeteilt ist: Sie ist denkbar und empirisch nachvollziehbar, das heißt, es gibt eine Einteilung des Seins in die sinnlich-empirische Welt und die ideale Welt – die Welt der Ideen. Die Vorherrschaft der einen oder anderen ideologischen Einstellung hatte einen erheblichen Einfluss auf die Lebensweise eines Menschen der Antike. Der Alltag wird erst langsam als Bereich zur Entfaltung der Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen betrachtet.
Es wird als eine Existenz verstanden, die auf die Selbstverbesserung des Einzelnen ausgerichtet ist und die harmonische Entwicklung der körperlichen, intellektuellen und spirituellen Fähigkeiten impliziert. Gleichzeitig wird die materielle Seite des Lebens in den Hintergrund gedrängt. Einer der höchsten Werte der Antike ist die Mäßigung, die sich in einem eher bescheidenen Lebensstil manifestiert.
Gleichzeitig wird der Alltag des Einzelnen nicht außerhalb der Gesellschaft gedacht und nahezu vollständig von ihr bestimmt. Für einen Polisbürger ist es von größter Bedeutung, seine staatsbürgerlichen Pflichten zu kennen und zu erfüllen.
Die mystische Natur des Alltagslebens eines alten Menschen, gepaart mit dem Verständnis eines Menschen für seine Einheit mit der umgebenden Welt, der Natur und dem Kosmos, verleiht dem Alltagsleben eines alten Menschen ausreichend Ordnung und gibt ihm ein Gefühl von Sicherheit und Zuversicht.
Im Mittelalter wird die Welt durch das Prisma Gottes gesehen und Religiosität wird zum dominierenden Moment des Lebens und manifestiert sich in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Dies führt zur Bildung einer eigentümlichen Weltanschauung, in der der Alltag als eine Kette religiöser Erfahrungen eines Menschen erscheint, während religiöse Riten, Gebote und Kanons in den Lebensstil des Einzelnen eingebunden sind. Die gesamte Bandbreite der Emotionen und Gefühle eines Menschen ist religiös (Glaube an Gott, Liebe zu Gott, Hoffnung auf Erlösung, Angst vor Gottes Zorn, Hass auf den Teufelsversucher usw.).
Das irdische Leben ist mit spirituellen Inhalten gesättigt, wodurch eine Verschmelzung von spirituellem und sinnlich-empirischem Sein erfolgt. Das Leben provoziert einen Menschen zu sündigen Taten, indem es ihm alle möglichen Versuchungen „wirft“, aber es ermöglicht auch, seine Sünden durch moralische Taten zu sühnen.
In der Renaissance unterliegen die Vorstellungen über den Zweck eines Menschen, über seine Lebensweise erheblichen Veränderungen. In dieser Zeit erscheinen sowohl der Mensch als auch sein Alltag in einem neuen Licht. Der Mensch wird als kreativer Mensch dargestellt, als Mitschöpfer Gottes, der in der Lage ist, sich und sein Leben zu verändern, der weniger von äußeren Umständen und viel mehr von seinem eigenen Potenzial abhängig ist.
Der Begriff „Alltag“ selbst taucht im Zeitalter des New Age dank M. Montaigne auf, der damit gewöhnliche, standardmäßige und bequeme Momente der Existenz eines Menschen bezeichnet und sich in jedem Moment einer alltäglichen Leistung wiederholt. Wie er zu Recht bemerkt, sind alltägliche Probleme nie klein. Der Wille zum Leben ist die Grundlage der Weisheit. Das Leben wird uns als etwas geschenkt, das nicht von uns abhängt. Sich mit seinen negativen Aspekten (Tod, Sorgen, Krankheiten) auseinanderzusetzen bedeutet, das Leben zu unterdrücken und zu leugnen. Der Weise muss sich bemühen, alle Argumente gegen das Leben zu unterdrücken und zurückzuweisen und muss ein bedingungsloses Ja zum Leben und zu allem, was Leben ist – Trauer, Krankheit und Tod – sagen.
Im 19. Jahrhundert Von dem Versuch, den Alltag rational zu begreifen, gehen sie über zur Betrachtung seiner irrationalen Komponente: Ängste, Hoffnungen, tiefe menschliche Bedürfnisse. Laut S. Kierkegaard wurzelt das menschliche Leiden in der ständigen Angst, die ihn in jedem Moment seines Lebens verfolgt. Wer in der Sünde versunken ist, fürchtet sich vor einer möglichen Bestrafung, wer von der Sünde befreit ist, den nagt die Angst vor einem erneuten Sündenfall. Allerdings wählt der Mensch sein Wesen selbst.
Eine düstere, pessimistische Sicht auf das menschliche Leben wird in den Werken von A. Schopenhauer präsentiert. Das Wesen des Menschen ist der Wille, ein blinder Angriff, der das Universum erregt und offenbart. Der Mensch wird von einem unstillbaren Durst getrieben, der von ständiger Angst, Not und Leid begleitet wird. Nach Schopenhauer leiden wir an sechs der sieben Tage der Woche und haben Lust, und am siebten sterben wir vor Langeweile. Darüber hinaus zeichnet sich ein Mensch durch eine enge Wahrnehmung der ihn umgebenden Welt aus. Er stellt fest, dass es in der Natur des Menschen liegt, über die Grenzen des Universums hinauszudringen.
Im 20. Jahrhundert. Der Hauptgegenstand wissenschaftlicher Erkenntnisse ist der Mensch selbst in seiner Einzigartigkeit und Originalität. W. Dilthey, M. Heidegger, N. A. Berdyaev und andere weisen auf die Widersprüchlichkeit und Mehrdeutigkeit der menschlichen Natur hin.
In dieser Zeit treten die „ontologischen“ Probleme des menschlichen Lebens in den Vordergrund und die phänomenologische Methode wird zu einem besonderen „Prisma“, durch das Vision, Verständnis und Erkenntnis der Realität, einschließlich der sozialen Realität, durchgeführt werden.
Die Lebensphilosophie (A. Bergson, W. Dilthey, G. Simmel) konzentriert sich auf die irrationalen Bewusstseinsstrukturen im menschlichen Leben, berücksichtigt seine Natur, seine Instinkte, das heißt, der Mensch gibt sein Recht auf Spontaneität und Natürlichkeit zurück. A. Bergson schreibt also, dass wir von allen Dingen am sichersten sind und am besten unsere eigene Existenz kennen.
In den Werken von G. Simmel findet sich eine negative Einschätzung des Alltags. Der Routine des Alltags steht für ihn ein Abenteuer als eine Zeit höchster Spannung und Schärfe des Erlebens gegenüber, der Moment des Abenteuers existiert gleichsam unabhängig vom Alltag, er ist ein separates Fragment der Raumzeit, in dem andere Gesetze und Bewertungskriterien gelten.
Der Appell an den Alltag als eigenständiges Problem erfolgte durch E. Husserl im Rahmen der Phänomenologie. Für ihn wird die vitale, alltägliche Welt zu einem Universum von Bedeutungen. Die Alltagswelt hat eine innere Ordnung, sie hat eine besondere kognitive Bedeutung. Dank E. Husserl erlangte der Alltag in den Augen der Philosophen den Status einer eigenständigen Realität von grundlegender Bedeutung. Der Alltag von E. Husserl zeichnet sich durch die Einfachheit aus, das für ihn „Sichtbare“ zu verstehen. Alle Menschen gehen von einer natürlichen Einstellung aus, die Gegenstände und Phänomene, Dinge und Lebewesen, Faktoren sozialhistorischer Natur vereint. Basierend auf einer natürlichen Einstellung nimmt der Mensch die Welt als die einzig wahre Realität wahr. Das gesamte tägliche Leben der Menschen basiert auf einer natürlichen Einstellung. Die Lebenswelt ist unmittelbar gegeben. Dies ist ein Bereich, der allen bekannt ist. Die Lebenswelt bezieht sich immer auf das Subjekt. Das ist seine eigene Alltagswelt. Es ist subjektiv und wird in Form praktischer Ziele, Lebenspraxis dargestellt.
M. Heidegger leistete einen großen Beitrag zur Erforschung der Probleme des Alltags. Er trennt bereits kategorisch das wissenschaftliche Sein vom Alltag. Der Alltag ist ein außerwissenschaftlicher Raum seiner eigenen Existenz. Der Alltag eines Menschen ist voller Sorgen darüber, sich in der Welt als Lebewesen und nicht als denkendes Wesen zu reproduzieren. Die Welt des Alltags erfordert die unermüdliche Wiederholung der notwendigen Sorgen (M. Heidegger nannte es eine unwürdige Existenzebene), die die schöpferischen Impulse des Einzelnen unterdrücken. Heideggers Alltag wird in Form der folgenden Modi dargestellt: „Geschwätz“, „Mehrdeutigkeit“, „Neugier“, „beschäftigte Dispensation“ usw. So wird beispielsweise „Geschwätz“ in Form leerer, grundloser Rede dargestellt. Diese Modi sind weit davon entfernt, echt menschlich zu sein, und daher hat das Alltagsleben einen etwas negativen Charakter, und die Alltagswelt als Ganzes erscheint als eine Welt der Unechtheit, der Grundlosigkeit, des Verlusts und der Öffentlichkeit. Heidegger stellt fest, dass der Mensch ständig von der Beschäftigung mit der Gegenwart begleitet wird, die das menschliche Leben in ängstliche Pflichten, in das vegetative Leben des Alltags verwandelt. Diese Fürsorge ist auf die Gegenstände gerichtet, auf die Veränderung der Welt. Nach M. Heidegger versucht der Mensch, seine Freiheit aufzugeben, wie alles zu werden, was zur Mittelung der Individualität führt. Der Mensch gehört nicht mehr zu sich selbst, andere haben ihm sein Dasein genommen. Doch trotz dieser negativen Aspekte des Alltags strebt ein Mensch ständig danach, in bar zu bleiben, um dem Tod zu entgehen. Er weigert sich, den Tod in seinem täglichen Leben zu sehen, und schützt sich durch das Leben selbst davor.
Dieser Ansatz wird von Pragmatikern (C. Pierce, W. James) verschärft und weiterentwickelt, nach denen Bewusstsein die Erfahrung eines Menschen in der Welt ist. Die meisten praktischen Angelegenheiten der Menschen zielen darauf ab, persönliche Vorteile zu erzielen. Nach W. James drückt sich der Alltag in den Elementen der Lebenspragmatik des Einzelnen aus.
Im Instrumentalismus von D. Dewey ist der Begriff von Erfahrung, Natur und Existenz alles andere als idyllisch. Die Welt ist instabil und die Existenz ist riskant und instabil. Die Handlungen von Lebewesen sind unvorhersehbar und daher wird von jedem Menschen ein Höchstmaß an Verantwortung und Einsatz geistiger und intellektueller Kräfte verlangt.
Die Psychoanalyse schenkt auch den Problemen des Alltags ausreichend Aufmerksamkeit. So schreibt Z. Freud über die Neurosen des Alltags, also die Faktoren, die sie verursachen. Durch gesellschaftliche Normen unterdrückte Sexualität und Aggression führen zu Neurosen, die sich im Alltag in Form von Zwangshandlungen, Ritualen, Versprechern, Versprechern und Träumen äußern, die nur für den Menschen selbst verständlich sind. Z. Freud nannte dies „die Psychopathologie des Alltags“. Je stärker ein Mensch gezwungen ist, seine Wünsche zu unterdrücken, desto mehr Schutztechniken nutzt er im Alltag. Freud betrachtet Verdrängung, Projektion, Substitution, Rationalisierung, reaktive Bildung, Regression, Sublimierung und Verleugnung als die Mittel, mit denen nervöse Spannungen gelöscht werden können. Laut Freud hat Kultur einem Menschen viel gegeben, ihm aber das Wichtigste genommen – die Fähigkeit, seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Laut A. Adler ist das Leben ohne kontinuierliche Bewegung in Richtung Wachstum und Entwicklung nicht vorstellbar. Der Lebensstil einer Person umfasst eine einzigartige Kombination von Merkmalen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die zusammengenommen ein einzigartiges Bild der Existenz einer Person ergeben. Aus Adlers Sicht ist der Lebensstil im Alter von vier bis fünf Jahren fest verankert und lässt sich anschließend kaum noch völlig ändern. Dieser Stil wird in Zukunft zum Hauptkern des Verhaltens. Es hängt von ihm ab, auf welche Aspekte des Lebens wir achten und welche wir ignorieren. Letztendlich ist nur der Mensch selbst für seinen Lebensstil verantwortlich.
Im Rahmen der Postmoderne wurde gezeigt, dass das Leben eines modernen Menschen nicht stabiler und zuverlässiger geworden ist. In dieser Zeit wurde besonders deutlich, dass menschliches Handeln nicht so sehr auf der Grundlage des Zweckmäßigkeitsprinzips, sondern auf der Zufälligkeit zweckmäßiger Reaktionen im Kontext konkreter Veränderungen erfolgt. Im Rahmen der Postmoderne (J.-F. Lyotard, J. Baudrillard, J. Bataille) wird die Meinung vertreten, dass es legitim sei, den Alltag aus jeder Position zu betrachten, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Der Alltag ist nicht Gegenstand der philosophischen Analyse dieser Richtung und erfasst nur bestimmte Momente der menschlichen Existenz. Der mosaikartige Charakter des Bildes des Alltagslebens in der Postmoderne zeugt von der Gleichwertigkeit der unterschiedlichsten Phänomene der menschlichen Existenz. Das menschliche Verhalten wird maßgeblich durch die Funktion des Konsums bestimmt. Dabei sind nicht die menschlichen Bedürfnisse die Grundlage für die Produktion von Gütern, sondern im Gegenteil, die Produktions- und Konsummaschine produziert Bedürfnisse. Außerhalb des Austausch- und Konsumsystems gibt es weder ein Subjekt noch Objekte. Die Sprache der Dinge klassifiziert die Welt, noch bevor sie in gewöhnlicher Sprache dargestellt wird, die Paradigmisierung von Objekten legt das Paradigma der Kommunikation fest, die Interaktion auf dem Markt dient als Grundmatrix der sprachlichen Interaktion. Es gibt keine individuellen Bedürfnisse und Wünsche, Wünsche werden produziert. Allzugänglichkeit und Freizügigkeit trüben die Empfindungen, und ein Mensch kann Ideale, Werte usw. nur reproduzieren und so tun, als ob dies noch nicht geschehen wäre.
Allerdings gibt es auch Positives. Ein postmoderner Mensch ist auf Kommunikation und Zielsetzung ausgerichtet, das heißt, die Hauptaufgabe eines postmodernen Menschen, der sich in einer chaotischen, unangemessenen, manchmal gefährlichen Welt befindet, ist das Bedürfnis, sich um jeden Preis zu offenbaren.
Existenzialisten glauben, dass Probleme im Laufe des täglichen Lebens jedes Einzelnen entstehen. Der Alltag ist nicht nur ein „gerändeltes“ Dasein mit sich wiederholenden stereotypen Ritualen, sondern auch Schocks, Enttäuschungen, Leidenschaften. Sie existieren in der Alltagswelt. Tod, Scham, Angst, Liebe, Sinnsuche sind als wichtigste existenzielle Probleme auch Probleme der Existenz des Einzelnen. Unter Existentialisten ist die pessimistische Sicht auf den Alltag am weitesten verbreitet.
So vertrat J.P. Sartre die Idee der absoluten Freiheit und der absoluten Einsamkeit eines Menschen unter anderen Menschen. Er glaubt, dass es der Mensch ist, der für das grundlegende Projekt seines Lebens verantwortlich ist. Jedes Scheitern und Scheitern ist eine Folge eines frei gewählten Weges, und die Suche nach Schuldigen ist vergeblich. Selbst wenn sich ein Mann in einem Krieg befindet, gehört dieser Krieg ihm, da er ihn durch Selbstmord oder Desertion hätte vermeiden können.
A. Camus verleiht dem Alltag folgende Eigenschaften: Absurdität, Sinnlosigkeit, Unglaube an Gott und individuelle Unsterblichkeit, während er dem Menschen selbst eine enorme Verantwortung für sein Leben auferlegt.
Eine optimistischere Sichtweise vertraten E. Fromm, der dem menschlichen Leben einen unbedingten Sinn verlieh, A. Schweitzer und X. Ortega y Gasset, die schrieben, dass das Leben kosmischer Altruismus sei, es als ständige Bewegung vom vitalen Selbst zum Anderen existiere. Diese Philosophen predigten Bewunderung und Liebe zum Leben, Altruismus als Lebensprinzip und betonten die hellsten Seiten der menschlichen Natur. E. Fromm spricht auch von zwei Hauptformen der menschlichen Existenz – Besitz und Sein. Das Besitzprinzip ist ein Rahmen für die Beherrschung materieller Objekte, Menschen, des eigenen Selbst, von Ideen und Gewohnheiten. Sein steht im Gegensatz zum Besitz und bedeutet echte Einbindung in das Bestehende und die Verwirklichung aller eigenen Fähigkeiten in der Realität.
Die Umsetzung der Seins- und Besitzprinzipien wird anhand von Alltagsbeispielen beobachtet: Gespräche, Erinnerung, Macht, Glaube, Liebe usw. Anzeichen von Besitz sind Trägheit, Stereotypisierung, Oberflächlichkeit. E. Fromm bezieht sich auf die Anzeichen von Aktivität, Kreativität und Interesse. Die besitzergreifende Denkweise ist charakteristischer für die moderne Welt. Dies ist auf das Vorhandensein von Privateigentum zurückzuführen. Die Existenz kann nicht außerhalb von Kampf und Leiden erdacht werden, und ein Mensch verwirklicht sich selbst nie auf vollkommene Weise.
Der führende Vertreter der Hermeneutik, G. G. Gadamer, legt großen Wert auf die Lebenserfahrung eines Menschen. Er glaubt, dass der natürliche Wunsch der Eltern darin besteht, ihre Erfahrungen an die Kinder weiterzugeben, in der Hoffnung, sie vor ihren eigenen Fehlern zu schützen. Lebenserfahrung ist jedoch die Erfahrung, die sich ein Mensch selbst aneignen muss. Wir erfinden ständig neue Erfahrungen, indem wir alte Erfahrungen widerlegen, denn es sind vor allem schmerzhafte und unangenehme Erfahrungen, die unseren Erwartungen widersprechen. Dennoch bereitet wahre Erfahrung einen Menschen darauf vor, seine eigenen Grenzen, also die Grenzen der menschlichen Existenz, zu erkennen. Die Überzeugung, dass alles neu gemacht werden kann, dass es für alles seine Zeit gibt und dass sich alles auf die eine oder andere Weise wiederholt, erweist sich als bloßer Schein. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Ein lebender und handelnder Mensch wird durch die Geschichte aus eigener Erfahrung ständig davon überzeugt, dass sich nichts wiederholt. Alle Erwartungen und Pläne endlicher Wesen sind selbst endlich und begrenzt. Echte Erfahrung ist also die Erfahrung der eigenen Geschichtlichkeit.
Die historische und philosophische Analyse des Alltagslebens lässt folgende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Entwicklung von Alltagsproblemen zu. Erstens wird das Problem des Alltags recht klar gestellt, aber eine Vielzahl von Definitionen geben keinen ganzheitlichen Überblick über das Wesen dieses Phänomens.
Zweitens betonen die meisten Philosophen die negativen Aspekte des Alltags. Drittens beziehen sich die Untersuchungen des Alltagslebens im Rahmen der modernen Wissenschaft und im Einklang mit Disziplinen wie Soziologie, Psychologie, Anthropologie, Geschichte usw. in erster Linie auf seine angewandten Aspekte, während sein wesentlicher Inhalt für die meisten Forscher außer Sichtweite bleibt .
Es ist der sozialphilosophische Ansatz, der es ermöglicht, die historische Analyse des Alltagslebens zu systematisieren, sein Wesen, seinen systemstrukturellen Inhalt und seine Integrität zu bestimmen. Wir stellen sofort fest, dass alle Grundkonzepte, die das alltägliche Leben, seine Grundprinzipien auf die eine oder andere Weise in der einen oder anderen Form offenbaren, in unterschiedlichen Versionen und in unterschiedlicher Form in der historischen Analyse präsent sind. Wir haben im historischen Teil lediglich versucht, das Wesentliche, Sinnvolle und Integrale des Alltagslebens zu betrachten. Ohne auf die Analyse einer so komplexen Formation wie des Lebensbegriffs einzugehen, betonen wir, dass der Appell an ihn als Ausgangsbegriff nicht nur von philosophischen Richtungen wie Pragmatismus, Lebensphilosophie, fundamentaler Ontologie, sondern auch von der Semantik der Worte des Alltagslebens selbst diktiert wird: für alle Tage des Lebens mit seinen ewigen und zeitlichen Merkmalen.
Es lassen sich die Hauptbereiche des Lebens eines Menschen herausgreifen: seine berufliche Tätigkeit, Aktivitäten im Rahmen des Alltagslebens und der Bereich der Erholung (leider oft nur als Inaktivität verstanden). Offensichtlich ist die Essenz des Lebens Bewegung, Aktivität. Es sind alle Merkmale sozialer und individueller Aktivität in einem dialektischen Verhältnis, die das Wesen des Alltagslebens bestimmen. Es ist jedoch klar, dass das Tempo und die Art der Aktivität, ihre Wirksamkeit, ihr Erfolg oder Misserfolg von Neigungen, Fähigkeiten und vor allem Fähigkeiten bestimmt werden (der Alltag eines Künstlers, Dichters, Wissenschaftlers, Musikers usw. ist sehr unterschiedlich).
Betrachtet man Aktivität als grundlegendes Wesensmerkmal unter dem Gesichtspunkt der Selbstbewegung der Realität, so handelt es sich in jedem konkreten Fall um ein relativ unabhängiges System, das auf der Grundlage von Selbstregulierung und Selbstverwaltung funktioniert. Dies setzt aber natürlich nicht nur die Existenz von Aktivitätsmethoden (Fähigkeiten) voraus, sondern auch die Notwendigkeit von Bewegungs- und Aktivitätsquellen. Diese Quellen werden am häufigsten (und hauptsächlich) durch Widersprüche zwischen dem Subjekt und dem Gegenstand der Aktivität bestimmt. Das Subjekt kann auch als Objekt einer bestimmten Aktivität fungieren. Dieser Widerspruch läuft darauf hinaus, dass das Subjekt versucht, das Objekt oder einen Teil davon zu beherrschen, das es benötigt. Diese Widersprüche werden als Bedürfnisse definiert: das Bedürfnis eines Einzelnen, einer Gruppe von Menschen oder der Gesellschaft als Ganzes. Es sind die Bedürfnisse in verschiedenen veränderten, transformierten Formen (Interessen, Motive, Ziele usw.), die das Subjekt in die Tat umsetzen. Selbstorganisation und Selbstmanagement der Aktivität des Systems setzen bei Bedarf ein ausreichend entwickeltes Verständnis, Bewusstsein, angemessenes Wissen (d. h. das Vorhandensein von Bewusstsein und Selbstbewusstsein) über die Aktivität selbst sowie über Fähigkeiten und Bedürfnisse sowie Bewusstsein über Bewusstsein und Selbstbewusstsein selbst voraus. All dies wird in angemessene und bestimmte Ziele umgewandelt, organisiert die notwendigen Mittel und ermöglicht es dem Subjekt, die entsprechenden Ergebnisse vorherzusehen.
All dies ermöglicht es uns, den Alltag aus diesen vier Positionen (Aktivität, Bedürfnis, Bewusstsein, Fähigkeit) zu betrachten: Der bestimmende Bereich des Alltags ist die berufliche Tätigkeit; menschliche Aktivität unter häuslichen Bedingungen; Erholung als eine Art Tätigkeitsbereich, in dem diese vier Elemente frei, spontan, intuitiv außerhalb rein praktischer Interessen, mühelos (basierend auf Spielaktivitäten), beweglich kombiniert werden.
Wir können eine Schlussfolgerung ziehen. Aus der bisherigen Analyse folgt, dass der Alltag auf der Grundlage des Lebensbegriffs definiert werden muss, dessen Wesen (einschließlich des Alltags) in der Aktivität verborgen ist und dessen Inhalt (für alle Tage!) in einer detaillierten Analyse der Besonderheiten der sozialen und individuellen Merkmale der identifizierten vier Elemente offenbart wird. Die Integrität des Alltagslebens verbirgt sich einerseits in der Harmonisierung aller seiner Bereiche (berufliche Tätigkeit, Aktivitäten im Alltag und Freizeit) und andererseits innerhalb jedes einzelnen Bereichs auf der Grundlage der Originalität der vier identifizierten Elemente. Und schließlich stellen wir fest, dass alle diese vier Elemente identifiziert, herausgegriffen und bereits in der historisch-sozialphilosophischen Analyse vorhanden sind. Die Kategorie des Lebens ist bei Vertretern der Lebensphilosophie präsent (M. Montaigne, A. Schopenhauer, V. Dilthey, E. Husserl); das Konzept der „Aktivität“ ist in den Strömungen des Pragmatismus, des Instrumentalismus (von C. Pierce, W. James, D. Dewey) präsent; der Begriff „Bedürfnis“ dominiert bei K. Marx, Z. Freud, Postmodernisten usw.; V. Dilthey, G. Simmel, K. Marx und andere beziehen sich auf den Begriff „Fähigkeit“, und schließlich finden wir Bewusstsein als synthetisierendes Organ bei K. Marx, E. Husserl, Vertretern des Pragmatismus und Existentialismus.
Somit ist es dieser Ansatz, der es uns ermöglicht, das Phänomen des Alltags als sozialphilosophische Kategorie zu definieren, um das Wesen, den Inhalt und die Integrität dieses Phänomens aufzudecken.
Simmel, G. Ausgewählte Werke. - M., 2006.
Sartre, J.P. Existenzialismus ist Humanismus // Götterdämmerung / Hrsg. A. A. Jakowlewa. - M., 1990.
Camus, A. Ein rebellischer Mann / A. Camus // Ein rebellischer Mann. Philosophie. Politik. Kunst. - M., 1990.
Aufgabe 25. In O. Balzacs Erzählung „Gobsek“ (geschrieben 1830, letzte Ausgabe – 1835) legt der Held, ein unglaublich reicher Wucherer, seine Lebensauffassung dar:
„Was in Europa Freude macht, wird in Asien bestraft. Was in Paris als Laster gilt, wird außerhalb der Azoren als Notwendigkeit anerkannt. Auf der Erde gibt es nichts Dauerhaftes, es gibt nur Konventionen, und die sind in jedem Klima anders. Für jemanden, der wohl oder übel alle gesellschaftlichen Standards anwendete, Alle Ihre moralischen Regeln und Überzeugungen sind leere Worte. Nur ein einziges Gefühl, das von der Natur selbst in uns verankert ist, ist unerschütterlich: der Selbsterhaltungstrieb ... Hier, lebe mit mir, das wirst du erfahren Von allen irdischen Segnungen gibt es nur einen, der zuverlässig genug ist, um es für einen Menschen wert zu machen, ihm nachzujagen. Ist das Gold. Alle Kräfte der Menschheit sind im Gold konzentriert... Was die Moral betrifft, so ist der Mensch überall gleich: überall gibt es einen Kampf zwischen Arm und Reich, überall. Und es ist unvermeidlich. So Es ist besser, sich selbst zu drängen, als sich von anderen drängen zu lassen.“.
Unterstreichen Sie im Text die Sätze, die Ihrer Meinung nach Gobseks Persönlichkeit am deutlichsten charakterisieren.
Warum gibt der Autor seinem Helden wohl den Namen Gobsek, was „Leber“ bedeutet? Was könnte Ihrer Meinung nach dazu geführt haben? Schreiben Sie die wichtigsten Schlussfolgerungen auf.
Ein Mensch ohne Mitgefühl, ohne Vorstellungen von Güte, der dem Mitgefühl in seinem Wunsch nach Bereicherung fremd ist, wird „Leber“ genannt. Es ist schwer vorstellbar, was genau ihn dazu gemacht haben könnte. Ein Hinweis, vielleicht in den Worten von Gobseck selbst, dass der beste Lehrer eines Menschen das Unglück ist, nur hilft es einem Menschen, den Wert von Menschen und Geld zu erkennen. Schwierigkeiten, Unglücke seines eigenen Lebens und der Gesellschaft um Gobsek, in der Gold als das wichtigste Maß für alles und das größte Gut galt, machten Gobsek zu einer „Leber“.
Schreiben Sie auf der Grundlage Ihrer Schlussfolgerungen eine Kurzgeschichte – die Geschichte von Gobseks Leben (Kindheit und Jugend, Reisen, Begegnungen mit Menschen, historische Ereignisse, Quellen seines Reichtums usw.), die er selbst erzählt hat.
Ich wurde in der Familie eines armen Handwerkers in Paris geboren und habe meine Eltern sehr früh verloren. Als ich auf der Straße war, wollte ich eines: überleben. Alles kochte in meiner Seele, als ich die prächtigen Outfits der Aristokraten sah, vergoldete Kutschen, die über die Bürgersteige rasten und einen zwangen, sich an die Wand zu drücken, um nicht zerquetscht zu werden. Warum ist die Welt so ungerecht? Dann ... die Revolution, die Ideen von Freiheit und Gleichheit, die allen den Kopf verdrehten. Unnötig zu erwähnen, dass ich mich den Jakobinern angeschlossen habe. Und mit welcher Freude empfing ich Napoleon! Er machte die Nation stolz auf sich. Dann kam es zu einer Restauration und alles, wogegen man so lange gekämpft hatte, kehrte zurück. Und wieder regierte Gold die Welt. Sie erinnerten sich nicht mehr an Freiheit und Gleichheit, und ich ging nach Süden, nach Marseille ... Nach vielen Jahren der Entbehrungen, des Umherirrens und der Gefahren gelang es mir, reich zu werden und das Hauptprinzip des heutigen Lebens zu lernen – es ist besser, sich selbst zu vernichten, als von anderen vernichtet zu werden. Und hier bin ich in Paris, und diejenigen, deren Kutschen einst zurückschrecken mussten, kommen zu mir und bitten um Geld. Glaubst du, ich bin glücklich? Überhaupt nicht, es hat mich noch mehr in der Meinung bestärkt, dass das Wichtigste im Leben Gold ist, nur dass es Macht über die Menschen gibt.
Aufgabe 26. Hier sind Reproduktionen von zwei Gemälden. Beide Künstler schrieben hauptsächlich Werke zu Alltagsthemen. Betrachten Sie die Illustrationen und achten Sie auf die Zeit, in der sie erstellt wurden. Vergleichen Sie beide Werke. Gibt es Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Charaktere, in der Haltung der Autoren ihnen gegenüber? Vielleicht ist Ihnen etwas anderes aufgefallen? Notieren Sie die Ergebnisse Ihrer Beobachtungen in einem Notizbuch.
Allgemein: Dargestellt sind Alltagsszenen aus dem Leben des Dritten Standes. Wir sehen die Einstellung der Künstler zu ihren Charakteren und ihr Wissen über das Thema.
Sonstig: Chardin stellte in seinen Gemälden ruhige, intime Szenen voller Liebe, Licht und Frieden dar. In Mülle sehen wir endlose Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit und Resignation vor einem schwierigen Schicksal.
Aufgabe 27. Lesen Sie die Fragmente des literarischen Porträts des berühmten Schriftstellers des 19. Jahrhunderts. (Autor des Aufsatzes - K. Paustovsky). Im Text wird der Name des Autors durch den Buchstaben N ersetzt.
Über welchen Schriftsteller sprach K. Paustovsky? Als Antwort können Sie den Text von § 6 des Lehrbuchs verwenden, der literarische Porträts von Schriftstellern enthält. Unterstreichen Sie die Formulierungen im Text, anhand derer Sie aus Ihrer Sicht den Namen des Autors genau bestimmen können.
Die Geschichten und Gedichte von N, dem Kolonialkorrespondenten, der selbst unter Kugeln stand und mit den Soldaten sprach und die Gesellschaft der kolonialen Intelligenz nicht verachtete, waren für weite literarische Kreise verständlich und anschaulich.
Über den Alltag und die Arbeit in den Kolonien, über die Menschen dieser Welt – englische Beamte, Soldaten und Offiziere, die in der Ferne ein Imperium erschaffen von einheimischen Bauernhöfen und Städten, die unter dem gesegneten Himmel des alten England lagen, erzählte N.. Er und Schriftsteller, die ihm im Allgemeinen nahe standen, verherrlichten das Reich als eine große Mutter, die nicht müde wurde, immer neue Generationen ihrer Söhne in die fernen Meere zu schicken.
Kinder aus verschiedenen Ländern lesen die „Dschungelbücher“ dieses Schriftstellers. Sein Talent war unerschöpflich, seine Sprache präzise und reichhaltig, seine Romane voller Plausibilität. All diese Eigenschaften reichen aus, um ein Genie zu sein, um zur Menschheit zu gehören.
Über Joseph Rudyard Kipling.
Aufgabe 28. Der französische Künstler E. Delacroix unternahm ausgedehnte Reisen in die Länder des Ostens. Er war fasziniert von der Möglichkeit, lebendige exotische Szenen darzustellen, die die Fantasie anregten.
Überlegen Sie sich ein paar „orientalische“ Geschichten, von denen Sie glauben, dass sie für den Künstler von Interesse sein könnten. Schreiben Sie die Geschichten oder ihre Titel auf.
Der Tod des persischen Königs Darius, Shahsey-Wahsey unter den Schiiten mit Selbstfolter bis hin zur Blutung, Brautentführung, Pferderennen unter Nomadenvölkern, Falknerei, Jagd mit Geparden, bewaffnete Beduinen auf Kamelen.
Nennen Sie die auf S. 1 gezeigten Delacroix-Gemälde. 29-30.
1. „Algerische Frauen in ihren Gemächern“, 1834;
2. „Löwenjagd in Marokko“, 1854;
3. „Marokkaner sattelt ein Pferd“, 1855.
Versuchen Sie, Alben mit Reproduktionen der Werke dieses Künstlers zu finden. Vergleichen Sie die von Ihnen angegebenen Namen mit den echten. Schreiben Sie die Namen anderer Gemälde von Delacroix über den Osten auf, die Sie interessieren.
„Kleopatra und der Bauer“, 1834, „Massaker von Chios“, 1824, „Der Tod von Sardanapal“, 1827, „Duell der Giaur mit dem Pascha“, 1827, „Kampf der arabischen Pferde“, 1860, „Fanatiker von Tanger“, 1837-1838.
Aufgabe 29. Zeitgenossen betrachteten Daumiers Karikaturen zu Recht als Illustrationen von Balzacs Werken.
Betrachten Sie einige dieser Werke: „The Little Clerk“, „Robert Maker – Stock Player“, „The Legislative Womb“, „Moonlight Action“, „Representatives of Justice“, „The Lawyer“.
Machen Sie Bildunterschriften unter den Bildern (verwenden Sie dazu Zitate aus Balzacs Text). Schreiben Sie die Namen der Charaktere und die Titel der Werke von Balzac auf, deren Illustrationen die Werke von Daumier sein könnten.

Aufgabe 30. Künstler verschiedener Epochen wandten sich manchmal dem gleichen Thema zu, interpretierten es jedoch unterschiedlich.
Betrachten Sie im Lehrbuch der 7. Klasse Reproduktionen des berühmten Gemäldes von David „Der Eid der Horatier“, das im Zeitalter der Aufklärung entstanden ist. Könnte diese Geschichte Ihrer Meinung nach für einen romantischen Künstler, der in den 1930er und 1940er Jahren lebte, von Interesse sein? 19. Jahrhundert? Wie würde das Stück aussehen? Beschreibe es.
Die Handlung könnte für Romantiker interessant sein. Sie strebten danach, Helden in den Momenten höchster Spannung geistiger und körperlicher Kräfte darzustellen, in denen die innere geistige Welt eines Menschen freigelegt wird und sein Wesen zeigt. Das Produkt könnte gleich aussehen. Sie können die Kostüme austauschen und sie so näher an die Gegenwart bringen.
Aufgabe 31. Ende der 60er Jahre. 19. Jahrhundert Impressionisten drangen in das künstlerische Leben Europas ein und verteidigten neue Ansichten über die Kunst.
Im Buch von L. Volynsky „Der grüne Baum des Lebens“ gibt es eine Kurzgeschichte darüber, wie einst K. Monet, wie immer im Freien, ein Bild malte. Für einen Moment versteckte sich die Sonne hinter einer Wolke und der Künstler hörte auf zu arbeiten. In diesem Moment fand ihn G. Courbet und fragte sich, warum er nicht arbeitete. „Ich warte auf die Sonne“, antwortete Monet. „Sie könnten vorerst eine Hintergrundlandschaft malen“, zuckte Courbet mit den Schultern.
Was glauben Sie, was der Impressionist Monet ihm geantwortet hat? Schreiben Sie die möglichen Antworten auf.
1. Monets Gemälde sind von Licht durchdrungen, sie sind hell, funkelnd, fröhlich – „Für den Raum braucht man Licht.“
2. Warte wahrscheinlich auf Inspiration – „Ich habe nicht genug Licht.“
Vor Ihnen liegen zwei Frauenporträts. Achten Sie bei der Betrachtung auf die Komposition der Arbeit, die Details und die Merkmale des Bildes. Tragen Sie unter den Abbildungen das Entstehungsdatum der Werke ein: 1779 oder 1871.

Welche Merkmale der Porträts, die Ihnen aufgefallen sind, haben es Ihnen ermöglicht, diese Aufgabe richtig zu lösen?
Nach Kleidung und Schreibstil. „Porträt der Herzogin von Beaufort“ Gainsborough – 1779 „Porträt von Jeanne Samary“ Renoir – 1871 Gainsboroughs Porträts wurden hauptsächlich auf Bestellung angefertigt. Auf raffinierte Weise wurden kalt distanzierte Aristokraten dargestellt. Renoir hingegen porträtierte gewöhnliche französische Frauen, jung, fröhlich und spontan, voller Leben und Charme. Auch die Maltechnik ist unterschiedlich.
Aufgabe 32. Die Entdeckungen der Impressionisten ebneten den Weg für die Postimpressionisten – Maler, die versuchten, ihre eigene einzigartige Vision der Welt mit maximaler Ausdruckskraft einzufangen.
Paul Gauguins Gemälde „Tahitian Pastorals“ schuf der Künstler 1893 während seines Aufenthalts in Polynesien. Versuchen Sie, eine Geschichte über den Inhalt des Bildes zu schreiben (was auf der Leinwand passiert, wie Gauguin sich auf die auf der Leinwand festgehaltene Welt bezieht).
Gauguin betrachtete die Zivilisation als eine Krankheit, zog es zu exotischen Orten und versuchte, mit der Natur zu verschmelzen. Dies spiegelte sich in seinen Gemälden wider, die das Leben der Polynesier schlicht und maßvoll darstellten. Betont die Einfachheit und Art des Schreibens. Auf flächigen Leinwänden wurden statische und farblich kontrastierende Kompositionen dargestellt, zutiefst emotional und zugleich dekorativ.
Untersuchen und vergleichen Sie zwei Stillleben. Jedes Werk erzählt von der Zeit seiner Entstehung. Haben diese Werke etwas gemeinsam?
Die Stillleben zeigen einfache Alltagsdinge und unprätentiöse Früchte. Beide Stillleben zeichnen sich durch die Einfachheit und Prägnanz der Komposition aus.
Haben Sie einen Unterschied im Bild der Objekte bemerkt? In was steckt sie?
Klas gibt Objekte detailliert wieder, behält Perspektive und Hell-Dunkel strikt bei und verwendet sanfte Töne. Cezanne präsentiert uns ein Bild wie aus verschiedenen Blickwinkeln, mit klaren Umrissen, um das Volumen des Motivs hervorzuheben, und leuchtenden, gesättigten Farben. Die zerknitterte Tischdecke sieht nicht so weich aus wie die von Klas, sondern fungiert eher als Hintergrund und schärft die Komposition.
Überlegen Sie sich ein imaginäres Gespräch zwischen dem niederländischen Künstler P. Klas und dem französischen Maler P. Cezanne und schreiben Sie es auf, in dem sie über ihre Stillleben sprechen. Wofür würden sie sich gegenseitig loben? Was würden diese beiden Meister des Stilllebens kritisieren?
K.: „Ich habe Licht, Luft und einen einzigen Ton verwendet, um die Einheit der objektiven Welt und der Umwelt auszudrücken.“
S.: „Meine Methode ist Hass auf ein fantastisches Bild. Ich schreibe nur die Wahrheit und möchte Paris mit einer Karotte und einem Apfel treffen.
K.: „Es scheint mir, dass Sie nicht detailliert genug sind und Objekte falsch darstellen.“
S.: „Ein Künstler sollte nicht zu gewissenhaft, nicht zu aufrichtig oder zu sehr von der Natur abhängig sein; Der Künstler ist mehr oder weniger Herr seines Modells und vor allem seiner Ausdrucksmittel.
K.: „Aber deine Arbeit mit Farbe gefällt mir, ich halte sie auch für das wichtigste Element der Malerei.“
S.: „Farbe ist der Punkt, an dem unser Gehirn das Universum berührt.“
*Notiz. Bei der Zusammenstellung des Dialogs wurden Cezanne-Zitate verwendet.