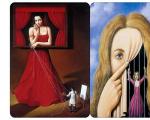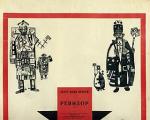Was ist eine Metapher in der russischen Herrschaft? Metaphern in der Literatur sind ein versteckter Vergleich
Das Konzept der „Metapher“ und Ansätze zu seiner Untersuchung
Metapherdefinition
Die gebräuchlichste Definition von Metaphern in der Linguistik lautet wie folgt: „Metapher (metaphorisches Modell) ist der Vergleich eines Phänomens mit einem anderen basierend auf der semantischen Nähe von Zuständen, Eigenschaften und Handlungen, die diese Phänomene charakterisieren, wodurch Wörter (Phrasen) entstehen.“ , Sätze), die einige Objekte (Situationen) der Realität bezeichnen sollen, werden verwendet, um andere Objekte (Situationen) auf der Grundlage der bedingten Identität der ihnen zugeschriebenen prädikativen Merkmale zu benennen“ [Glazunova, 2000, S. 177-178].
Bei der Verwendung einer Metapher interagieren zwei Gedanken (zwei Konzepte) über verschiedene Dinge innerhalb eines Wortes oder Ausdrucks miteinander, wobei die Bedeutung das Ergebnis dieser Interaktion ist.
An der Entstehung und damit auch an der Analyse einer Metapher sind vier Komponenten beteiligt:
- zwei Kategorien von Objekten;
- Eigenschaften zweier Kategorien;
Eine Metapher wählt die Merkmale einer Klasse von Objekten aus und wendet sie auf eine andere Klasse oder ein Individuum an – das eigentliche Subjekt der Metapher. Durch die Interaktion mit zwei verschiedenen Klassen von Objekten und deren Eigenschaften entsteht das Hauptmerkmal der Metapher – ihre Dualität.
Eine lebendige Metapher zum Zeitpunkt ihrer Entstehung und ihres Verständnisses setzt das Zusammenspiel zweier Bezeichnungen voraus, desjenigen, mit dem etwas verglichen wird, und desjenigen, mit dem es verglichen wird, und der Name des letzteren wird zum Namen des ersten und erhält eine metaphorische Bedeutung. Sprachmetaphern sind ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung der Sprache. Sie liegt vielen sprachlichen Prozessen zugrunde, wie der Entwicklung synonymer Mittel, der Entstehung neuer Bedeutungen und ihrer Nuancen, der Entstehung von Polysemie und der Entwicklung eines emotional ausdrucksstarken Vokabulars. Durch die Einbeziehung einer Metapher können Sie eine Darstellung der inneren Welt einer Person verbalisieren.
R. Hoffman schrieb: „Metaphern können als Beschreibungs- und Erklärungsinstrument in jedem Bereich eingesetzt werden: in psychotherapeutischen Gesprächen und in Gesprächen zwischen Flugzeugpiloten, in rituellen Tänzen und in der Programmiersprache, in der künstlerischen Ausbildung und in der Quantenmechanik.“ Metaphern, wo auch immer wir ihnen begegnen, bereichern immer das Verständnis menschlicher Handlungen, Kenntnisse und Sprache.
Der englische Wissenschaftler E. Ortoni identifizierte drei Hauptgründe für die Verwendung von Metaphern im Alltag:
- Sie helfen uns, prägnant zu sprechen.
- Sie machen unsere Rede hell.
- Sie erlauben es, das Unaussprechliche auszudrücken [Ortoni, 1990, S.215].
Wir verwenden oft Metaphern, weil sie schnell, prägnant, präzise und für jeden verständlich sind.
Klassifizierung von Metaphern
Laut N.D. Arutyunova lassen sich folgende Arten sprachlicher Metaphern unterscheiden:
1) Nominativ Metapher (Namensübertragung), die darin besteht, eine Bedeutung durch eine andere zu ersetzen;
2) bildlich eine Metapher, die durch den Übergang einer identifizierenden Bedeutung in eine prädikatische Bedeutung entsteht und der Entwicklung figurativer Bedeutungen und synonymer Mittel der Sprache dient;
3) kognitiv eine Metapher, die aus einer Verschiebung in der Kombination prädikativer Wörter resultiert und Polysemie erzeugt;
4) verallgemeinernd eine Metapher, die die Grenzen zwischen logischen Ordnungen in der lexikalischen Bedeutung des Wortes aufhebt und die Entstehung logischer Polysemie anregt [Arutyunova, 1998, S. 366].
Typologie der Metaphern M.V. Nikitin geht davon aus, dass die Ähnlichkeit von Zeichen in den Bezeichnungen, die als Grundlage für die Übertragung des Namens und die entsprechende metaphorische Umstrukturierung der direkten Bedeutung dienen, unterschiedlicher Natur sein kann. Wenn die Ähnlichkeit in den ähnlich verglichenen Dingen selbst enthalten ist, dann haben wir es mit zu tun ontologisch Metapher: gerade Und strukturell. Im Fall von gerade Metaphern, Zeichen haben die gleiche physische Natur („Bär“: 1. Tierart – ungeschickt 2. ungeschickter Mensch) und im Fall strukturell- Die Ähnlichkeit ist strukturell Charakter, das heißt, Zeichen spielen eine strukturelle Rolle in der Natur zweier Bedeutungen (vergleiche: Essen, Gäste empfangen, Informationen erhalten). In beiden Fällen ist die Ähnlichkeit der Merkmale bereits vor dem Vergleich vorhanden und offenbart sich erst in diesem. Wenn in den verglichenen Entitäten Anzeichen von Ähnlichkeit gefunden werden, diese jedoch ontologisch sowohl in der physischen Natur als auch in der strukturellen Rolle unterschiedlich sind und der Moment der Ähnlichkeit erst während der Wahrnehmung entsteht, sprechen wir davon Synästhesie Und emotional-bewertend Metaphern. Die Ähnlichkeit entsteht hier nicht durch die Ontologie der Dinge, sondern durch die Mechanismen der Informationsverarbeitung.
Ähnlichkeit ontologisch(direkte und strukturelle) Metaphern mit Synästhesie liegt darin, dass sie jeweils auf ihre eigene Weise aufgrund einer gewissen Ähnlichkeit danach streben, den Vergleichsgegenstand nach seinen eigenen Merkmalen dieses Gegenstandes zu bezeichnen und zu beschreiben. Sie sind dagegen emotional-bewertend eine Metapher, die den Wechsel von der kognitiven Ebene des Bewusstseins zur pragmatischen Ebene nahelegt [Nikitin, 2001, S. 37-38].
J. Lakoff und M. Johnson unterscheiden zwei Arten von Metaphern: ontologisch, das heißt Metaphern, die es Ihnen ermöglichen, Ereignisse, Handlungen, Emotionen, Ideen usw. als eine Art Substanz (der Geist ist eine Einheit, der Geist ist ein fragiles Ding) und orientiert zu sehen, oder Orientierung, das heißt, Metaphern, die einen Begriff nicht anhand eines anderen definieren, sondern das gesamte Konzeptsystem in Bezug zueinander organisieren (glücklich ist oben, traurig ist unten; bewusst ist oben, Unbewusst ist unten).
Grammatik kann auch ein Mittel zur Vermittlung metaphorischer Bedeutungen sein. Unter einer grammatischen Metapher wird in der Linguistik eine bewusste Übertragung kategorialer Merkmale einer grammatischen Kategorie in den Geltungsbereich einer anderen grammatischen Kategorie verstanden, um eine neue zusätzliche Bedeutung zu schaffen, die nicht mehr unbedingt grammatikalisch ist [Maslennikova, 2006, S.23].
Es gibt drei Möglichkeiten der grammatikalischen Metaphorisierung:
1) Der Kontrast zwischen der grammatikalischen Bedeutung der Form und dem Kontext;
2) Der Kontrast zwischen der grammatikalischen Bedeutung der Form und ihrem lexikalischen Inhalt;
3) Der Kontrast zwischen Vokabular und außersprachlicher Situation.
Beim Vergleich von lexikalischer und grammatikalischer Metapher fallen folgende Unterschiede auf: Die Metaphorisierung in der Grammatik ist durch eine geringe Anzahl von Gegensätzen und ein geschlossenes grammatikalisches System begrenzt, außerdem zeichnet sich die grammatikalische Metapher durch Unidirektionalität aus und nicht umgekehrt, obwohl das Gegenteil der Fall ist Fälle sind nicht ausgeschlossen.
Ansätze zum Studium der Metapher
Die Haltung gegenüber der Metapher war seit ihrer Einführung zweideutig. Die Metapher wurde aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, geleugnet und ihr Nebenrollen zugewiesen. Platon war mit der Verwendung figurativer Sprachmittel nicht einverstanden, Cicero empfand Metaphern als unnötige Erfindung. Diese ablehnende Haltung gegenüber Metaphern herrschte lange Zeit vor.
Aristoteles begann mit dem Studium der Metapher. Metaphorische Übertragungen galten für ihn als bedeutendes Sprachmittel, das sich positiv auf den Zuhörer auswirkte und die Argumentation stärkte. Aristoteles bezeichnete die Ähnlichkeit zweier Objekte als Grundlage der metaphorischen Übertragung und betrachtete sie als das Hauptmittel der Erkenntnis.
Metaphern sind nach F. Nietzsche die wirksamsten, natürlichsten, präzisesten und einfachsten Sprachmittel [Nietzsche, 1990, S.390].
In der klassischen Rhetorik wurde Metapher hauptsächlich als Abweichung von der Norm dargestellt – die Übertragung des Namens eines Objekts auf ein anderes. Der Zweck dieser Übertragung besteht entweder darin, das Fehlen eines Äquivalents für die lexikalische Einheit einer anderen Sprache im System einer Sprache auszufüllen (lexikalische Lücke) oder eine Art „Dekoration“ der Sprache.
Später verlagerte sich das Problem der Metapher von der Rhetorik auf die Linguistik. So entstand vergleichendes Metapherkonzept, in dem die Metapher als bildliche Neuinterpretation des üblichen Namens positioniert wurde. Die Metapher wurde als versteckter Vergleich dargestellt. Die Vergleichstheorie ging davon aus, dass eine metaphorische Äußerung den Vergleich von zwei oder mehr Objekten beinhaltet.
Der traditionelle (vergleichende) Standpunkt zur Metapher hob nur wenige Ansätze zur Methode der Metapherbildung hervor und beschränkte die Verwendung des Begriffs „Metapher“ auch nur auf einige der auftretenden Fälle. Dies zwingt uns dazu, Metaphern aufgrund von Wortersetzungen oder kontextuellen Verschiebungen nur als sprachliches Werkzeug zu betrachten, während die Grundlage der Metapher die Entlehnung von Ideen ist.
Laut M. Black gibt es zwei Gründe für die Verwendung metaphorischer Wörter: Der Autor greift auf eine Metapher zurück, wenn es unmöglich ist, ein direktes Äquivalent einer metaphorischen Bedeutung zu finden, oder wenn eine metaphorische Konstruktion aus rein stilistischen Gründen verwendet wird. Die metaphorische Übertragung vereint seiner Meinung nach die Einzigartigkeit der semantischen Bedeutung und des stilistischen Potenzials [Black, 1990, S. 156].
D. Davidson vertrat die Theorie, dass eine Metapher nur ihre direkte Wörterbuchbedeutung hat. Und es ist die Persönlichkeit des Interpreten, die die metaphorische Bedeutung des Bildes bestimmt [Davidson, 1990, S. 174].
Eine der populärsten Metaphertheorien ist die kognitive Theorie von J. Lakoff und M. Johnson. Ihrer Meinung nach basiert die Metaphorisierung auf dem Zusammenspiel zweier Wissensstrukturen: der „Quellen“-Struktur und der „Ziel“-Struktur. Der Quellbereich der kognitiven Theorie ist die menschliche Erfahrung. Zielgebiet ist weniger spezifisches Wissen, „Wissen per Definition“. Dieser Ansatz erwies sich als fruchtbar, da er es ermöglichte, eine Metapher nicht nur als sprachliches Phänomen, sondern auch als mentales Phänomen zu definieren.
Ein kognitiver Ansatz zum Studium der Metapher
In den späten 70er Jahren zeigte sich in der Linguistik Interesse an kognitiven Strukturen, die die Grundlage für Sprachkompetenz und Sprachumsetzung bilden. Eine neue Richtung ist aufgetaucht – die kognitive Linguistik, ein neuer Ansatz zur Erforschung natürlicher Sprache, bei dem Sprache als Werkzeug zur Organisation, Verarbeitung und Übertragung von Informationen und als eine Art menschliche Fähigkeit zum Wissen (zusammen mit anderen kognitiven Fähigkeiten) verstanden wird Fähigkeiten - Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Denken, Wahrnehmung). Die Semantik nimmt in diesem Bereich den Hauptplatz ein, der Hauptgegenstand ihrer Untersuchung ist die Bedeutung. Eines der wichtigsten theoretischen Probleme ist die Beziehung zwischen Semantik und Realität. Das Hauptinteresse kognitiver Linguisten konzentriert sich auf Phänomene wie Prototypizität, reguläre Polysemie, kognitive Modelle und Metapher als universelles kognitives Instrument. Die Metaphertheorie hat in der kognitiven Linguistik einen besonderen Platz eingenommen. In der modernen Linguistik gilt die Metapher als die wichtigste mentale Operation, als eine Möglichkeit, die Welt zu erkennen, zu kategorisieren, zu konzeptualisieren, zu bewerten und zu erklären. Solche Wissenschaftler, Forscher und Schriftsteller wie D. Vico, F. Nietzsche, A. Richards, J. Ortega y Gasset, E. McCormack, P. Riker, E. Cassirer, M. Black, M. Erickson und andere [Budaev, 2007 : 16].
Beim metaphorischen Umdenken im Verlauf des kognitiven Prozesses erforscht der Sprecher Teile seines Langzeitgedächtnisses, findet zwei (häufig logisch unvereinbare) Referenten, stellt eine sinnvolle Beziehung zwischen ihnen her und schafft so eine Metapher. Eine sinnvolle Beziehung wird auf der Grundlage der Entdeckung einer Reihe gemeinsamer Merkmale zweier Referenten hergestellt. Diese Merkmale spiegeln sich in der Struktur der lexikalischen Bedeutung wider.
Da die lexikalische Bedeutung eines Wortes heterogen ist, ist es von Interesse zu analysieren, welcher Teil der Bedeutung einem metaphorischen Umdenken unterliegt, welche semantischen Merkmale der Bildung einer neuen, metaphorischen Bedeutung zugrunde liegen. In der Struktur der lexikalischen Bedeutung eines Wortes lassen sich aus kognitiver Sicht zwei Teile unterscheiden: die Intension und die Implikation. Eine Intension ist eine Reihe semantischer Merkmale (Semes), die eine Denotation aufweisen muss, um in eine bestimmte Klasse aufgenommen zu werden. Das Implikational ist ebenfalls eine Menge semantischer Merkmale, allerdings eine Menge, die assoziativ aus der Intension gebildet wird. Beim metaphorischen Umdenken von Wörtern sind zunächst implizite Merkmale (intensionale nicht ausgenommen) an der Umstrukturierung der Semantik des Wortes beteiligt. Ein Teil dieser Zeichen bildet den Inhalt des Differentialteils der abgeleiteten metaphorischen Bedeutung [Nikitin, 2001, S. 36].
Das Wort hat keine endliche Liste von Bedeutungen, aber es gibt eine bestimmte Anfangsbedeutung des semantischen Ableitungsmodells, das eine bestimmte Anzahl von Bedeutungen erzeugt, die eine nicht endliche Anzahl erzeugter Bedeutungen erzeugen kann. Unterschiedliche Bedeutungen haben jedoch eine unterschiedliche Chance, wahr zu werden. Es gibt zwei Punkte, die die Möglichkeit bestimmen, die eine oder andere Bedeutung durch ein bestimmtes Wort zu erkennen. Dies sind: 1. die Notwendigkeit der Nominierung des entsprechenden Konzepts und 2. die Stärke, Helligkeit der assoziativen Verbindung zweier Konzepte (ursprünglich und bildlich bezeichnet). Die Kombination dieser Faktoren erhöht die Chance, einen abgeleiteten Wert zu realisieren. Eine objektive Beurteilung des metaphorischen Potenzials von Wörtern ist nur anhand der erfassten Fälle ihrer bildlichen Verwendung auf der Grundlage analoger Ähnlichkeit unter Berücksichtigung von Metaphern möglich. Letztendlich kommt es darauf an, kognitiv äquivalente Konzepte anhand der Art und Weise zu vergleichen, wie sie direkt oder bildlich ausgedrückt werden [Nikitin, 2001, S. 43-44].
Einen besonderen Platz in der Entwicklung der kognitiven Theorie nehmen J. Lakoff und M. Johnson ein. Darin wird die Metapher als Untersuchungsgegenstand in ein kognitiv-logisches Paradigma übersetzt und unter dem Gesichtspunkt ihrer Verbindung mit tiefen kognitiven Strukturen und dem Prozess der Kategorisierung der Welt untersucht. Sie entwickelten eine Theorie, die ein bestimmtes einführte System in die Beschreibung des kognitiven Mechanismus der Metapher ein und lieferte eine große Anzahl von Beispielen, die diese Theorie bestätigten. Die Kernidee von J. Lakoff und M. Johnson besteht darin, dass Metaphern als sprachliche Ausdrücke dadurch möglich werden, dass das menschliche Begriffssystem in seiner Grundlage metaphorisch ist. Das heißt, Phänomene einer Art im Hinblick auf Phänomene einer anderen Art zu verstehen und zu erleben, ist eine grundlegende Eigenschaft unseres Denkens. „Metapher durchdringt unser gesamtes tägliches Leben und manifestiert sich nicht nur in der Sprache, sondern auch im Denken und Handeln. Unser alltägliches konzeptuelles System, innerhalb dessen wir denken und handeln, ist seinem Wesen nach metaphorisch“ [Lakoff, 1990, S. 387]. Bei der Entwicklung seines Konzepts ging J. Lakoff davon aus, dass sich viele Aussagen zur Metapher als falsch erweisen:
- Jedes Thema kann ohne Metapher wörtlich genommen werden.
- Am häufigsten werden Metaphern in der Poesie verwendet.
- Metaphern sind nur sprachliche Ausdrücke.
- Metaphorische Ausdrücke sind grundsätzlich nicht wahr.
- Nur wörtliche Sprache kann wahr sein [Lakoff, 1990, S. 390].
In Anlehnung an die Sichtweise von J. Lakoff zur kognitiven Theorie der Metapher lässt sich ihr Hauptgedanke wie folgt ausdrücken: Die Grundlage des Metaphorisierungsprozesses ist die Interaktion zweier konzeptioneller Domänen – der Quelldomäne und der Zieldomäne. Durch die metaphorische Projektion von der Quellsphäre auf die Zielsphäre bilden die Elemente der Quellsphäre als Ergebnis der Erfahrung menschlicher Interaktion mit der Außenwelt eine weniger verständliche Zielsphäre, die die Essenz des kognitiven Potenzials darstellt der Metapher. Der Quellbereich ist konkreteres Wissen, das leichter von einer Person auf einen anderen übertragen werden kann, es basiert direkt auf der Erfahrung der menschlichen Interaktion mit der Realität, während der Zielbereich weniger konkretes, weniger eindeutiges Wissen ist. Die grundlegende Wissensquelle, die die konzeptionellen Bereiche ausmacht, ist die Erfahrung der menschlichen Interaktion mit der Außenwelt. Die stabilen Korrespondenzen zwischen der Quellsphäre und der Zielsphäre, die in der sprachlichen und kulturellen Tradition der Gesellschaft verankert sind, wurden „konzeptuelle Metaphern“ genannt.
In Anlehnung an J. Lakoff stellt E. Budaev fest, dass „die These, dass das Subjekt dazu neigt, nicht auf die Realität, sondern auf seine eigenen kognitiven Darstellungen der Realität zu reagieren, zu der Schlussfolgerung führt, dass menschliches Verhalten nicht so sehr von der objektiven Realität direkt bestimmt wird.“ wie durch das System der Vertretung Person. Daraus folgt, dass die Schlussfolgerungen, die wir auf der Grundlage des metaphorischen Denkens ziehen, die Grundlage für Handlungen bilden können“ [Budaev, 2007, S. 19].
Der Quellbereich ist unsere körperliche Erfahrung, kann aber auch gemeinsame kulturelle Werte beinhalten. Der Zielbereich ist das, worauf wir derzeit unsere Aufmerksamkeit richten, was wir zu verstehen versuchen.
Ein bekanntes Beispiel von J. Lakoff ist die Metapher ARGUMENT IS WAR, die das Verständnis eines Streits als Krieg darstellt. In der Alltagssprache wird diese Metapher in einer Reihe von Aussagen verwirklicht, in denen der Streit mit militärischen Begriffen bezeichnet wird:
Dein Ansprüche Sind unhaltbar.
Ihre Aussagen halten einer Überprüfung nicht stand (wörtlich: nicht zu rechtfertigen).
Streit und Krieg sind Phänomene unterschiedlicher Art, in denen jeweils unterschiedliche Handlungen ausgeführt werden. Ein Streit ist ein mündlicher Austausch von Bemerkungen, ein Krieg ist ein Konflikt, bei dem Waffen zum Einsatz kommen. Aber wir vergleichen den Streit anhand seiner Terminologie mit dem Krieg. Es ist wichtig zu beachten, dass wir in einer Argumentation nicht nur militärische Begriffe verwenden. Die Person, mit der wir streiten, stellen wir als Gegner dar, wir gewinnen oder verlieren in einem Streit. Wir rücken vor oder ziehen uns zurück, wir haben einen bestimmten Plan (Strategie). Ein Streit ist ein verbaler Kampf. Somit wird der Begriff metaphorisch geordnet, die entsprechende Aktivität wird metaphorisch geordnet und folglich wird auch die Sprache metaphorisch geordnet. Aber wenn wir, wie J. Lakoff vorschlägt, versuchen, uns eine andere Kultur vorzustellen, in der Streitigkeiten nicht im Sinne von Krieg, sondern beispielsweise im Sinne von Tanz interpretiert werden, dann werden Vertreter dieser Kultur Streitigkeiten anders betrachten, sie anders führen und Sprechen Sie anders über sie. So veranschaulicht J. Lakoff die Grundidee: „Das Wesen einer Metapher besteht darin, Phänomene einer Art im Hinblick auf Phänomene einer anderen Art zu begreifen und zu erleben.“
Wir reden auf diese Weise über einen Streit, weil wir so denken. Die metaphorische Übertragung ist nicht durch Sprachbarrieren begrenzt und kann nicht nur auf der verbalen, sondern auch auf der assoziativ-figurativen Ebene erfolgen. Daraus ergibt sich die wichtigste Schlussfolgerung: „Metapher beschränkt sich nicht nur auf die Sphäre der Sprache, das heißt auf die Sphäre der Wörter: Die eigentlichen Prozesse des menschlichen Denkens sind weitgehend metaphorisch“ [Lakoff, 1990, S. 23] .
In der Typologie amerikanischer Forscher lassen sich konzeptuelle Metaphern in zwei weitere Typen unterteilen: Orientierungsmetaphern Und ontologische Metaphern.
In ontologischen Metaphern ordnen wir ein Konzept in Bezug auf ein anderes, während Orientierungsmetaphern Gegensätze widerspiegeln, die unsere Erfahrung der räumlichen Orientierung in der Welt widerspiegeln und festlegen (Glücklich ist oben, traurig ist unten). Mit anderen Worten: Raum erweist sich als einer der Grundbegriffe für die Gestaltung und Bezeichnung einer anderen, nicht-räumlichen Erfahrung. In der Arbeit „Metaphors we live by“ gibt J. Lakoff Beispiele für die Modellierung verschiedener Arten von Erfahrungen als räumliche Konzepte, die die Grundlage von Orientierungsmetaphern bilden:
- GLÜCKLICH IST OBEN, TRAURIG IST UNTEN
Die physische Grundlage der Metapher HAPPY IS UP, SAD IS DOWN ist die Idee, dass eine Person in einem traurigen Zustand den Kopf senkt, während sie sich bei positiven Emotionen aufrichtet und den Kopf hebt.
ich fühle mich hoch. Er ist es wirklich niedrig heutzutage.
Das verstärkt meine Geister. ich fühle mich runter.
Wenn ich an sie denke, bekomme ich immer eine Aufzug. meine Geister versank.
Basierend auf dem sprachlichen Material ziehen Lakoff und Johnson die entsprechenden Schlussfolgerungen über die Grundlagen, Zusammenhänge und Systematik metaphorischer Konzepte:
- Die meisten unserer Grundkonzepte sind anhand einer oder mehrerer Orientierungsmetaphern organisiert.
- Jede räumliche Metapher hat eine innere Konsistenz.
- Unterschiedliche Orientierungsmetaphern werden von einem gemeinsamen System erfasst, das sie miteinander harmoniert.
- Orientierungsmetaphern haben ihre Wurzeln in der körperlichen und kulturellen Erfahrung und werden nicht zufällig angewendet.
- Metaphern können auf verschiedenen physischen und sozialen Phänomenen basieren.
- In manchen Fällen ist die Orientierung im Raum ein so wesentlicher Bestandteil des Konzepts, dass wir uns kaum eine andere Metapher vorstellen können, die das Konzept rationalisieren könnte.
- Sogenannte rein intellektuelle Konzepte basieren oft und möglicherweise immer auf Metaphern, die eine physische und/oder kulturelle Grundlage haben [Lakoff, 2004, S. 30-36].
Ontologische Metaphern hingegen unterteilen abstrakte Entitäten in bestimmte Kategorien, skizzieren ihre Grenzen im Raum oder personifizieren sie. „So wie die Daten menschlicher Erfahrung in der räumlichen Orientierung Orientierungsmetaphern hervorbringen, bilden die Daten unserer mit physischen Objekten verbundenen Erfahrung die Grundlage für eine kolossale Vielfalt ontologischer Metaphern, also Arten der Interpretation von Ereignissen, Handlungen, Emotionen, Ideen.“ , usw. als Objekte und Substanzen“ [Lakoff, 2004, S.250]. (Wir arbeiten daran Frieden. Die hässliche Seite seiner Persönlichkeit kommt unter Druck heraus. Ich kann nicht mithalten Tempo des modernen Lebens.)
J. Lakoff hebt auch die Leitungsmetapher hervor. Sein Wesen ist wie folgt: Der Sprecher setzt Ideen (Objekte) in Wörter (Gefäße) um und sendet sie (über einen Kommunikationskanal – Leitung) an den Zuhörer, der Ideen (Objekte) aus Wörtern (Gefäßen) extrahiert.
Die Sprache, die wir verwenden, wenn wir über die Sprache selbst sprechen, ist strukturell nach der folgenden zusammengesetzten Metapher geordnet:
IDEEN (ODER BEDEUTUNG) SIND OBJEKTE.
SPRACHLICHE AUSDRÜCKE SIND DER BEHÄLTER.
KOMMUNIKATION IST EINE ÜBERTRAGUNG (ABFAHRT).
Aus dem ersten Satz dieser Metapher – WERTE SIND OBJEKTE – folgt insbesondere, dass Bedeutungen unabhängig von Personen und Nutzungskontexten existieren.
Aus der zweiten Komponente der KOMMUNIKATIONSKANAL-Metapher – SPRACHAUSDRÜCKE SIND EIN RESERVOIR FÜR BEDEUTUNG – folgt, dass Wörter und Phrasen an sich eine Bedeutung haben – unabhängig vom Kontext oder vom Sprecher. Ein Beispiel für ein figuratives Schema von IDEEN – DIESE OBJEKTE können die folgenden Ausdrücke sein:
Es ist schwer, ihm eine Idee zu vermitteln.
Es fällt ihm schwer, (irgendeinen) Gedanken zu erklären.
Ich habe dich auf diese Idee gebracht.
Ich habe dir diese Idee gegeben.
Die von J. Lakoff und M. Johnson vorgeschlagene Theorie hat in der Wissenschaft breite Anerkennung gefunden und wird in vielen Schulen und Richtungen aktiv weiterentwickelt [Lakoff, 2008, S.65].
M. Johnson verwendet den Begriff figuratives Schema(oder Bildschema, Bildschema) für eine solche schematische Struktur, um die herum unsere Erfahrung organisiert ist. Sein Konzept eines figurativen Schemas geht auf Kants Konzept eines Schemas zurück, weicht jedoch von diesem ab. Johnson definiert ein figuratives Schema wie folgt: „Das figurative Schema ist ein wiederkehrendes dynamisches Muster (Muster) unserer Wahrnehmungsprozesse und unserer motorischen Programme, das unserer Erfahrung Kohärenz und Struktur verleiht“ [Chenki, 2002, S. 350]. Johnson behauptet nicht, dass es möglich sei, eine Liste aller Bildschemata zusammenzustellen, die in der Alltagserfahrung verwendet werden, er bietet jedoch eine unvollständige Liste von 27 Bildschemata an, um einen Eindruck von ihrer Vielfalt zu vermitteln. Im Allgemeinen zeichnen sich figurative Schemata durch folgende Eigenschaften aus:
- nicht propositional;
- sind nicht nur mit einer Form der Wahrnehmung verbunden;
- sind Teil unserer Erfahrung auf den Ebenen der Wahrnehmung, der Bildsprache und der Struktur von Ereignissen;
- gewährleistet die Kohärenz menschlicher Erfahrung durch verschiedene Arten der Erkenntnis, von der Ebene des Individuums bis zur Ebene sozialer Strukturen;
- sind Gestaltstrukturen (sie existieren als kohärente, bedeutungsvolle einheitliche Ganzheiten in unserer Erfahrung und Erkenntnis) [Chenki, 2002, S. 354].
Ein figuratives oder topologisches Schema ist ein typisches Modell (Muster), das auf die Beschreibung vieler Spracheinheiten gleichzeitig anwendbar ist. Allerdings kann nicht jedes Konzept aus solchen primären semantischen Schemata „zusammengesetzt“ werden, da jedes von ihnen die einfachsten Formen oder Bewegungen des menschlichen Körpers anspricht, die einem Muttersprachler vertraut und verständlich sind und die er daher leicht übertragen kann zur umgebenden Realität. Es gibt eine anthropozentrische „Bindung“ der wichtigsten „Bausteine“, Fragmente der semantischen Darstellung. Es basiert auf der Idee von Lakoff, die Embodiment (Verkörperung im menschlichen Körper) genannt wird und die Linguistik in die Zeit lokaler Theorien zurückführt: nicht nur mit einem Menschen verbunden, sondern nur mit seinen räumlichen Empfindungen und motorischen Reaktionen als primär anerkannt. Es gibt auch eine Reihe abstrakter Konzepte, die auf Bildschemata reduziert werden können: „Menge“, „Zeit“, „Raum“, „Ursache“ usw.; Diese Konzepte können wiederum anderen, abstrakteren oder umgekehrt objektiven Konzepten zugrunde liegen, jedoch in jedem Fall aufgrund der Tatsache, dass ihre allererste, anfängliche Semantisierung auf dem Übergang vom Konkreten zum Abstrakten basiert, und Darüber hinaus sind vom Raum bis zu allem anderen immer räumlich-motorische Bedeutungen im Vordergrund. Es ist dieser direkte Zusammenhang mit den einfachsten räumlichen „Primitiven“, der uns dazu veranlasst, den Begriff Bildschema nicht als figuratives Schema, sondern als topologisches Schema zu übersetzen. Diese Übersetzung betont erstens, dass allen kognitiven „Bildern“ figurative Schemata zugrunde liegen, und zweitens betont sie die lokalistische Idee [Rakhilina, 2000, S.6].
Zusammenfassend können wir die folgenden Schlussfolgerungen zur Interpretation von Metaphern in der kognitiven Linguistik ziehen. Metapher ist nicht nur ein Sprachwerkzeug, mit dem Sie Sprache verschönern und das Bild verständlicher machen können, sie ist eine Form des Denkens. Gemäß der kognitiven Herangehensweise an die Natur des menschlichen Denkens wird das konzeptionelle System eines Menschen durch seine körperliche Erfahrung bestimmt. Und das Denken ist figurativ, das heißt, um Konzepte darzustellen, die nicht durch Erfahrung bedingt sind, verwendet eine Person einen Vergleich, eine Metapher. Die Fähigkeit einer solchen Person, figurativ zu denken, bestimmt die Möglichkeit des abstrakten Denkens.
Bibliographische Liste
- Glasunowa O.I. Die Logik metaphorischer Transformationen. - St. Petersburg: Philologische Fakultät // Staatliche Universität, 2002. - S. 177-178.
- Hoffman R.R. Was könnten uns Reaktionszeitstudien über das Verständnis von Metaphern sagen? // Metapher und symbolische Aktivität, 1987. - S. 152.
- Ortoni E. Die Rolle der Ähnlichkeit bei Assimilation und Metapher // Theorie der Metapher / Otv. Hrsg. N.D. Arutyunov. - M.: Verlag "Progress", 1990. - S. 215.
- Arutyunova N.D. Sprache und die menschliche Welt. - M.: Sprachen der russischen Kultur, 1998. - S. 366.
- Nikitin M.B. Metaphorisches Potenzial des Wortes und seine Verwirklichung // Das Problem der Theorie der europäischen Sprachen / Ed. Hrsg. V.M. Arinstein, N.A. Abieva, L.B. Koptschuk. - St. Petersburg: Trigon Publishing House, 2001. - S. 37-38.
- Maslennikova A.A. Merkmale der grammatikalischen Metapher // Metaphern der Sprache und Metaphern in der Sprache / K.I. Varshavskaya, A.A. Maslennikova, E.S. Petrova und andere / Ed. EIN V. Zelenshchikova, A.A. Maslennikowa. St. Petersburg: Staatliche Universität St. Petersburg, 2006. - S. 23.
- Nietzsche F. Jenseits von Gut und Böse. Buch. 2. - Italienisch-sowjetischer Verlag SIRIN, 1990. - S. 390.
- Black M. Metapher // Theorie der Metapher / Otv. Hrsg. N.D. Arutyunov. - M.: Progress Publishing House, 1990. - S. 156.
- Davidson D. Was bedeuten Metaphern // Theorie der Metapher / Otv. Hrsg. N.D. Arutyunov. - M.: Progress Publishing House, 1990. - S.174.
- Budaev E.V. Bildung der kognitiven Theorie der Metapher // Lingvokultorologiya. - 2007. - Nr. 1. - S. 16.
- Nikitin M.V. Konzept und Metapher // Das Problem der Theorie der europäischen Sprachen / Ed. Hrsg. V.M. Arinstein, N.A. Abieva, L.B. Koptschuk. - St. Petersburg: Trigon Publishing House, 2001. - S.36.
- Nikitin M.B. Metaphorisches Potenzial des Wortes und seine Verwirklichung // Das Problem der Theorie der europäischen Sprachen / Ed. Hrsg. V.M. Arinstein, N.A. Abieva, L.B. Koptschuk. - St. Petersburg: Trigon Publishing House, 2001. - S. 43-44.
- Lakoff J. Metaphern, nach denen wir leben. - M.: Verlag LKI, 1990. - S. 387.
- Lakoff J. Metaphern, nach denen wir leben. - M.: Verlag LKI, 2008. - S. 390.
- Lakoff G. Die zeitgenössische Theorie der Metapher // Metapher und Denken / Ed. Von A. Ortony. – Cambridge, 1993. – S. 245.
- Budaev E.V. Bildung der kognitiven Theorie der Metapher // Lingvokultorologiya. - 2007. - Nr. 1. – S. 19.
- Lakoff G., Johnson M. Metaphern, nach denen wir leben. – Chicago, 1980. – S. 23.
- Lakoff J. Metaphern, nach denen wir leben. - M.: Verlag LKI, 1990. - S. 23.
- Lakoff J. Frauen, Feuer und gefährliche Dinge: Was uns die Kategorien der Sprache über das Denken sagen. - M.: Sprachen der slawischen Kultur, 2004. - S. 30 -36.
- Lakoff J. Frauen, Feuer und gefährliche Dinge: Was uns die Kategorien der Sprache über das Denken sagen. - M.: Sprachen der slawischen Kultur, 2004. - S. 250.
- Lakoff J. Metaphern, nach denen wir leben. - M.: Verlag LKI, 2008. - S. 65.
- Chenki A. Semantik in der kognitiven Linguistik // Moderne amerikanische Linguistik: Grundlegende Trends / Ed. Hrsg. A.A. Kibrik, I.M. Kobozeva, I.A. Sekerina. - M.: Verlag "Editorial", 2002. - S. 350.
- Chenki A. Semantik in der kognitiven Linguistik // Moderne amerikanische Linguistik: Grundlegende Trends / Ed. Hrsg. A.A. Kibrik, I.M. Kobozeva, I.A. Sekerina. - M.: Verlag "Editorial", 2002. - S. 354.
- Rakhilina E.V. Zu Trends in der Entwicklung der kognitiven Semantik // Literatur- und Sprachreihe, 2000. - Nr. 3. – S. 6.
Es begann im 20. Jahrhundert als eigenständige Wortart wahrgenommen zu werden, als sich der Anwendungsbereich dieser künstlerischen Technik erweiterte, was zur Entstehung neuer Literaturgattungen führte. - Allegorien, Sprichwörter und Rätsel.
Funktionen
Auf Russisch, wie auch auf allen anderen, Metapher spielt eine wichtige Rolle und übernimmt folgende Hauptaufgaben:
- die Erklärung abgeben Emotionalität und figurativ ausdrucksstarke Farbgebung;
- Wortschatz aufbauen neue Konstruktionen und lexikalische Phrasen(Nominativfunktion);
- hell ungewöhnlich enthüllende Bilder und Essenz.
Aufgrund der breiten Verwendung dieser Figur sind neue Konzepte entstanden. Metaphorisch bedeutet also allegorisch, bildlich, bildlich und metaphorisch ausgedrückt bedeutet, im indirekten, übertragenen Sinne verwendet zu werden. Unter Metaphorismus versteht man die Verwendung von Metaphern zur Darstellung von etwas..

Sorten
Oftmals gibt es Schwierigkeiten, ein bestimmtes literarisches Mittel zu definieren und von anderen zu unterscheiden. Definieren Sie eine Metapher möglich nach Verfügbarkeit:
- Ähnlichkeiten in der räumlichen Anordnung;
- Ähnlichkeit in der Form (der Hut einer Frau ist ein Hut an einem Nagel);
- äußere Ähnlichkeit (Nähnadel, Fichtennadel, Igelnadel);
- die Übertragung eines Zeichens einer Person auf ein Objekt (eine dumme Person – ein Stummfilm);
- Farbähnlichkeit (goldene Halskette - goldener Herbst);
- Ähnlichkeit der Aktivität (eine Kerze brennt – eine Lampe brennt);
- Ähnlichkeit der Position (Stiefelsohle - Felssohle);
- Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier (Schaf, Schwein, Esel).
All dies ist eine Bestätigung dafür, dass es sich um einen versteckten Vergleich handelt. Empfohlen Einstufung gibt an, welche Arten von Metaphern von der Ähnlichkeit der Konzepte abhängen.
Wichtig! Die künstlerische Technik hat in verschiedenen Sprachen ihre eigenen Besonderheiten, daher kann die Bedeutung unterschiedlich sein. So wird der „Esel“ bei den Russen mit Sturheit und beispielsweise bei den Spaniern mit harter Arbeit in Verbindung gebracht.
Ausdrucksmittel nach verschiedenen Parametern klassifiziert. Wir bieten eine klassische Version an, die es seit der Antike gibt.
Die Metapher könnte sein:
- scharf- basierend auf einem Vergleich verschiedener, nahezu inkompatibler Konzepte: das Füllen der Aussage.
- Gelöscht- einer, der nicht als figurativer Umsatz gilt: das Tischbein.
- Die Form einer Formel haben- ähnelt dem gelöschten, weist jedoch verschwommenere Ränder der Bildlichkeit auf, ein nicht-bildlicher Ausdruck ist in diesem Fall unmöglich: der Wurm des Zweifels.
- Umgesetzt- Bei der Verwendung eines Ausdrucks wird dessen bildliche Bedeutung nicht berücksichtigt. Oft durch komische Aussagen realisiert: „Ich verlor die Beherrschung und stieg in den Bus.“
- Erweiterte Metapher- Eine auf Assoziation basierende Redewendung, die sich in der gesamten Äußerung verwirklicht, ist in der Literatur üblich: „Der Bücherhunger lässt nicht nach: Produkte vom Buchmarkt werden immer veralteter ...“. Auch in der Poesie nimmt es einen besonderen Platz ein: „Hier umarmt der Wind einen Wellenschwarm mit starker Umarmung und wirft ihn im großen Stil in wilder Wut auf die Klippen ...“ (M. Gorki).
Je nach Prävalenzgrad gibt es:
- Wird häufig trocken verwendet
- gemeinsame figurative,
- poetisch,
- Zeitungsfigurativ,
- Urheberrecht bildlich.

Ausdrucksbeispiele
Die Literatur ist voll von Sätzen mit Metapherbeispielen auf Russisch:
- „Im Garten brennt ein Feuer aus roter Eberesche“ (S. Yesenin).
- „Solange wir vor Freiheit brennen, solange unsere Herzen für Ehre leben ...“ (A. Puschkin)
- „Sie singt – und die Klänge schmelzen …“ (M. Lermontov) – die Klänge schmelzen;
- „... Das Gras weinte ...“ (A.) – das Gras weinte;
- „Es war eine goldene Zeit, aber sie war verborgen“ (A. Koltsov) – eine goldene Zeit;
- „Der Herbst des Lebens muss wie der Herbst des Jahres dankbar angenommen werden“ (E. Ryazanov) – der Herbst des Lebens;
- „Die Fähnrichs blickten in den Zaren“ (A. Tolstoi) – sie blickten in ihre Augen.
Dies ist eines der am häufigsten verwendeten Bilder in der Sprache. Einen besonderen Platz nimmt die Poesie ein, bei der die Bildsprache im Vordergrund steht.. In manchen Werken finden diese Redewendungen im Laufe der Geschichte statt.
Anschauliche Beispiele für Metaphern in der Literatur: tote Nacht, goldener Kopf, Igelhandschuhe, goldene Hände, eiserner Charakter, steinernes Herz, wie eine Katze weinte, Sattelkupplung in einem Karren, Wolfsgriff.
Metapher
Woher kommt die Metapher? [Vorlesungen zur Literatur]
Abschluss
Die Technik, ähnliche Eigenschaften von einem Konzept auf ein anderes zu übertragen, wird in der Alltagssprache häufig verwendet. Es ist auch nicht schwierig, viele Beispiele in Belletristik, Prosa und Poesie zu finden, da diese Redewendung die wichtigste in jedem literarischen Werk ist.
Eine Metapher ist ein Ausdruck oder ein Wort im übertragenen Sinne, dessen Grundlage ein Phänomen oder ein Gegenstand ist, der damit eine Ähnlichkeit aufweist. In einfachen Worten wird ein Wort durch ein anderes ersetzt, das ein ähnliches Zeichen trägt.
Die Metapher in der Literatur ist eine der ältesten
Was ist eine Metapher?
Metapher besteht aus 4 Teilen:
- Kontext – eine vollständige Textpassage, die die Bedeutung der einzelnen darin enthaltenen Wörter oder Sätze vereint.
- Ein Objekt.
- Der Prozess, durch den die Funktion ausgeführt wird.
- Anwendung dieses Prozesses oder seine Überschneidung mit beliebigen Situationen.
Der Begriff der Metapher wurde von Aristoteles entdeckt. Dank ihm hat sich nun eine Ansicht darüber gebildet, dass sie ein notwendiges Hilfsmittel der Sprache ist, das es ermöglicht, kognitive und andere Ziele zu erreichen.
Antike Philosophen glaubten, dass die Metapher uns von der Natur selbst gegeben wurde und in der Alltagssprache so verankert war, dass viele Konzepte nicht wörtlich genannt werden müssen und ihre Verwendung den Mangel an Wörtern ausgleicht. Aber nach ihnen wurde ihr die Funktion einer zusätzlichen Anwendung auf den Mechanismus der Sprache und nicht auf ihre Hauptform zugeschrieben. Man glaubte, dass es für die Wissenschaft sogar schädlich sei, weil es in eine Sackgasse bei der Suche nach der Wahrheit führe. Allen Widrigkeiten zum Trotz existierte die Metapher weiterhin in der Literatur, weil sie für ihre Entwicklung notwendig war. Es wurde hauptsächlich in der Poesie verwendet.
Erst im 20. Jahrhundert wurde die Metapher endgültig als integraler Bestandteil der Sprache anerkannt und die wissenschaftliche Forschung begann, sie in neuen Dimensionen durchzuführen. Ermöglicht wurde dies durch eine Eigenschaft wie die Fähigkeit, Materialien unterschiedlicher Natur zu kombinieren. In der Literatur wurde es deutlich, als sie sahen, dass der erweiterte Einsatz dieser künstlerischen Technik zur Entstehung von Rätseln, Sprichwörtern und Allegorien führt.

Eine Metapher aufbauen
Eine Metapher besteht aus 4 Komponenten: zwei Gruppen und Eigenschaften von jeder von ihnen. Merkmale einer Objektgruppe werden einer anderen Gruppe angeboten. Wenn eine Person als Löwe bezeichnet wird, wird davon ausgegangen, dass sie über ähnliche Eigenschaften verfügt. So entsteht ein neues Bild, bei dem das Wort „Löwe“ im übertragenen Sinne „furchtlos und mächtig“ bedeutet.
Metaphern sind spezifisch für verschiedene Sprachen. Wenn bei den Russen der „Esel“ Dummheit und Sturheit symbolisiert, dann bei den Spaniern Fleiß. Eine Metapher in der Literatur ist ein Konzept, das bei verschiedenen Völkern unterschiedlich sein kann und bei der Übersetzung von einer Sprache in eine andere berücksichtigt werden sollte.
Metapherfunktionen
Die Hauptfunktion der Metapher ist eine lebendige emotionale Einschätzung und eine bildlich ausdrucksstarke Färbung der Sprache. Gleichzeitig entstehen aus unvergleichlichen Objekten reichhaltige und umfangreiche Bilder.
Eine weitere Funktion ist der Nominativ, der darin besteht, die Sprache mit Phraseologie- und lexikalischen Konstruktionen zu füllen, zum Beispiel: Flaschenhals, Stiefmütterchen.
Neben den Hauptfunktionen erfüllt die Metapher noch viele weitere Funktionen. Dieses Konzept ist viel umfassender und reichhaltiger, als es auf den ersten Blick scheint.
Was sind Metaphern?
Seit der Antike werden Metaphern in folgende Typen unterteilt:
- Scharf - verbindende Konzepte, die in verschiedenen Ebenen liegen: „Ich laufe durch die Stadt, schieße mit meinen Augen ...“.
- Ausradiert – so alltäglich, dass der figurative Charakter nicht mehr wahrgenommen wird („Schon morgens bei mir Die Leute meldeten sich"). Es ist so vertraut geworden, dass die bildliche Bedeutung schwer zu verstehen ist. Es wird beim Übersetzen von einer Sprache in eine andere gefunden.
- Metapher-Formel – ihre Umwandlung in eine direkte Bedeutung ist ausgeschlossen (der Wurm des Zweifels, das Glücksrad). Sie ist zu einem Stereotyp geworden.
- Erweitert – enthält eine große Nachricht in einer logischen Reihenfolge.
- Implementiert – bestimmungsgemäß verwendet („ Kam zur Besinnung, und schon wieder eine Sackgasse).

Das moderne Leben ist ohne metaphorische Bilder und Vergleiche kaum vorstellbar. Die häufigste Metapher in der Literatur. Dies ist für eine anschauliche Offenlegung von Bildern und dem Wesen von Phänomenen notwendig. In der Poesie ist die erweiterte Metapher besonders wirksam, wenn sie auf folgende Weise dargestellt wird:
- Indirekte Kommunikation mittels oder Verlauf mittels Vergleich.
- Eine Redewendung, die Wörter im übertragenen Sinne verwendet und auf Analogie, Ähnlichkeit und Vergleich basiert.
Im Textfragment konsequent offengelegt: „ Ein feiner Regen mit der Morgendämmerung wäscht die Morgendämmerung», « Der Mond schenkt Neujahrsträume».
Einige Klassiker glaubten, dass eine Metapher in der Literatur ein eigenständiges Phänomen sei, das durch sein Auftreten eine neue Bedeutung erhält. In diesem Fall wird es zum Ziel des Autors, wobei das metaphorische Bild den Leser zu einer neuen Bedeutung, einer unerwarteten Bedeutung führt. Solche Metaphern aus der Fiktion finden sich in den Werken der Klassiker. Nehmen wir zum Beispiel die Nase, die in Gogols Geschichte eine metaphorische Bedeutung erhält. Reich an metaphorischen Bildern, die Charakteren und Ereignissen eine neue Bedeutung verleihen. Auf dieser Grundlage lässt sich sagen, dass ihre weit verbreitete Definition noch lange nicht vollständig ist. Metaphern in der Literatur sind ein umfassenderes Konzept und schmücken die Sprache nicht nur, sondern verleihen ihr oft auch eine neue Bedeutung.

Abschluss
Was ist Metapher in der Literatur? Aufgrund seiner emotionalen Färbung und Bildsprache hat es eine effektivere Wirkung auf das Bewusstsein. Besonders deutlich wird dies in der Poesie. Die Wirkung der Metapher ist so stark, dass Psychologen sie nutzen, um Probleme im Zusammenhang mit der Psyche von Patienten zu lösen.
Bei der Erstellung von Anzeigen werden metaphorische Bilder verwendet. Sie regen die Fantasie an und helfen Verbrauchern, die richtige Wahl zu treffen. Dasselbe wird von der Gesellschaft auch im politischen Bereich durchgeführt.
Metaphern halten zunehmend Einzug in den Alltag und manifestieren sich in Sprache, Denken und Handeln. Das Studium wird erweitert und deckt neue Wissensbereiche ab. Anhand der durch Metaphern erzeugten Bilder kann man die Wirksamkeit eines bestimmten Mediums beurteilen.
Und es hängt mit seinem Verständnis von Kunst als Nachahmung des Lebens zusammen. Die Metapher des Aristoteles ist im Wesentlichen kaum von Übertreibung (Übertreibung), von Synekdoche, von einfachem Vergleich oder Personifizierung und Vergleich zu unterscheiden. In allen Fällen findet eine Bedeutungsübertragung von einem Wort auf ein anderes statt.
- Eine indirekte Botschaft in Form einer Geschichte oder eines bildlichen Ausdrucks mittels Vergleich.
- Eine Redewendung, die in der Verwendung von Wörtern und Ausdrücken im übertragenen Sinne besteht, die auf einer Art Analogie, Ähnlichkeit oder Vergleich basieren.
Es gibt 4 „Elemente“ in der Metapher
- Kategorie oder Kontext,
- Ein Objekt innerhalb einer bestimmten Kategorie,
- Der Prozess, durch den dieses Objekt eine Funktion ausführt,
- Anwendungen dieses Prozesses auf reale Situationen oder Schnittpunkte mit ihnen.
- Eine scharfe Metapher ist eine Metapher, die weit voneinander entfernte Konzepte zusammenführt. Modell: Füllanweisungen.
- Eine gelöschte Metapher ist eine allgemein akzeptierte Metapher, deren bildlicher Charakter nicht mehr spürbar ist. Modell: Stuhlbein.
- Die Metapher-Formel ähnelt der gelöschten Metapher, unterscheidet sich jedoch von ihr durch einen noch größeren Stereotyp und manchmal die Unmöglichkeit, sie in eine nicht-figurative Konstruktion umzuwandeln. Modell: Zweifelswurm.
- Eine erweiterte Metapher ist eine Metapher, die konsistent über einen großen Teil einer Nachricht oder die gesamte Nachricht als Ganzes implementiert wird. Vorbild: Der Bücherhunger hält an: Produkte aus dem Buchmarkt werden zunehmend altbacken – sie müssen unvermittelt weggeworfen werden.
- Bei einer realisierten Metapher geht es darum, einen metaphorischen Ausdruck zu betreiben, ohne dessen bildliche Natur zu berücksichtigen, d. h. so, als ob die Metapher eine direkte Bedeutung hätte. Das Ergebnis der Umsetzung einer Metapher ist oft komisch. Model: Ich verlor die Beherrschung und stieg in den Bus.
Theorien
Unter anderen Tropen nimmt die Metapher einen zentralen Platz ein, da sie es Ihnen ermöglicht, umfassende Bilder zu schaffen, die auf lebendigen, unerwarteten Assoziationen basieren. Metaphern können auf der Ähnlichkeit unterschiedlichster Merkmale von Objekten basieren: Farbe, Form, Volumen, Zweck, Position usw.
Nach der von N. D. Arutyunova vorgeschlagenen Klassifikation werden Metaphern unterteilt in
- Nominativ, das darin besteht, eine beschreibende Bedeutung durch eine andere zu ersetzen und als Quelle der Homonymie zu dienen;
- figurative Metaphern, die der Entwicklung bildlicher Bedeutungen und synonymer Sprachmittel dienen;
- kognitive Metaphern, die aus einer Verschiebung der Kombination von Prädikatwörtern (Bedeutungsübertragung) resultieren und Polysemie erzeugen;
- Verallgemeinerung von Metaphern (als Endergebnis einer kognitiven Metapher), Aufhebung der Grenzen zwischen logischen Ordnungen in der lexikalischen Bedeutung des Wortes und Stimulierung der Entstehung logischer Polysemie.
Schauen wir uns Metaphern genauer an, die zur Entstehung von Bildern oder figurativen Bildern beitragen.
Im weitesten Sinne bedeutet der Begriff „Bild“ eine gedankliche Widerspiegelung der Außenwelt. In einem Kunstwerk sind Bilder die Verkörperung des Denkens des Autors, seiner einzigartigen Vision und seines lebendigen Bildes des Weltbildes. Die Schaffung eines lebendigen Bildes basiert auf der Nutzung der Ähnlichkeit zweier weit voneinander entfernter Objekte, fast auf einer Art Kontrast. Damit der Vergleich von Objekten oder Phänomenen unerwartet ist, müssen sie sich stark voneinander unterscheiden, und manchmal kann die Ähnlichkeit ganz unbedeutend, nicht wahrnehmbar, Anlass zum Nachdenken geben oder ganz fehlen.
Die Grenzen und die Struktur des Bildes können praktisch beliebig sein: Das Bild kann durch ein Wort, eine Phrase, einen Satz, eine superphrasale Einheit vermittelt werden, es kann ein ganzes Kapitel einnehmen oder die Komposition eines ganzen Romans abdecken.
Es gibt jedoch andere Ansichten zur Klassifizierung von Metaphern. J. Lakoff und M. Johnson unterscheiden beispielsweise zwei Arten von Metaphern, die in Bezug auf Zeit und Raum betrachtet werden: ontologische, also Metaphern, die es ermöglichen, Ereignisse, Handlungen, Emotionen, Ideen usw. als eine Art Substanz zu sehen ( Der Geist ist eine Einheit, der Geist ist eine zerbrechliche Sache) und orientierte oder orientierende, also Metaphern, die einen Begriff nicht anhand eines anderen definieren, sondern das gesamte Begriffssystem in Bezug zueinander organisieren ( glücklich ist oben, traurig ist unten; Das Bewusstsein ist oben, das Unbewusste ist unten).
George Lakoff spricht in seinem Werk „The Contemporary Theory of Metapher“ über die Möglichkeiten der Metapherbildung und die Zusammensetzung dieses künstlerischen Ausdrucksmittels. Nach Lakoffs Theorie ist eine Metapher ein prosaischer oder poetischer Ausdruck, bei dem ein Wort (oder mehrere Wörter), bei dem es sich um einen Begriff handelt, im indirekten Sinne verwendet wird, um einen diesem ähnlichen Begriff auszudrücken. Lakoff schreibt, dass in Prosa oder poetischer Rede die Metapher außerhalb der Sprache, im Gedanken, in der Vorstellung liegt, und bezieht sich dabei auf Michael Reddys Werk „The Conduit Metaphor“, in dem Reddy feststellt, dass die Metapher in der Sprache selbst liegt, in Alltagssprache, und zwar nicht nur in Poesie oder Prosa. Reddy stellt außerdem fest, dass „der Sprecher Ideen (Objekte) in Worte fasst und sie an den Hörer sendet, der die Ideen/Objekte aus den Worten extrahiert.“ Diese Idee spiegelt sich auch in der Studie von J. Lakoff und M. Johnson „Metaphors by which we live“ wider. Metaphorische Konzepte sind systemisch: „Metapher beschränkt sich nicht nur auf die Sphäre der Sprache, also auf die Sphäre der Wörter: Die Prozesse des menschlichen Denkens selbst sind weitgehend metaphorisch.“ Metaphern als sprachliche Ausdrücke werden gerade dadurch möglich, dass es Metaphern im menschlichen Begriffssystem gibt.
Metaphern werden oft als eine Möglichkeit angesehen, die Realität künstlerisch genau wiederzugeben. Allerdings sagt I. R. Galperin: „Dieses Konzept der Genauigkeit ist sehr relativ. Es handelt sich um eine Metapher, die ein spezifisches Bild eines abstrakten Konzepts erzeugt, das es ermöglicht, reale Botschaften auf unterschiedliche Weise zu interpretieren.
Eiserne Nerven, ein eisiges Herz und goldene Hände ließen ihn alle mit schwarzem Neid beneiden. Wie gefallen Ihnen vier Metaphern in einem Satz?
Guten Tag, liebe Leser, wenn Sie auf meiner Seite gelandet sind, dann möchten Sie etwas Neues darüber lernen, wie Sie bestimmte Texte verfassen, Ihre Seite bewerben oder ähnliches informieren. Heute werden wir darüber sprechen, was eine Metapher ist, wir werden lernen, wie wir eine eigene Metapher erstellen und verstehen, wie sie den Text bereichert. Ich werde auch Beispiele aus der Literatur zeigen.
Was ist es? Eine Metapher ist ein Wort oder eine Wortkombination, die im übertragenen Sinne verwendet wird. Der Zweck der Verwendung einer Metapher besteht darin, einen unbenannten Namen, eine unbenannte Eigenschaft oder einen unbenannten Wert eines Objekts mit einem anderen Objekt, einer anderen Eigenschaft oder einem anderen Wert auf der Grundlage ähnlicher Merkmale zu vergleichen. Es ist nicht so schwer wie der Wortlaut, also haben Sie keine Angst.
Dieses Sprachwerkzeug wird oft mit einem Vergleich verwechselt, aber der Hauptunterschied besteht darin, dass beim Vergleich sofort klar wird, was und womit man vergleicht, zum Beispiel „Er war schön wie eine Blume“. Ein Beispiel für eine Metapher wäre einfach der Ausdruck „Lila einer Rose“. Jeder versteht, dass die Rose nicht lila ist, sondern eine helle Farbe hat, ähnlich einem entfernten Lila-Ton.
groß und mächtig
Heutzutage gibt es in der modernen russischen Literatursprache eine Vielzahl unterschiedlicher Mittel zur Verstärkung der Wirkung. Solche Mittel werden als künstlerische Techniken bezeichnet und in folgenden Sprechstilen verwendet:
In der Belletristik werden ausdrucksstarke Phrasen verwendet, um trockenen Text zu verwässern. Im Journalismus - um die Wirkung und Wirkung auf den Leser zu verstärken, um ihn dazu zu bringen, etwas zu tun oder zumindest über die Bedeutung dessen nachzudenken, was er liest.
Erschaffen lernen
Damit Sie eine coole Metapher erstellen können, müssen Sie eine Regel verstehen: Sie muss für die breite Masse verständlich sein. Das heißt, es muss verstanden werden. Natürlich denken und erraten einige Leute wirklich gerne, was der Autor wirklich sagen wollte, aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz der Leser. Die meisten möchten im Text etwas Vertrautes wiedererkennen und mit sich selbst assoziieren.
Nachdem man die erste Regel verstanden hat, sollte man auch bedenken, dass es in der modernen Sprache eine Vielzahl von Klischees (sehr abgedroschene Phrasen) gibt. Sie können den Augen des Lesers sehr schaden. Urteilen Sie selbst, wie abgedroschen Phrasen wie „Liebe zum Bösen“ und „billig kaufen“ sind. Das erste ist klar, aber das zweite ist ein erzwungenes Klischee, das zur Optimierung der Website benötigt wird.
Oft ist es auf solchen Seiten überhaupt nicht möglich, etwas Billiges zu kaufen. Klischeemetaphern haben eine doppelt abstoßende Wirkung. „Deine Augen sind das Meer“ ist beispielsweise eine Metapher, die zur Mittagszeit hundert Jahre alt ist. Es wird beim Leser keine andere Wirkung als Ekel hervorrufen. Denken Sie daran, dass Sie keine Ausdrücke verwenden dürfen, die weit vom Leser entfernt sind und von denen er schon ziemlich genug hat. Versuchen Sie, diesen schmalen Grat zu finden, und Ihre Arbeit wird sofort lesbarer und interessanter.

Einstufung
Heutzutage gibt es verschiedene Arten von Metaphern:
- Scharf (reduziert Konzepte mit entfernter Bedeutung);
- Erweitert (fasst mehrere Konzepte zusammen und wird in verschiedenen Teilen des Textes verkörpert, zum Beispiel „Der Automarkt ist gefallen: Produkte vom Automarkt werden immer veralteter, man möchte sie nicht einmal probieren“);
- Gelöscht (eine Metapher, die im Alltag verwendet wird und bereits so wahrgenommen wird, wie sie sein sollte, zum Beispiel eine Türklinke);
- Metapher-Formel (nahezu gelöscht, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass etablierte Ausdrücke als Ausdruckseinheiten fungieren – unzerstörbare Wortkombinationen, zum Beispiel ein goldenes Herz).
Beispiele aus der Literatur
Unsere großen Vorfahren haben uns einen riesigen Wissensschatz hinterlassen, der in der Literatur verschlüsselt ist, und nur wer alle Ideen des Autors verstehen kann, kann an dieses Wissen gelangen. Es lohnt sich, die Suche damit zu beginnen, dass Sie lernen, die künstlerischen Mittel zu verstehen, die in der Literatur verwendet wurden. Es ist auch notwendig, die Werke wirklich zu genießen und nicht zu lesen und zu vergessen.
Da wir heute über Metaphern sprechen, versuchen wir, sie zu verstehen. In Sergei Yesenins Gedicht „Ich bereue nicht, ich rufe nicht, ich weine nicht“ beispielsweise impliziert die Metapher „... verwelktes Gold bedeckt ...“ die Nähe zum Alter. Wenn Sie selbst schon einmal darüber nachgedacht haben, dann herzlichen Glückwunsch, Sie können die Metapher bereits erkennen und, was am wichtigsten ist, ihre Bedeutung verstehen. Aber wenn Sie diese Sprachfunktion kennen und verstehen, ist es keineswegs notwendig, dass Sie sie selbst erstellen können. Dies erfordert mindestens Training und noch besser - einen scharfen Verstand. „Scharfer Geist“ ist übrigens auch eine Metapher für das Denken über den Tellerrand hinaus.
Es stellt sich heraus, dass der alltägliche Kommunikationsstil auch das Vorhandensein sprachlicher Mittel impliziert, die Metapher ist hier jedoch weitaus seltener als beispielsweise Vergleiche oder Epitheta.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende gelesen haben. Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und erhalten Sie die Möglichkeit, ein einzigartiges Buch herunterzuladen, das Ihnen dabei hilft, ein echter Autor zu werden.