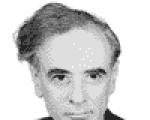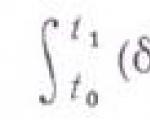Brüder von Alexander 1. Russland während der Regierungszeit von Alexander I
Kaiser Alexander I. war der Enkel Katharinas der Großen von ihrem einzigen Sohn Pawel Petrowitsch und der deutschen Prinzessin Sophia von Württemberg, in der Orthodoxie Maria Fjodorowna. Er wurde am 25. Dezember 1777 in St. Petersburg geboren. Der nach Alexander Newski benannte neugeborene Kronprinz wurde sofort von seinen Eltern getrennt und unter der Kontrolle der königlichen Großmutter erzogen, was die politischen Ansichten des zukünftigen Autokraten stark beeinflusste.
Kindheit und Jugend
Die gesamte Kindheit Alexanders verlief unter der Kontrolle seiner regierenden Großmutter, er kommunizierte fast nicht mit seinen Eltern, trotzdem liebte er wie Pater Pavel militärische Angelegenheiten und war mit ihnen bestens vertraut. Der Zarewitsch diente im aktiven Dienst in Gatschina, im Alter von 19 Jahren wurde er zum Oberst befördert.
Der Zarewitsch hatte Einsicht, erfasste schnell neues Wissen und lernte mit Freude. In ihm und nicht in ihrem Sohn Paul sah Katharina die Große den zukünftigen russischen Kaiser, aber sie konnte ihn nicht an ihrem Vater vorbei auf den Thron setzen.
Im Alter von 20 Jahren wurde er Generalgouverneur von St. Petersburg und Chef des Semenovsky-Garderegiments. Ein Jahr später beginnt er, im Senat zu sitzen.
Alexander stand der Politik seines Vaters Kaiser Paul kritisch gegenüber und wurde daher in eine Verschwörung verwickelt, die darauf abzielte, den Kaiser vom Thron zu stürzen und Alexander auf die Thronbesteigung zu befördern. Die Bedingung des Kronprinzen bestand jedoch darin, das Leben seines Vaters zu retten, so dass der gewaltsame Tod des letzteren dem Kronprinzen ein lebenslanges Schuldgefühl einbrachte.
Eheleben
Das Privatleben Alexanders I. war sehr ereignisreich. Die ehelichen Beziehungen mit dem Zarewitsch begannen früh – im Alter von 16 Jahren heiratete er die vierzehnjährige Prinzessin Louise Maria Augusta von Baden, die ihren Namen in die Orthodoxie änderte und in Elizaveta Alekseevna wurde. Die Jungvermählten passten sehr gut zueinander, weshalb sie unter den Höflingen die Spitznamen Amor und Psyche erhielten. In den ersten Jahren der Ehe war die Beziehung zwischen den Ehegatten sehr zärtlich und berührend, die Großherzogin wurde am Hof von allen außer der Schwiegermutter Maria Fjodorowna sehr geliebt und respektiert. Die herzlichen Beziehungen in der Familie verwandelten sich jedoch bald in kühle – die Frischvermählten hatten zu unterschiedliche Charaktere, außerdem betrog Alexander Pawlowitsch seine Frau oft.
Die Frau von Alexander I. zeichnete sich durch Bescheidenheit aus, mochte keinen Luxus, engagierte sich für wohltätige Zwecke, sie ging lieber spazieren und las Bücher als Bälle und gesellschaftliche Veranstaltungen.

Großherzogin Maria Alexandrowna
Fast sechs Jahre lang trug die Ehe des Großherzogs keine Früchte, und erst 1799 bekam Alexander I. Kinder. Die Großherzogin gebar eine Tochter, Maria Alexandrowna. Die Geburt des Babys führte zu einem innerfamiliären Skandal im Kaiserhaus. Alexanders Mutter deutete an, dass das Kind nicht vom Zarewitsch, sondern vom Fürsten Czartoryski geboren wurde, mit dem sie eine Affäre hatte, mit dem sie ihre Schwiegertochter verdächtigte. Außerdem wurde das Mädchen als Brünette geboren und beide Eltern waren Blondinen. Auch Kaiser Paul deutete den Verrat seiner Schwiegertochter an. Zarewitsch Alexander selbst erkannte seine Tochter und sprach nie über den möglichen Verrat seiner Frau. Das Glück der Vaterschaft war nur von kurzer Dauer, Großherzogin Maria lebte etwas mehr als ein Jahr und starb im Jahr 1800. Der Tod ihrer Tochter versöhnte das Paar kurzzeitig und brachte sie näher zusammen.
Großfürstin Elisabeth Alexandrowna
Zahlreiche Romane entfremdeten die gekrönten Ehepartner zunehmend, Alexander lebte, ohne sich zu verstecken, mit Maria Naryshkina zusammen, und seit 1803 begann Kaiserin Elisabeth eine Affäre mit Alexy Okhotnikov. Im Jahr 1806 brachte die Frau von Alexander I. eine Tochter, Großherzogin Elisabeth, zur Welt. Obwohl das Paar mehrere Jahre lang nicht zusammengelebt hatte, erkannte der Kaiser seine Tochter an, was das Mädchen zur ersten Person auf dem russischen Thron machte. Die Kinder Alexanders I. gefielen ihm nicht lange. Die zweite Tochter starb im Alter von 18 Monaten. Nach dem Tod von Prinzessin Elizabeth wurde die Beziehung des Ehepaares noch cooler.

Liebesbeziehung mit Maria Naryshkina
Das Eheleben funktionierte in vielerlei Hinsicht nicht, da Alexander vor der Heirat von Chetvertinskaya eine fünfzehnjährige Verbindung mit der Tochter des polnischen Aristokraten M. Naryshkina hatte. Alexander verbarg diese Verbindung nicht, seine Familie und alle Höflinge wussten davon, außerdem versuchte Maria Naryshkina selbst bei jeder Gelegenheit, die Frau des Kaisers zu stechen, was auf eine Affäre mit Alexander hindeutete. Im Laufe der Jahre einer Liebesbeziehung wurde Alexander die Vaterschaft von fünf der sechs Kinder von Naryshkina zugeschrieben:
- Elizaveta Dmitrievna, geboren 1803,
- Elizaveta Dmitrievna, geboren 1804,
- Sofia Dmitrievna, geboren 1808,
- Zinaida Dmitrievna, geboren 1810,
- Emmanuil Dmitrievich, geboren 1813.
Im Jahr 1813 trennte sich der Kaiser von Naryshkina, da er sie verdächtigte, eine Affäre mit einem anderen Mann zu haben. Der Kaiser vermutete, dass Emmanuel Naryshkin nicht sein Sohn war. Nach dem Abschied pflegten die ehemaligen Liebenden freundschaftliche Beziehungen. Von allen Kindern von Maria und Alexander I. lebte Sofya Naryshkina am längsten. Sie starb im Alter von 16 Jahren am Vorabend ihrer Hochzeit.

Uneheliche Kinder Alexanders I
Neben Kindern von Maria Naryshkina hatte Kaiser Alexander auch andere Favoriten.
- Nikolai Lukash, geboren 1796 aus Sophia Meshcherskaya;
- Maria, geboren 1819 als Tochter von Maria Turkestanova;
- Maria Alexandrowna von Paris (1814), Mutter von Margarita Josephine Weimer;
- Alexandrova Wilhelmina Alexandrina Paulina, geboren 1816, Mutter unbekannt;
- (1818), Mutter Elena Rautenstrauch;
- Nikolay Isakov (1821), Mutter - Karacharova Maria.
Die Vaterschaft der letzten vier Kinder bleibt unter Forschern der Kaiserbiographie umstritten. Einige Historiker bezweifeln generell, dass Alexander I. Kinder hatte.

Innenpolitik 1801 -1815
Nachdem er im März 1801 den Thron bestiegen hatte, verkündete Alexander I. Pawlowitsch, dass er die Politik seiner Großmutter Katharina der Großen fortsetzen werde. Neben dem Titel eines russischen Kaisers trug Alexander seit 1815 den Titel Zar von Polen, seit 1801 Großherzog von Finnland und seit 1801 Beschützer des Malteserordens.
Alexander I. (von 1801 bis 1825) begann seine Herrschaft mit der Entwicklung radikaler Reformen. Der Kaiser schaffte die Geheimexpedition ab, verbot die Anwendung von Folter gegen Gefangene, erlaubte die Einfuhr von Büchern aus dem Ausland und die Eröffnung privater Druckereien im Land.
Alexander machte den ersten Schritt zur Abschaffung der Leibeigenschaft, indem er ein Dekret „Über freie Landwirte“ erließ und ein Verbot des Verkaufs von Bauern ohne Land einführte, aber diese Maßnahmen brachten keine besonderen Änderungen.

Reformen im Bildungssystem
Alexanders Reformen im Bildungssystem waren fruchtbarer. Es wurde eine klare Abstufung der Bildungseinrichtungen nach dem Niveau der Bildungsprogramme eingeführt, so dass Bezirks- und Pfarrschulen, Provinzgymnasien und -kollegs sowie Universitäten entstanden. In den Jahren 1804-1810. Die Universitäten Kasan und Charkow wurden eröffnet, in St. Petersburg wurde ein pädagogisches Institut eröffnet, in der Hauptstadt wurde das privilegierte Zarskoje-Selo-Lyzeum restauriert und die Akademie der Wissenschaften wiederhergestellt.
Von den ersten Tagen seiner Herrschaft an umgab sich der Kaiser mit jungen, gebildeten Menschen mit fortschrittlichen Ansichten. Einer von ihnen war der Jurist Speransky. Unter seiner Führung wurden die Petrovsky-Kollegien im Ministerium reformiert. Speransky begann auch mit der Entwicklung eines Projekts zum Wiederaufbau des Reiches, das die Gewaltenteilung und die Schaffung einer gewählten Vertretung vorsah. Damit wäre die Monarchie in eine konstitutionelle umgewandelt worden, doch die Reform stieß auf Widerstand der politischen und aristokratischen Eliten und wurde daher nicht durchgeführt.
Reformen 1815-1825
Unter der Herrschaft Alexanders I. veränderte sich die Geschichte Russlands dramatisch. Der Kaiser war zu Beginn seiner Regierungszeit innenpolitisch aktiv, doch nach 1815 begann der Niedergang. Darüber hinaus stieß jede seiner Reformen auf heftigen Widerstand des russischen Adels. Seitdem gab es im Russischen Reich keine wesentlichen Veränderungen. In den Jahren 1821-1822 wurde in der Armee eine Geheimpolizei eingerichtet, Geheimorganisationen und Freimaurerlogen wurden verboten.
Ausnahmen bildeten die westlichen Provinzen des Reiches. Im Jahr 1815 erteilte Alexander I. dem polnischen Königreich eine Verfassung, nach der Polen eine erbliche Monarchie innerhalb Russlands wurde. In Polen wurde der Zweikammer-Sejm beibehalten, der zusammen mit dem König das gesetzgebende Organ war. Die Verfassung war liberaler Natur und ähnelte in vielerlei Hinsicht der französischen Charta und der Verfassung Englands. Auch in Finnland wurde die Umsetzung des Verfassungsgesetzes von 1772 garantiert und die Bauern der baltischen Staaten von der Leibeigenschaft befreit.

Militärreform
Nach dem Sieg über Napoleon erkannte Alexander, dass das Land eine Militärreform brauchte, und so wurde der Kriegsminister Arakcheev seit 1815 mit der Entwicklung seines Projekts beauftragt. Es beinhaltete die Schaffung von Militärsiedlungen als neue militärisch-landwirtschaftliche Klasse, die die Armee dauerhaft ergänzen würde. Die ersten Siedlungen dieser Art wurden in den Provinzen Cherson und Nowgorod gegründet.
Außenpolitik
Die Herrschaft Alexanders I. hinterließ ihre Spuren in der Außenpolitik. Im ersten Jahr seiner Herrschaft schloss er Friedensverträge mit England und Frankreich und trat 1805–1807 in die Reihen des französischen Kaisers Napoleon ein. Die Niederlage bei Austerlitz verschärfte die Lage Russlands, was im Juni 1807 zur Unterzeichnung des Friedens von Tilsit mit Napoleon führte, der die Bildung eines Verteidigungsbündnisses zwischen Frankreich und Russland implizierte.
Erfolgreicher war die russisch-türkische Konfrontation von 1806-1812, die mit der Unterzeichnung des Vertrags von Brest-Litowsk endete, wonach Bessarabien an Russland abgetreten wurde.
Der Krieg mit Schweden 1808-1809 endete mit dem Sieg Russlands, im Rahmen eines Friedensvertrages erhielt das Reich Finnland und die Åland-Inseln.
Ebenfalls während der Herrschaft Alexanders während des Russisch-Persischen Krieges wurden Aserbaidschan, Imeretien, Gurien, Mengrelien und Abchasien dem Reich angegliedert. Das Reich erhielt das Recht, eine eigene kaspische Flotte zu besitzen. Zuvor, im Jahr 1801, wurde Georgien Teil Russlands und 1815 das Herzogtum Warschau.
Der größte Sieg Alexanders ist jedoch der Sieg im Vaterländischen Krieg von 1812, also war er es, der die Jahre 1813-1814 anführte. Im März 1814 marschierte der Kaiser von Russland an der Spitze der Koalitionsarmeen in Paris ein und wurde auch einer der Anführer des Wiener Kongresses zur Schaffung einer neuen Ordnung in Europa. Die Popularität des russischen Kaisers war enorm, 1819 wurde er Pate der zukünftigen Königin von England, Victoria.
Tod des Kaisers
Der offiziellen Version zufolge starb Kaiser Alexander I. Romanow am 19. November 1825 in Taganrog an den Folgen einer Gehirnentzündung. Ein solch früher Tod des Kaisers löste viele Gerüchte und Legenden aus.
Im Jahr 1825 verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Frau des Kaisers stark, die Ärzte rieten zum südlichen Klima, es wurde beschlossen, nach Taganrog zu gehen, der Kaiser beschloss, seine Frau zu begleiten, zu der die Beziehungen in den letzten Jahren sehr herzlich geworden waren.
Als der Kaiser im Süden Nowotscherkassk und die Krim besuchte, erkrankte er unterwegs an einer schweren Erkältung und starb. Alexander zeichnete sich durch eine gute Gesundheit aus und wurde nie krank, daher wurde der Tod des 48-jährigen Kaisers für viele verdächtig, und viele hielten auch seinen unerwarteten Wunsch, die Kaiserin auf einer Reise zu begleiten, für verdächtig. Zudem wurde der Leichnam des Königs vor der Beerdigung dem Volk nicht gezeigt, die Verabschiedung erfolgte mit geschlossenem Sarg. Noch mehr Gerüchte wurden durch den bevorstehenden Tod der Frau des Kaisers ausgelöst – Elisabeth starb sechs Monate später.
Kaiser - alter Mann
In den Jahren 1830-1840. Der verstorbene Zar begann, mit einem gewissen alten Mann Fjodor Kusmitsch identifiziert zu werden, der in seinen Gesichtszügen dem Kaiser ähnelte und außerdem über ausgezeichnete Manieren verfügte, die für einen einfachen Landstreicher nicht charakteristisch waren. In der Bevölkerung gab es Gerüchte, dass der Doppelgänger des Kaisers begraben wurde und der Zar selbst bis 1864 unter dem Namen eines Ältesten lebte, während Kaiserin Elizaveta Alekseevna selbst auch mit der Einsiedlerin Vera der Stille identifiziert wurde.
Die Frage, ob Elder Fjodor Kuzmich und Alexander eine Person sind, ist noch nicht geklärt, nur eine genetische Untersuchung kann das „i“ auf den Punkt bringen.
Die Herrschaft Alexanders I. fiel in die Jahre des schicksalhaften Feldzugs Napoleons für ganz Europa. „Alexander“ wird mit „Sieger“ übersetzt, und der König rechtfertigte seinen stolzen Namen, den ihm seine gekrönte Großmutter Katharina II. verlieh, voll und ganz.
Wenige Monate vor der Geburt des späteren Kaisers Alexander ereignete sich in St. Petersburg die schrecklichste Überschwemmung des 18. Jahrhunderts. Das Wasser stieg über drei Meter. Alexanders Mutter, die Frau von Kaiser Pawel Petrowitsch, hatte solche Angst, dass alle Angst vor einer Frühgeburt hatten, aber nichts geschah. Alexander I. selbst sah in dieser Flut von 1777 ein gewisses Zeichen, das ihm schon vor seiner Geburt von oben gegeben wurde.
Die Erziehung des Thronfolgers wurde von seiner Großmutter Katharina II. mit Freude durchgeführt. Sie wählte selbstständig Pädagogen für ihren geliebten Enkel aus und verfasste selbst spezielle Anweisungen, wie Bildung und Ausbildung durchgeführt werden müssen. Auch Alexanders Vater, der Kaiser, wollte seinen Sohn nach seinen eigenen strengen Regeln erziehen und verlangte strikten Gehorsam. Diese Konfrontation zwischen Vater und Großmutter hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck im Charakter des jungen Alexander. Er wusste oft nicht, wem er zuhören sollte und wie er sich verhalten sollte. Diese Situation lehrte den zukünftigen Kaiser Isolation und Geheimhaltung.
Die Thronbesteigung Alexanders I. ist mit den tragischen Ereignissen im Palast verbunden. Sein Vater, Paul 1, wurde infolge einer Verschwörung erdrosselt, von der Alexander durchaus wusste. Dennoch brachte die Nachricht vom Tod seines Vaters Alexander fast in Ohnmacht. Mehrere Tage lang konnte er nicht zur Besinnung kommen und gehorchte den Verschwörern in allem. Die Herrschaft Alexanders I. begann im Jahr 1801, als er 24 Jahre alt war. Während seines gesamten weiteren Lebens wird der Kaiser von Reue gequält und in allen Nöten des Lebens wird er eine Strafe für seine Mitschuld an der Ermordung von Paulus 1 sehen.
Der Beginn der Herrschaft Alexanders I. war geprägt von der Abschaffung der bisherigen Regeln und Gesetze, die Paulus seinerzeit eingeführt hatte. Alle in Ungnade gefallenen Adligen erhielten ihre Rechte und Titel zurück. Die Priester wurden aus der Geheimkanzlei entlassen und die Geheimexpedition geschlossen, die Wahlen der Adelsvertreter wurden wieder aufgenommen.
Alexander I. sorgte sogar dafür, dass die unter Paul I. eingeführten Bekleidungsbeschränkungen abgeschafft wurden. Die Soldaten legten mit Erleichterung ihre weißen Perücken mit Zöpfen ab, und die zivilen Dienstgrade konnten wieder Westen, Frack und Rundhüte tragen.
Nach und nach schickte der Kaiser die Teilnehmer der Verschwörung vom Palast weg: einige nach Sibirien, einige in den Kaukasus.
Die Herrschaft Alexanders I. begann mit gemäßigten liberalen Reformen, deren Projekte vom Herrscher selbst und seinen jungen Freunden entwickelt wurden: Fürst Kochubey, Graf Nowosilzew, Graf Stroganow. Sie nannten ihre Aktivitäten „Komitee für öffentliche Rettung“. Kleinbürger und Kaufleute durften unbewohntes Land erhalten, das Zarskoje-Selo-Lyzeum wurde eröffnet, in verschiedenen Städten Russlands wurden Universitäten gegründet.
Ab 1808 wurde Alexanders engster Assistent Außenminister Speransky, der sich auch für aktive Staatsreformen einsetzte. Im selben Jahr ernannte der Kaiser A. A. Arakcheev, den ehemaligen Schützling von Paul 1, zum Kriegsminister. Er glaubte, dass Arakcheev „ohne Schmeichelei verraten“ wurde, und beauftragte ihn daher, Befehle zu erteilen, die er zuvor selbst gegeben hatte.
Die Regierungszeit Alexanders I. war immer noch nicht aggressiv reformistisch, daher wurden selbst aus dem Speransky-Staatsreformprojekt nur die „sichersten“ Punkte umgesetzt. Der Kaiser zeigte nicht viel Ausdauer und Konsequenz.
Das gleiche Bild zeigte sich in der Außenpolitik. Russland schloss sofort Friedensverträge mit England und Frankreich und versuchte, zwischen diesen beiden Ländern zu manövrieren. Im Jahr 1805 war Alexander I. jedoch gezwungen, eine Koalition gegen Frankreich einzugehen, da von der Versklavung ganz Europas durch Napoleon eine besondere Bedrohung auszugehen begann. Im selben Jahr erlitten die alliierten Streitkräfte (Österreich, Russland und Preußen) vernichtende Niederlagen bei Austerlitz und Friedland, was zu einer Unterzeichnung mit Napoleon führte.
Doch dieser Frieden erwies sich als sehr brüchig, und vor Russland standen der Krieg von 1812, der verheerende Brand Moskaus und die heftigste Wendeschlacht bei Borodino. Die Franzosen werden aus Russland vertrieben und die russische Armee wird siegreich durch die Länder Europas bis nach Paris vordringen. Alexander I. war dazu bestimmt, ein Befreier zu werden und eine Koalition europäischer Länder gegen Frankreich anzuführen.
Der Höhepunkt von Alexanders Ruhm war sein Einzug mit der Armee in das besiegte Paris. Die Anwohner, die dafür gesorgt hatten, dass ihre Stadt nicht niedergebrannt würde, begrüßten die russischen Truppen mit Freude und Jubel. Daher wird die Herrschaft Alexanders I. von vielen mit dem schicksalhaften Sieg über die Truppen Napoleons im Krieg von 1812 in Verbindung gebracht.
Nachdem er Bonaparte abgeschafft hatte, stoppte der Kaiser die liberalen Reformen in seinem Land. Speransky wurde aller Ämter enthoben und nach Nischni Nowgorod ins Exil geschickt. Den Grundbesitzern war es erneut gestattet, ihre Leibeigenen willkürlich und ohne Gerichtsverfahren oder Ermittlungen nach Sibirien zu verbannen. Die Universitäten unterlagen Beschränkungen ihrer Autonomie.
Gleichzeitig begannen sich sowohl in St. Petersburg als auch in Moskau aktive religiöse und mystische Organisationen zu entwickeln. Die von Katharina II. verbotenen Freimaurerlogen lebten wieder auf. Die Herrschaft Alexanders I. geriet in die Spur des Konservatismus und des Mystizismus.
Der Vorsitz der Synode wurde dem St. Petersburger Patriarchen übertragen, und der Herrscher ernannte die Mitglieder der Synode persönlich. Offiziell überwachte der Oberstaatsanwalt, ein Freund Alexanders I., die Aktivitäten der Synode. Im Jahr 1817 leitete er auch das auf Erlass des Kaisers geschaffene Ministerium für geistliche Angelegenheiten. Die Gesellschaft wurde nach und nach von immer mehr Mystik und religiöser Überhöhung erfüllt. Zahlreiche Bibelgesellschaften und Hauskirchen mit seltsamen Riten führten den Geist der Häresie ein und stellten eine ernsthafte Bedrohung für die Grundlagen des orthodoxen Glaubens dar.
Daher erklärte die Kirche der Mystik den Kampf. Diese Bewegung wurde vom Mönch Photius angeführt. Er verfolgte sorgfältig die Treffen der Mystiker, welche Bücher sie herausbrachten und welche Sprüche aus ihrer Mitte kamen. Er verfluchte öffentlich die Freimaurer und verbrannte ihre Publikationen. Kriegsminister Arakcheev unterstützte den orthodoxen Klerus in diesem Kampf, weshalb Golitsyn unter allgemeinem Druck zurücktreten musste. Allerdings machten sich in der säkularen Gesellschaft Russlands noch lange Zeit die Anklänge einer fest verankerten Mystik bemerkbar.
Alexander I. selbst begann in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend, Klöster zu besuchen und über seinen Abdankungswunsch zu sprechen. Jegliche Anklagen gegen Verschwörungen und die Gründung von Geheimgesellschaften berühren ihn nicht mehr. Er empfindet alle Ereignisse als Strafe für den Tod seines Vaters und für seine außerehelichen Affären. Er möchte in den Ruhestand gehen und sein späteres Leben der Sühne seiner Sünden widmen.
Die Herrschaft Alexanders I. endete 1825 – den Dokumenten zufolge starb er in Taganrog, wohin er mit seiner Frau zur Behandlung ging. Der Kaiser wurde in einem geschlossenen Sarg nach St. Petersburg transportiert. Augenzeugen sagten, sein Gesicht habe sich stark verändert. Gerüchten zufolge starb gleichzeitig in Taganrog ein Kurier, der Alexander im Aussehen sehr ähnlich war. Bisher glaubten viele Menschen, dass der Kaiser diese Gelegenheit nutzte, um den Thron zu verlassen und auf Wanderschaft zu gehen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht – dazu gibt es keine historischen Fakten.
Die Ergebnisse der Regierungszeit Alexanders I. lassen sich wie folgt zusammenfassen: Es war eine sehr inkonsistente Regierungszeit, in der die begonnenen liberalen Reformen durch einen strengen Konservatismus ersetzt wurden. Gleichzeitig ging Alexander I. als Befreier Russlands und ganz Europas für immer in die Geschichte ein. Er wurde verehrt und verherrlicht, bewundert und verherrlicht, aber sein eigenes Gewissen verfolgte ihn sein ganzes Leben lang.
In der Nacht vom 11. auf den 12. März 1801, als Kaiser Paul I. infolge einer Verschwörung getötet wurde, wurde die Frage der Thronbesteigung seines ältesten Sohnes Alexander Pawlowitsch auf dem russischen Thron geklärt. Er war in den Verschwörungsplan eingeweiht. Auf den neuen Monarchen wurden Hoffnungen gesetzt, liberale Reformen durchzuführen und das Regime der persönlichen Macht aufzuweichen.
Kaiser Alexander I. wuchs unter der Aufsicht seiner Großmutter Katharina II. auf. Er war mit den Ideen der Aufklärung vertraut – Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Allerdings trennte Alexander Pawlowitsch nie die Gedanken an Gleichheit und Freiheit von der Autokratie. Diese Halbherzigkeit wurde zu einem Merkmal sowohl der Transformationen als auch der Herrschaft Kaiser Alexanders I.
Seine allerersten Manifeste zeugten von der Annahme eines neuen politischen Kurses. Es verkündete den Wunsch, nach den Gesetzen Katharinas II. zu regieren, die Handelsbeschränkungen mit England aufzuheben, enthielt die Ankündigung einer Amnestie und die Wiedereinsetzung der unter Paul I. unterdrückten Personen.
Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Lebens konzentrierten sich auf die sogenannte. Das Geheimkomitee, in dem sich Freunde und Mitarbeiter des jungen Kaisers versammelten – P. A. Stroganov, V. P. Kochubey, A. Czartorysky und N. N. Novosiltsev – Anhänger des Konstitutionalismus. Das Komitee bestand bis 1805. Es beschäftigte sich hauptsächlich mit der Ausarbeitung eines Programms zur Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft und der Reform des Staatssystems. Das Ergebnis dieser Tätigkeit war das Gesetz vom 12. Dezember 1801, das es Staatsbauern, Bürgern und Kaufleuten ermöglichte, unbewohntes Land zu erwerben, und das Dekret vom 20. Februar 1803 „Über freie Landwirte“, das den Grundbesitzern das Recht einräumte, auf ihre Kosten zu kommen Antrag, die Bauern in das Testament zu entlassen und ihnen Land als Lösegeld zu überlassen.
Eine schwerwiegende Reform war die Neuorganisation der höchsten und zentralen Regierungsorgane. Im Land wurden Ministerien eingerichtet: die militärischen Bodentruppen, Finanzen und öffentliche Bildung, die Staatskasse und das Ministerkomitee, die eine einzige Struktur erhielten und nach dem Prinzip der Ein-Mann-Führung aufgebaut waren. Seit 1810 nahm der Staatsrat nach dem Projekt des damals prominenten Staatsmannes M. M. Speransky seine Tätigkeit auf. Speransky konnte jedoch kein konsequentes Prinzip der Gewaltenteilung durchsetzen. Der Staatsrat wurde von einem zwischengeschalteten Gremium zu einer von oben ernannten gesetzgebenden Kammer. Die Reformen des frühen 19. Jahrhunderts hatten keinen Einfluss auf die Grundlagen der autokratischen Macht im Russischen Reich.
Unter Alexander I. erhielt das von Russland annektierte Königreich Polen eine Verfassung. Das Verfassungsgesetz wurde auch der Region Bessarabien gewährt. Finnland, das ebenfalls Teil Russlands wurde, erhielt seine gesetzgebende Körperschaft – den Sejm – und die Verfassungsstruktur.
So existierte auf einem Teil des Territoriums des Russischen Reiches bereits eine verfassungsmäßige Regierung, was Hoffnungen auf eine Ausbreitung im ganzen Land weckte. Im Jahr 1818 begann sogar die Entwicklung der Charta des Russischen Reiches, aber dieses Dokument erblickte nie das Licht der Welt.
Im Jahr 1822 verlor der Kaiser das Interesse an Staatsangelegenheiten, die Arbeit an Reformen wurde eingeschränkt und unter den Beratern Alexanders I. stach die Figur eines neuen Zeitarbeiters hervor – A.A. Arakcheev, der nach dem Kaiser die erste Person im Staat wurde und regierte als übermächtiger Favorit. Die Folgen der Reformaktivitäten Alexanders I. und seiner Berater waren unbedeutend. Der unerwartete Tod des Kaisers im Jahr 1825 im Alter von 48 Jahren wurde zum Anlass für offenes Handeln des fortschrittlichsten Teils der russischen Gesellschaft, der sogenannten. Dekabristen, gegen die Grundlagen der Autokratie.
Vaterländischer Krieg von 1812
Während der Herrschaft Alexanders I. gab es für ganz Russland eine schreckliche Prüfung – den Befreiungskrieg gegen die napoleonische Aggression. Der Krieg wurde durch den Wunsch der französischen Bourgeoisie nach Weltherrschaft, eine scharfe Verschärfung der russisch-französischen wirtschaftlichen und politischen Widersprüche im Zusammenhang mit den Angriffskriegen Napoleons I. und die Weigerung Russlands, sich an der Kontinentalblockade Großbritanniens zu beteiligen, verursacht. Das 1807 in der Stadt Tilsit geschlossene Abkommen zwischen Russland und dem napoleonischen Frankreich war vorübergehender Natur. Dies wurde sowohl in St. Petersburg als auch in Paris verstanden, obwohl viele Würdenträger beider Länder für die Wahrung des Friedens waren. Allerdings häuften sich die Widersprüche zwischen den Staaten immer weiter, was zu offenen Konflikten führte.
Am 12. (24.) Juni 1812 überquerten etwa 500.000 napoleonische Soldaten den Fluss Neman und
überfiel Russland. Napoleon lehnte den Vorschlag Alexanders I. ab, den Konflikt friedlich zu lösen, wenn er seine Truppen abzieht. So begann der Vaterländische Krieg, der so genannt wurde, weil nicht nur die reguläre Armee gegen die Franzosen kämpfte, sondern fast die gesamte Bevölkerung des Landes in den Milizen und Partisanenabteilungen.
Die russische Armee bestand aus 220.000 Menschen und war in drei Teile geteilt. Die erste Armee – unter dem Kommando von General M. B. Barclay de Tolly – befand sich in Litauen, die zweite – General Fürst P. I. Bagration – in Weißrussland und die dritte Armee – General A. P. Tormasov – in der Ukraine. Napoleons Plan war äußerst einfach und bestand darin, die russischen Armeen Stück für Stück mit mächtigen Schlägen zu besiegen.
Die russischen Armeen zogen sich in parallelen Richtungen nach Osten zurück, wobei sie ihre Kräfte schonten und den Feind in Nachhutkämpfen erschöpften. Am 2. August (14) vereinigten sich die Armeen von Barclay de Tolly und Bagration in der Region Smolensk. Hier verloren die französischen Truppen in einer schwierigen zweitägigen Schlacht 20.000 Soldaten und Offiziere, die Russen bis zu 6.000 Menschen.
Der Krieg nahm eindeutig einen langwierigen Charakter an, die russische Armee setzte ihren Rückzug fort und zog den Feind hinter sich ins Landesinnere. Ende August 1812 wurde anstelle des Kriegsministers M. B. Barclay de Tolly ein Schüler und Kollege von A. V. Suworow, M. I. Kutusow, zum Oberbefehlshaber ernannt. Alexander I., der ihn nicht mochte, musste die patriotische Stimmung des russischen Volkes und der Armee sowie die allgemeine Unzufriedenheit mit der von Barclay de Tolly gewählten Rückzugstaktik berücksichtigen. Kutusow beschloss, der französischen Armee im Gebiet des Dorfes Borodino, 124 km westlich von Moskau, eine allgemeine Schlacht zu liefern.
Am 26. August (7. September) begann die Schlacht. Die russische Armee stand vor der Aufgabe, den Feind zu erschöpfen, seine Kampfkraft und Moral zu schwächen und im Erfolgsfall selbst eine Gegenoffensive zu starten. Kutusow wählte eine sehr gute Position für die russischen Truppen. Die rechte Flanke wurde durch eine natürliche Barriere – den Fluss Koloch – geschützt, und die linke – durch künstliche Erdbefestigungen – von Bagrations Truppen besetzte Spülungen. Im Zentrum standen die Truppen von General N.N. Raevsky sowie Artilleriestellungen. Napoleons Plan sah einen Durchbruch in der Verteidigung der russischen Truppen im Bereich der Bagrationowski-Flüsse und die Einkreisung der Kutusow-Armee vor, und als sie gegen den Fluss gedrückt wurde, ihre völlige Niederlage.
Die Franzosen unternahmen acht Angriffe gegen die Flushes, konnten sie jedoch nicht vollständig erobern. Es gelang ihnen nur, in der Mitte leicht vorzudringen, wodurch Raevskys Batterien zerstört wurden. Mitten in der Schlacht in zentraler Richtung unternahm die russische Kavallerie einen gewagten Angriff hinter die feindlichen Linien, der in den Reihen der Angreifer Panik auslöste.
Napoleon wagte es nicht, seine Hauptreserve – die alte Garde – einzusetzen, um das Blatt in der Schlacht zu wenden. Die Schlacht von Borodino endete am späten Abend und die Truppen zogen sich auf ihre zuvor besetzten Stellungen zurück. Somit war die Schlacht ein politischer und moralischer Sieg für die russische Armee.
Am 1. September (13) in Fili beschloss Kutusow bei einer Sitzung des Führungsstabs, Moskau zu verlassen, um die Armee zu retten. Napoleonische Truppen marschierten in Moskau ein und blieben dort bis Oktober 1812. In der Zwischenzeit führte Kutusow seinen Plan namens Tarutino-Manöver aus, durch den Napoleon die Fähigkeit verlor, die russischen Einsatzorte zu verfolgen. Im Dorf Tarutino wurde Kutusows Armee mit 120.000 Mann aufgefüllt und ihre Artillerie und Kavallerie deutlich verstärkt. Darüber hinaus versperrte sie den französischen Truppen tatsächlich den Weg nach Tula, wo sich die wichtigsten Waffenarsenale und Lebensmitteldepots befanden.
Während ihres Aufenthalts in Moskau wurde die französische Armee durch Hunger, Plünderungen und Brände, die die Stadt verwüsteten, demoralisiert. In der Hoffnung, seine Arsenale und Lebensmittelvorräte wieder aufzufüllen, musste Napoleon seine Armee aus Moskau abziehen. Auf dem Weg nach Maloyaroslavets erlitt Napoleons Armee am 12. (24.) Oktober eine schwere Niederlage und begann sich aus Russland entlang der bereits von den Franzosen selbst zerstörten Smolensk-Straße zurückzuziehen.
In der Endphase des Krieges bestand die Taktik der russischen Armee in der parallelen Verfolgung des Feindes. Russische Truppen, nein
Sie kämpften gegen Napoleon und zerstörten seine sich zurückziehende Armee in Teilen. Auch die Franzosen litten stark unter den Winterfrösten, auf die sie nicht vorbereitet waren, da Napoleon erwartete, den Krieg vor der Kälte zu beenden. Der Höhepunkt des Krieges von 1812 war die Schlacht am Fluss Beresina, die mit der Niederlage der napoleonischen Armee endete.
Am 25. Dezember 1812 veröffentlichte Kaiser Alexander I. in St. Petersburg ein Manifest, in dem es hieß, dass der Vaterländische Krieg des russischen Volkes gegen die französischen Invasoren mit einem vollständigen Sieg und der Vertreibung des Feindes endete.
Die russische Armee nahm an den Auslandsfeldzügen von 1813-1814 teil, bei denen sie zusammen mit der preußischen, schwedischen, englischen und österreichischen Armee den Feind in Deutschland und Frankreich vernichtete. Der Feldzug von 1813 endete mit der Niederlage Napoleons in der Schlacht bei Leipzig. Nach der Einnahme von Paris durch die Alliierten im Frühjahr 1814 dankte Napoleon I. ab.
Dekabristenbewegung
Das erste Viertel des 19. Jahrhunderts in der Geschichte Russlands wurde zur Zeit der Entstehung der revolutionären Bewegung und ihrer Ideologie. Nach den Auslandsfeldzügen der russischen Armee begannen fortschrittliche Ideen in das Russische Reich einzudringen. Die ersten geheimen revolutionären Organisationen des Adels entstanden. Die meisten von ihnen waren Militäroffiziere der Garde.
Die erste geheime politische Gesellschaft wurde 1816 in St. Petersburg unter dem Namen „Union der Erlösung“ gegründet und im folgenden Jahr in „Gesellschaft der wahren und treuen Söhne des Vaterlandes“ umbenannt. Seine Mitglieder waren die zukünftigen Dekabristen A. I. Muravyov, M. I. Muravyov-Apostol, P. I. Pestel, S. P. Trubetskoy und andere. Rechte. Allerdings war diese Gesellschaft zahlenmäßig noch klein und konnte die Aufgaben, die sie sich stellte, nicht verwirklichen.
Im Jahr 1818 wurde auf der Grundlage dieser sich selbst liquidierenden Gesellschaft eine neue gegründet – die Wohlfahrtsunion. Es handelte sich bereits um eine zahlreicher werdende Geheimorganisation mit mehr als 200 Personen. Es wurde von F. N. Glinka, F. P. Tolstoi, M. I. Muravyov-Apostol organisiert. Die Organisation hatte einen verzweigten Charakter: Ihre Zellen wurden in Moskau, St. Petersburg, Nischni Nowgorod, Tambow im Süden des Landes gegründet. Die Ziele der Gesellschaft blieben dieselben – die Einführung einer repräsentativen Regierung, die Beseitigung von Autokratie und Leibeigenschaft. Die Mitglieder der Union sahen Wege, ihr Ziel in der Propaganda ihrer Ansichten und Vorschläge an die Regierung zu erreichen. Sie erhielten jedoch nie eine Antwort.
All dies veranlasste radikale Mitglieder der Gesellschaft, zwei neue Geheimorganisationen zu gründen, die im März 1825 gegründet wurden. Eine wurde in St. Petersburg gegründet und hieß „Northern Society“. Seine Schöpfer waren N. M. Muravyov und N. I. Turgenev. Der andere stammt aus der Ukraine. Diese „Southern Society“ wurde von P. I. Pestel geleitet. Beide Gesellschaften waren miteinander verbunden und bildeten eigentlich eine einzige Organisation. Jede Gesellschaft hatte ihr eigenes Programmdokument, die nördliche hatte die „Verfassung“ von N. M. Muravyov und die südliche hatte die „Russische Wahrheit“ von P. I. Pestel.
Diese Dokumente brachten ein einziges Ziel zum Ausdruck – die Zerstörung der Autokratie und der Leibeigenschaft. Die „Verfassung“ drückte jedoch den liberalen Charakter der Reformen aus – mit einer konstitutionellen Monarchie, Einschränkung des Wahlrechts und der Wahrung des Grundbesitzes, und „Russische Wahrheit“ – radikal, republikanisch. Es proklamierte eine Präsidialrepublik, die Beschlagnahmung des Landes der Grundbesitzer und eine Kombination aus privatem und öffentlichem Eigentum.
Die Verschwörer planten ihren Putsch im Sommer 1826 während einer Armeeübung. Doch unerwartet starb Alexander I. am 19. November 1825, und dieses Ereignis veranlasste die Verschwörer, vorzeitig Maßnahmen zu ergreifen.
Nach dem Tod Alexanders I. sollte sein Bruder Konstantin Pawlowitsch russischer Kaiser werden, doch zu Lebzeiten Alexanders I. dankte er zugunsten seines jüngeren Bruders Nikolaus ab. Dies wurde nicht offiziell bekannt gegeben, so dass zunächst sowohl der Staatsapparat als auch die Armee Konstantin die Treue schworen. Doch bald wurde Konstantins Verzicht auf den Thron öffentlich gemacht und eine erneute Vereidigung angeordnet. Deshalb
Am 14. Dezember 1825 beschlossen die Mitglieder der „Northern Society“, die in ihrem Programm festgelegten Forderungen vorzubringen, wofür sie eine Demonstration militärischer Gewalt in der Nähe des Senatsgebäudes abhalten wollten. Eine wichtige Aufgabe bestand darin, die Senatoren daran zu hindern, Nikolai Pawlowitsch den Eid zu leisten. Prinz S.P. Trubetskoy wurde zum Anführer des Aufstands ernannt.
Am 14. Dezember 1825 kam das Moskauer Regiment unter der Führung der Brüder Bestuschew und Schtschepin-Rostowski, Mitglieder der „Nördlichen Gesellschaft“, als erstes auf den Senatsplatz. Das Regiment stand jedoch lange Zeit allein, die Verschwörer waren untätig. Die Ermordung des Generalgouverneurs von St. Petersburg M.A. Miloradovich, der zu den Rebellen ging, endete tödlich – der Aufstand konnte nicht mehr friedlich enden. Gegen Mittag schlossen sich die Marinebesatzung der Garde und eine Kompanie des Life-Grenadier-Regiments dennoch den Rebellen an.
Die Führer zögerten immer noch, aktive Operationen aufzunehmen. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die Senatoren bereits Nikolaus I. die Treue geschworen und den Senat verlassen hatten. Daher war niemand da, der das Manifest vorstellte, und Fürst Trubetskoi erschien nicht auf dem Platz. Unterdessen begannen regierungstreue Truppen, die Rebellen zu beschießen. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, es kam zu Verhaftungen. Mitglieder der „Southern Society“ versuchten Anfang Januar 1826 einen Aufstand (den Aufstand des Tschernigow-Regiments) durchzuführen, doch auch dieser wurde von den Behörden brutal niedergeschlagen. Fünf Anführer des Aufstands – P.I. Pestel, K.F. Ryleev, S.I. Muravyov-Apostol, M.P. Bestuzhev-Ryumin und P.G.
Der Aufstand der Dekabristen war der erste offene Protest in Russland, der sich eine radikale Neuordnung der Gesellschaft zur Aufgabe machte.
Alexander I. Pawlowitsch (geb. 12. Dezember (23) 1777 – Tod 19. November (1. Dezember 1825)) – Kaiser und Autokrat von ganz Russland (seit 12. März (24) 1801), ältester Sohn von Kaiser Paul I. und Maria Fjodorowna.
Tod von Paul 1
Als am Morgen des 12. März 1801 die Nachricht vom Tod des Herrschers blitzschnell durch Petersburg verbreitete, kannte die Freude und der Jubel des Volkes keine Grenzen. „Auf den Straßen“, so das Zeugnis eines seiner Zeitgenossen, „weinten die Menschen vor Freude und umarmten sich wie am Tag der Heiligen Auferstehung Christi.“ Diese allgemeine Freude wurde nicht so sehr dadurch verursacht, dass die schwierige Zeit der Herrschaft des verstorbenen Kaisers unwiderruflich vorüber war, sondern dadurch, dass der von ihm selbst erzogene, verehrte Erbe des Paulus, Alexander I., den Thron bestieg.
Erziehung. Alexanders Ausbildung
Als Großherzog Paul 1 Petrowitsch einen Sohn bekam – den erstgeborenen Alexander, kümmerte sich Katharina 2 vom ersten Lebensjahr ihres Enkels an um seine Erziehung. Sie selbst begann bei ihm und seinem anderthalb Jahre später geborenen Bruder Konstantin zu lernen, sie selbst stellte das Alphabet für die Kinder zusammen, schrieb mehrere Märchen und schließlich einen kleinen Leitfaden zur russischen Geschichte. Als der Enkel Alexander heranwuchs, ernannte die Kaiserin Graf N.I. Saltykova und die Lehrer wurden aus den gebildetsten Menschen dieser Zeit ausgewählt - M.N. Murawjow, ein berühmter Schriftsteller, und Pallas, ein berühmter Wissenschaftler. Erzpriester Samborsky lehrte Alexander das Gesetz Gottes und inspirierte den Schüler in seinen Lektionen dazu, „in jedem menschlichen Zustand seinen Nächsten zu finden“.
Da Katharina Alexander auf den Thron vorbereitete und sogar die Absicht hatte, ihren Sohn zu umgehen, kümmerte sie sich bald darum, ihrem geliebten Enkel eine solide Ausbildung in Rechtswissenschaften zu ermöglichen, die für den zukünftigen Herrscher einer Großmacht äußerst notwendig war. Der Schweizer Laharpe, ein Mann mit edler Seele, erfüllt von tiefer Liebe zu den Menschen und dem Streben nach Wahrheit, Güte und Gerechtigkeit, wurde eingeladen, sie zu unterrichten. Laharpe konnte den vorteilhaftesten Einfluss auf den zukünftigen Kaiser ausüben. Anschließend sagte Alexander zu La Harpes Frau: „Alles, was die Menschen mir schenken, verdanke ich meinem Lehrer und Mentor, Ihrem Ehemann.“ Zwischen dem Lehrer und dem Schüler entwickelten sich bald aufrichtige freundschaftliche Beziehungen, die bis zum Tod von La Harpe bestehen blieben.
Privatleben
Leider endete die Erziehung des zukünftigen Kaisers recht früh, als er noch keine 16 Jahre alt war. In diesem jungen Alter war er bereits auf Wunsch Katharinas mit einer 14-jährigen badischen Prinzessin verheiratet, die nach der Annahme der Orthodoxie, Elizaveta Alekseevna, benannt wurde. Alexanders Frau zeichnete sich durch einen sanften Charakter, unendliche Freundlichkeit gegenüber den Leidenden und ein äußerst attraktives Aussehen aus. Aus seiner Ehe mit Elizaveta Alekseevna hatte Alexander zwei Töchter, Maria und Elizaveta, die jedoch beide im frühen Kindesalter starben. Daher wurden nicht die Kinder Alexanders Thronfolger, sondern sein jüngerer Bruder.
Aufgrund der Tatsache, dass seine Frau seinen Sohn nicht zur Welt bringen konnte, kühlte sich das Verhältnis zwischen dem Herrscher und seiner Frau stark ab. Er versteckte seine Liebesbeziehungen nebenbei praktisch nicht. Zunächst lebte der Kaiser fast 15 Jahre lang mit Maria Naryshkina zusammen, der Frau des Oberjägermeisters Dmitri Naryshkin, die alle Höflinge in seinen Augen „einen vorbildlichen Hahnrei“ nannten. Maria gebar sechs Kinder, wobei die Vaterschaft von fünf von ihnen üblicherweise Alexander zugeschrieben wird. Die meisten dieser Kinder starben jedoch im Säuglingsalter. Der Herrscher hatte auch eine Affäre mit der Tochter des Hofbankiers Sophie Velho und mit Sophia Vsevolozhskaya, die ihm seinen unehelichen Sohn Nikolai Lukash, einen General und Kriegshelden, zur Welt brachte.

Ehefrau Elizaveta Alekseevna und Favoritin Maria Naryshkina
Thronbesteigung
Bei der Thronbesteigung kündigte Alexander I. in einem Manifest an, dass er den Staat „nach den Gesetzen und dem Herzen“ seiner Urgroßmutter Katharina II. regieren werde: „Ja, ihren weisen Absichten folgend“, versprach der neue Kaiser in seinem Manifest Im ersten Manifest heißt es: „Wir werden es schaffen, Russland zu höchstem Ruhm zu erheben und allen unseren treuen Untertanen unantastbare Glückseligkeit zu schenken.“
Die allerersten Tage der neuen Herrschaft waren von großen Wohltaten geprägt. Tausende von Menschen, die unter Paulus ins Exil geschickt wurden, wurden zurückgebracht, Tausende andere erhielten ihre bürgerlichen und offiziellen Rechte zurück. Die körperliche Züchtigung für Adlige, Kaufleute und Geistliche wurde abgeschafft, die Folter wurde für immer abgeschafft.
Innenpolitik. Transformationen. Reformen
Bald begannen radikale Veränderungen in der Staatsverwaltung selbst. 8. September 1802 – Ministerien werden gegründet. Für eine perfektere Entwicklung gesetzgeberischer Fragen bildete der Herrscher ein Unausgesprochenes Komitee, dem Freunde aus Alexanders Jugend angehörten, Personen, die das besondere Vertrauen des Kaisers genossen: N.N. Novosiltsev, Fürst Adam Czartoryski, Graf P.A. Stroganov und Graf V.P. Kochubey. Dem Ausschuss wurde die Aufgabe übertragen, Gesetzesentwürfe zur Umgestaltung des gesamten russischen National- und Staatslebens auszuarbeiten.
Zu seinem engsten Mitarbeiter wählte der Kaiser den berühmten Michail Michailowitsch Speranski, den späteren Grafen. Speransky war der Sohn eines einfachen Priesters. Nach seinem Abschluss an der St. Petersburger Theologischen Akademie nahm er eine Lehrtätigkeit an dieser Bildungseinrichtung an und wechselte anschließend in den öffentlichen Dienst, wo er sich mit seiner enormen Arbeitsfähigkeit und seinem umfangreichen Wissen schnell weiterentwickeln konnte.
Im Auftrag des Souveräns erstellte Speransky einen kohärenten Plan für Reformen in Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichten, dessen Hauptmerkmal die Zulassung der Beteiligung der Volksvertretung an allen Bereichen des öffentlichen Lebens war. Da der Kaiser jedoch erkannte, dass die Bevölkerung Russlands noch nicht reif für die Teilnahme an staatlichen Aktivitäten war, begann er nicht mit der Umsetzung des gesamten Speransky-Plans, sondern führte nur einige Teile davon aus. So wurde am 1. Januar 1810 der Staatsrat im Beisein Alexanders selbst eröffnet, der in seiner Eröffnungsrede unter anderem sagte: „Beschütze das Reich mit guten Gesetzen.“
Einmal in der Woche nahm Alexander I. persönlich an den Sitzungen des Rates teil, und Speransky berichtete ihm über die Fälle, die in den verbleibenden Sitzungen behandelt wurden.

Porträts des Großfürsten Alexander Pawlowitsch (jung)
Außenpolitik
Nach der Thronbesteigung war eines der grundlegendsten Anliegen des Souveräns die Errichtung der Außenwelt Russlands, die in den vorangegangenen Regierungszeiten durch Kriege erschöpft war. Alles Mögliche wurde in diese Richtung getan, und eine Zeit lang, wenn auch nur für kurze Zeit, herrschte nicht nur in Russland, sondern in ganz Europa Frieden.
Die europäischen politischen Beziehungen waren jedoch so, dass Russland bereits 1805 trotz der Friedfertigkeit seines Kaisers gezwungen war, am Kampf der europäischen Mächte mit Frankreich teilzunehmen, angeführt vom großen Eroberer, der seinen Aufstieg von einem einfachen Offizier begründete an einen riesigen Kaiser über Siege. Mächte. Alexander I. begann einen Kampf mit ihm, schloss ein Bündnis mit Österreich und England und begann, selbst militärische Operationen zu leiten. Der Krieg endete für die Alliierten erfolglos. Mehrmals besiegte Napoleon die österreichischen Truppen und traf dann am 20. November 1805 auf den Feldern von Austerlitz auf die alliierte russisch-österreichische Armee, zu der auch die beiden Kaiser Alexander und Franz gehörten. In einer verzweifelten Schlacht ging Napoleon als Sieger hervor. Österreich beeilte sich, mit ihm Frieden zu schließen, und die russische Armee kehrte nach Hause zurück.
Im nächsten Jahr wurden die Feindseligkeiten gegen Napoleon jedoch wieder aufgenommen. Diesmal befand sich Russland im Bündnis mit Preußen, das sich versehentlich beeilte, einen Kampf zu beginnen, ohne auf die Ankunft russischer Truppen zu warten. In der Nähe von Jena und Auerstedt besiegte Napoleon die preußische Armee, besetzte die Hauptstadt Preußens, Berlin, und nahm alle Ländereien dieses Staates in Besitz. Die russische Armee war gezwungen, alleine zu agieren. In der großen Schlacht bei Preußisch-Eylau scheiterte Napoleon, der die russische Armee angriff, konnte aber 1807 die Russen bei Friedland besiegen.
Der Krieg endete mit einem Treffen zwischen Napoleon und Alexander in Tilsit auf einem Floß mitten auf dem Fluss Neman. Zwischen Frankreich und Russland wurde ein Frieden geschlossen, wonach Russland das von Bonaparte gegen England erfundene Kontinentalsystem akzeptieren sollte – sich keine englischen Waren erlauben und überhaupt keine Handelsbeziehungen mit England unterhalten sollte. Dafür erhielt Russland die Region Bialystok und Handlungsfreiheit in Osteuropa.

Napoleon und Kaiser Alexander 1 – ein Date in Tilsit
Vaterländischer Krieg - 1812
Der Frieden von Tilsit erwies sich als brüchig. Weniger als zwei Jahre später kam es erneut zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Russland und Frankreich. Der Krieg war unvermeidlich und bald brach er aus – sobald Napoleon alle Vorbereitungen dafür abgeschlossen hatte.
Um Russland zu zerstören, versammelte Napoleon die ihm unterworfenen Streitkräfte fast ganz Europas und marschierte an der Spitze einer 600.000 Mann starken Armee am 12. (24.) Juni 1812 in die russischen Grenzen ein. Der Vaterländische Krieg begann, der Alexander und Russland verherrlichte und zum Sturz Napoleons führte.
Russland, angeführt von Alexander I., konnte nicht nur seine staatliche Existenz verteidigen, sondern befreite anschließend ganz Europa von der Macht des bis dahin unbesiegbaren Eroberers.
1. Januar 1813 – Die russische Armee marschierte unter dem Kommando des Kaisers und Kutusows in das von Napoleon geschaffene Herzogtum Warschau ein, befreite es von den Überresten der „Großen Armee“ und zog nach Preußen, wo sie auf Volksjubel stieß . Der preußische König ging sofort ein Bündnis mit Alexander ein und stellte seine Armee unter das Kommando von Kutusow. Unglücklicherweise verstarb Letzterer bald an den Folgen seiner Mühen und wurde von ganz Russland bitter betrauert.
Napoleon, der hastig eine neue Armee zusammenstellte, griff die Verbündeten bei Lützen an und besiegte sie. In der zweiten Schlacht bei Bautzen waren die Franzosen erneut siegreich. In der Zwischenzeit beschloss Österreich, sich Russland und Preußen anzuschließen und ihnen seine Armee zu Hilfe zu schicken. Bei Dresden kam es zu einer Schlacht zwischen mittlerweile drei alliierten Armeen und der Armee Napoleons, die die Schlacht erneut gewinnen konnte. Dies war jedoch sein letzter Erfolg. Zuerst im Kulmtal und dann in einer hartnäckigen Schlacht bei Leipzig, an der mehr als eine halbe Million Menschen teilnahmen und die in der Geschichte als „Völkerschlacht“ bezeichnet wird, wurden die Franzosen besiegt. Dieser Niederlage folgte die Abdankung Napoleons und sein Umzug auf die Insel Elba.
Alexander wurde zum Schiedsrichter über die Geschicke Europas, zu seinem Befreier von der napoleonischen Macht. Als er am 13. Juli nach St. Petersburg zurückkehrte, forderten ihn Senat, Synode und Staatsrat einstimmig auf, den Namen „Seliger“ anzunehmen und ihm zu Lebzeiten die Errichtung eines Denkmals zu gestatten. Letzteres lehnte der Herrscher ab und erklärte: „Möge mir in deinen Gefühlen ein Denkmal errichtet werden, wie es in meinen Gefühlen für dich errichtet wurde!“

Wiener Kongress
1814 - Der Wiener Kongress fand statt, bei dem die europäischen Staaten in ihre früheren Besitztümer zurückversetzt wurden, die durch die Eroberungen der Franzosen verletzt worden waren, und Russland erhielt zur Befreiung Europas fast das gesamte Herzogtum Warschau, das sogenannte Königreich Polen . 1815 – Napoleon verließ die Insel Elba, kam in Frankreich an und wollte den Thron zurückerobern. Doch bei Waterloo wurde er von den Briten und Preußen besiegt und dann nach St. Helena im Atlantischen Ozean verbannt.
In der Zwischenzeit hatte Alexander I. die Idee, aus den Herrschern der christlichen Völker eine Heilige Union zu bilden, um ganz Europa auf der Grundlage der Wahrheiten des Evangeliums zu vereinen und die zerstörerische revolutionäre Gärung der Massen zu bekämpfen. Gemäß den Bedingungen dieses Bündnisses beteiligte sich Alexander in den folgenden Jahren aktiv an der Niederschlagung von Volksaufständen, die hin und wieder in verschiedenen Teilen Europas auftraten.
Letzte Regierungsjahre
Der Vaterländische Krieg hatte einen starken Einfluss auf den Charakter und die Ansichten des Kaisers, und die zweite Hälfte seiner Regierungszeit ähnelte kaum der ersten. In der Verwaltung des Staates wurden keine Änderungen vorgenommen. Alexander wurde nachdenklich, hörte fast auf zu lächeln, wurde seiner Position als Monarch überdrüssig und äußerte mehrmals sogar seine Absicht, auf den Thron zu verzichten und sich ins Privatleben zurückzuziehen.
In den letzten Jahren seiner Herrschaft war Graf A.A. Arakcheev, der der einzige Sprecher des Souveräns für alle Verwaltungsangelegenheiten wurde. Arakcheev war auch sehr religiös, und diese Eigenschaft brachte ihn dem Herrscher noch näher.
In Russland herrschte am Ende der Herrschaft Unruhe. In einigen Teilen der Truppe herrschte Gärung unter den Offizieren, die in zahlreichen Feldzügen in Europa gewesen waren und dort neue Vorstellungen von der Staatsordnung gelernt hatten. Der Souverän erhielt sogar Informationen über die Existenz einer Verschwörung, die darauf abzielte, die Form der obersten Regierung in Russland zu ändern. Da der Herrscher jedoch von all der Mühe und Unruhe erschöpft war, ergriff er keine Maßnahmen gegen die Verschwörer.
Ende 1825 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Kaiserin Elizaveta Alekseevna so sehr, dass die Ärzte ihr rieten, den Winter nicht in St. Petersburg zu bleiben, sondern nach Süden zu gehen. Als Sitz der Kaiserin wurde Taganrog gewählt, wo Alexander beschloss, früher abzureisen, um die notwendigen Vorbereitungen für die Ankunft seiner Frau zu treffen, und am 1. September verließ er Petersburg.
Tod von Alexander 1
Das Leben im warmen südlichen Klima wirkte sich positiv auf die Gesundheit von Elizaveta Alekseevna aus. Der Souverän nutzte dies und verließ Taganrog, um benachbarte Orte am Asowschen Meer zu besuchen und durch die Krim zu reisen. Am 5. November kehrte er völlig krank nach Taganrog zurück, nachdem er sich auf einer Reise durch die Krim eine schwere Erkältung zugezogen hatte, lehnte jedoch die Hilfe von Ärzten ab. Bald begann sein Gesundheitszustand sein Leben zu gefährden. Der Herrscher nahm an den Heiligen Mysterien teil und spürte das Herannahen des Todes. Seine Frau, die immer bei ihm war, flehte ihn an, Ärzte zuzulassen, diesmal stimmte der Kaiser zu, ihre Hilfe anzunehmen, aber es war zu spät: Der Körper war durch die Krankheit so geschwächt, dass Alexander 1. am 19. November um 11 Uhr morgens starb Der Gesegnete starb leise.
Die Asche des Herrschers wurde nach St. Petersburg überführt und am 13. März 1826 in der Peter-und-Paul-Kathedrale beigesetzt.
Alexander Pawlowitsch Romanow wurde am 12. Dezember 1777 in St. Petersburg geboren. Er war der Lieblingsenkel Katharinas II. und der älteste Sohn des Thronfolgers Paul. Das Kind hatte ein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater und wurde daher von einer gekrönten Großmutter großgezogen.
Thronfolger
Zu dieser Zeit waren die Ideen der Aufklärung und des Humanismus populär. Ihnen zufolge wurde auch Alexander 1 erzogen. Eine kurze Biographie des zukünftigen Monarchen enthielt Lehren, die auf der Arbeit von Rousseau basierten. Gleichzeitig brachte der Vater dem Kind militärische Angelegenheiten bei.
Im Jahr 1793 heiratete der junge Mann eine deutsche Prinzessin, die bei der Taufe einen Namen erhielt. Anschließend diente er in den von Paulus geschaffenen Gatschina-Truppen. Mit dem Tod Katharinas wurde der Vater Kaiser und Alexander sein Erbe. Um sich an die öffentlichen Angelegenheiten zu gewöhnen, wurde Alexander zum Mitglied des Senats ernannt.
Alexander I., dessen kurze Biografie voller aufklärerischer Ideen war, war mit seinen Ansichten unendlich weit von seinem Vater entfernt. Paul stritt oft mit seinem Sohn und zwang ihn sogar mehrmals, Treue zu schwören. Der Kaiser hatte wahnsinnige Angst vor Verschwörungen, die im 18. Jahrhundert weit verbreitet waren.
Am 12. März 1801 wurde in St. Petersburg eine Gruppe von Adligen gegründet, in deren Zentrum sich befand. Bisher streiten Forscher darüber, ob Alexander von den Plänen der Verschwörer wusste. So oder so, aber es ist sicher bekannt, dass dies dem Erben gemeldet wurde, als Paulus getötet wurde. So wurde er Kaiser von Russland.

Reformen
Die ersten Regierungsjahre der Politik Alexanders I. waren ausschließlich auf die innere Umgestaltung des Landes ausgerichtet. Der erste Schritt war eine umfassende Amnestie. Während der Herrschaft des Paulus befreite sie viele Freidenker und Opfer. Unter ihnen war derjenige, der sein Testament zur Veröffentlichung des Aufsatzes „Reise von St. Petersburg nach Moskau“ verlor.
Alexander verließ sich künftig auf die Meinung adliger Mitarbeiter, die ein Geheimkomitee bildeten. Unter ihnen waren Freunde der Jugend des Kaisers – Pavel Stroganov, Viktor Kochubey, Adam Czartoryski usw.
Die Reformen zielten darauf ab, die Leibeigenschaft zu schwächen. Im Jahr 1803 erschien ein Erlass, nach dem die Grundbesitzer nun auch ihre Bauern zusammen mit dem Land freigeben konnten. Die patriarchalischen Ordnungen Russlands erlaubten Alexander nicht, entschiedenere Schritte zu unternehmen. Die Adligen konnten sich den Veränderungen widersetzen. Doch der Herrscher verbot erfolgreich die Leibeigenschaft in den baltischen Staaten, wo die russische Ordnung fremd war.
Auch die Reformen von Alexander 1 trugen zur Entwicklung des Bildungswesens bei. Die Moskauer Staatsuniversität erhielt zusätzliche Mittel. Es wurde auch eröffnet (der junge Alexander Puschkin studierte dort).
Speranskys Projekte
Michail Speransky wurde der engste Assistent des Kaisers. Er bereitete eine Ministerreform vor, die von Alexander I. genehmigt wurde. Die Kurzbiographie des Herrschers erhielt eine weitere erfolgreiche Initiative. Neue Ministerien ersetzten die ineffizienten Hochschulen der Petruszeit.
Im Jahr 1809 wurde ein Entwurf zur Gewaltenteilung im Staat ausgearbeitet. Alexander wagte jedoch nicht, dieser Idee Leben einzuhauchen. Er hatte Angst vor dem Murren der Aristokratie und dem nächsten Palastputsch. Deshalb geriet Speransky schließlich in den Schatten und wurde entlassen. Ein weiterer Grund für die Kürzung der Reformen war der Krieg mit Napoleon.

Außenpolitik
Ende des 18. Jahrhunderts erlebte Frankreich die Große Revolution. Die Monarchie wurde zerstört. Stattdessen entstand zunächst eine Republik und dann die Alleinherrschaft des erfolgreichen Feldherrn Napoleon Bonaparte. Als Brutstätte revolutionärer Gefühle entwickelte sich Frankreich zu einem Gegner der absoluten Monarchien Europas. Sowohl Catherine als auch Paul kämpften mit Paris.
Auch Kaiser Alexander I. sprang ein. Die Niederlage bei Austerlitz im Jahr 1805 brachte Russland jedoch an den Rand einer Niederlage. Dann änderte sich die Politik Alexanders I.: Er traf sich mit Bonaparte und schloss mit ihm den Frieden von Tilsit, wonach Neutralität hergestellt wurde und Russland die Möglichkeit hatte, Finnland und Moldawien zu annektieren, was auch geschah. Auf dem neuen nördlichen Territorium führte der Kaiser seine Reformen durch.
Finnland wurde als Großherzogtum mit eigenem Landtag und eigenen Bürgerrechten annektiert. Und in der Zukunft war diese Provinz im 19. Jahrhundert die freieste im gesamten Staat.
Doch 1812 beschloss Napoleon, Russland anzugreifen. So begann der Vaterländische Krieg, den jeder aus Tolstois „Krieg und Frieden“ kennt. Nach der Schlacht von Borodino wurde Moskau den Franzosen übergeben, was für Bonaparte jedoch nur ein vorübergehender Erfolg war. Ohne Mittel floh er aus Russland.

Dann führte Alexander I., dessen kurze Biografie voller verschiedener Ereignisse ist, die Armee im Auslandsfeldzug an. Er zog triumphierend in Paris ein und wurde in ganz Europa zum Helden. Der Sieger leitete die russische Delegation beim Wiener Kongress. Bei diesem Ereignis wurde das Schicksal des Kontinents entschieden. Durch seine Entscheidung wurde Polen endgültig an Russland angeschlossen. Sie erhielt eine eigene Verfassung, deren Einführung Alexander im ganzen Land jedoch nicht wagte.
Letzten Jahren
Die letzten Regierungsjahre des Autokraten waren vom Aussterben der Reformen geprägt. Der Kaiser interessierte sich für Mystik und erkrankte schwer. Er starb 1825 in Taganrog. Er hatte keine Kinder. Die dynastische Krise war der Grund für die Machtübernahme von Alexanders jüngerem Bruder Nikolai, der zum Symbol der Reaktion und des Konservatismus wurde.