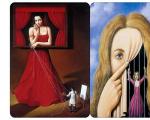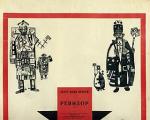Die Geschichte des Schreibens des Stücks The Cherry Orchard kurz. „The Cherry Orchard“: Schöpfungsgeschichte, Genre, Helden
1
Am 31. Januar 1901 fand im Kunsttheater die Uraufführung des Stücks „Drei Schwestern“ statt. Das Stück war ein großer Erfolg, obwohl viele Zuschauer erst später seine volle Bedeutung und Schönheit erkannten. 1. März Vl.I. Nemirovich-Danchenko telegrafierte Tschechow aus St. Petersburg: „Sie spielten die Drei Schwestern, der Erfolg ist der gleiche wie in Moskau ... sie spielten wunderbar ... Der erste Akt, heiße Herausforderungen.“ Der zweite und der dritte werden unterdrückt. Letzte Standing Ovations". Anfang März desselben Jahres informierte ihn M. Gorki über die Aufführung in St. Petersburg: „Und die drei Schwestern sind dabei – großartig!“ Besser als Onkel Wanja. Musik, kein Spiel.
Aber das Stück, das ein großes Ereignis im Theaterleben war, hinterließ beim Publikum dennoch einen tiefen Eindruck. „Ich kenne kein Werk“, schrieb der Theaterkritiker P. Yartsev, „das eher in der Lage wäre, mit einem schweren Zwangsgefühl „anzustecken“ ... „Drei Schwestern“ setzt sich wie ein Stein auf die Seele.“
Tschechow wollte ein fröhliches, freudiges Werk schaffen.
In der ersten Hälfte des Jahres 1901 waren für den Dramatiker weder die Idee noch die Handlung noch die Charaktere des zukünftigen Stücks klar. Einen Titel dafür hat er noch nicht gefunden. Es bestand nur der Wunsch, ein heiteres Theaterstück, eine Komödie zu schreiben. Am 7. März 1901 informierte der Autor O.L. Knipper: „Das nächste Stück, das ich schreibe, wird sicherlich lustig sein, sehr lustig, zumindest vom Konzept her“ (P., Bd. 9, S. 220). Am 22. April 1901 bestätigte er: „In wenigen Minuten überkam mich der starke Wunsch, ein vieraktiges Varieté oder eine Komödie für das Kunsttheater zu schreiben.“ Und ich werde schreiben, wenn nichts dazwischenkommt, aber ich werde es dem Theater frühestens Ende 1903 geben. (S., Bd. 10, S. 15).
Bei einer der Proben, an denen Tschechow bei diesem Besuch in Moskau teilnahm, flehten ihn die Künstler des Kunsttheaters beharrlich an, ein neues Stück zu schreiben. „Es schien ihm“, erinnert sich K.S. Stanislavsky, - ein offenes Fenster, mit einem Zweig weiß blühender Kirschen, der aus dem Garten in den Raum klettert. Artjom war bereits Lakai und dann, ohne ersichtlichen Grund, Manager geworden. Sein Herr, und manchmal kam es ihm so vor, als wäre dies die Herrin, war immer ohne Geld, und in kritischen Momenten wandte sie sich hilfesuchend an ihren Diener oder Manager, der von irgendwoher ziemlich viel Geld angesammelt hatte.
Dann erschien eine Gruppe von Billardspielern. Einer von ihnen ist der leidenschaftlichste Amateur, armlos, sehr fröhlich und fröhlich, immer laut schreiend ... Dann erschien ein Bosquet-Raum, dann wurde er wieder durch einen Billardraum ersetzt“ (ebd., S. 353).
Am 18. Dezember 1901 schrieb Tschechow an seine Frau und klagte über den durch Krankheit erzwungenen Müßiggang: „Aber ich träume immer noch davon, ein lustiges Theaterstück zu schreiben, in dem der Teufel wie ein Joch gehen würde“ (P., Bd. 10, S. 143).
In der zweiten Aprilhälfte besuchte Stanislawski Tschechow in Jalta, und als er ihn „mit Erinnerungen an ein neues Stück belästigte, sagte Tschechow: „Hier, hier ...“ – und holte gleichzeitig ein kleines Stück heraus Papier mit kleiner, kleiner Handschrift bedeckt“ (Stanislavsky, Bd. 5, S. 357). Am 6. Juli 1902 fragte Tschechow seine Schwester M.P. Tschechow beauftragte ihn, ihm dieses Flugblatt von Jalta nach Moskau zu schicken. Er schrieb: „Schließen Sie meinen Tisch auf, und wenn vorne in der Schublade ein Achtel Papier (oder ein Drittel eines Blattes Notizpapier) liegt, das in Kleinbuchstaben für ein zukünftiges Theaterstück geschrieben ist, dann schicken Sie es mir in einem.“ Brief. Auf diesem Blatt stehen übrigens viele Namen“ (P., Bd. 10, S. 241).
Im Sommer 1902 wurden dem Dramatiker die Grundzüge der Handlung klar, und er war sogar zuversichtlich, dass er das Stück bis zum 1. August fertigstellen würde.
Auch Tschechow fand einen Titel dafür. Selbst vor denen, die ihm am nächsten standen, verbarg er diesen Titel sorgfältig. Er befürchtete, dass der Titel vorzeitig bekannt gegeben würde. Zum ersten Mal rief ihn der Schriftsteller unter besonderen Umständen an. Anfang Juni erkrankte der bereits genesene O.L. erneut schwer. Knipper. „Tschechow hat ihr Bett nicht verlassen. Einmal sagte er, um den Patienten zu unterhalten und von den Gedanken über die Krankheit abzulenken: „Soll ich Ihnen sagen, wie das Stück heißen wird?“ Er wusste, dass es aufheitern und die Dunkelheit durchbrechen würde. Er beugte sich zu Olga Leonardovnas Ohr und flüsterte leise, so dass, Gott bewahre, niemand sonst es hören konnte, obwohl außer ihnen niemand sonst im Raum war: „Der Kirschgarten.“
Ende 1902 gab Tschechow den Titel des Stücks bekannt (unter strengster Geheimhaltung!) und seiner Schwester M.P. Tschechowa, die darüber so spricht: „Ich bin gerade aus Moskau zurückgekehrt. Wir saßen bei Ant. Pavel. in seinem Büro. Er steht am Schreibtisch, ich stehe am Fenster... Ich sagte, dass man in Moskau Theaterstücke von ihm erwartet... Antoscha hörte schweigend zu... Dann sagte er lächelnd, leise und schüchtern: „Ich schreibe, das schreibe ich.“ Schreiben...". Mich interessierte der Titel des Stücks. Er wollte lange Zeit nichts sagen, dann riss er ein Blatt Papier ab, schrieb etwas auf und reichte es mir. Ich habe gelesen: Der Kirschgarten.
Tschechow verbrachte die Monate Juli und August in der Nähe von Moskau in Ljubimowka. Er war begeistert von der wunderbaren Natur dieser Gegend. Er war erfreut über die Stille und die fast völlige Abwesenheit lästiger Besucher, die ihn in Jalta so sehr belastet hatten. Er dachte gut. Hier wurde schließlich der allgemeine Handlungsplan des neuen dramatischen Werks festgelegt. Tschechow war mit der Handlung zufrieden und fand sie „großartig“ (P., Bd. 11, S. 28).
Die Direktoren des Kunsttheaters, denen Tschechow die Handlung seines neuen Stücks mit seinen Hauptfiguren in allgemeinster Form bekannt gegeben hatte, begannen bereits mit der Planung seiner Inszenierung: Sie wählten mögliche Darsteller aus; machte die ersten Überlegungen zur Landschaft. Dennoch hatte Tschechow noch nicht mit dem Schreiben des Textes begonnen.
Am 1. Oktober benachrichtigte er K.S. Alekseev (Stanislavsky): „Am 15. Oktober werde ich in Moskau sein und Ihnen erklären, warum mein Stück noch nicht fertig ist. Es gibt eine Verschwörung, aber es gibt immer noch nicht genug Schießpulver“ (ebd., S. 54). Am 14. Dezember 1902 antwortete er auf die Fragen seiner Frau zum Stück: „Wenn ich mich im Kirschgarten hinsetze, werde ich Ihnen schreiben“ (ebd., S. 91). Zehn Tage später teilte er ihr seine Gedanken zu einem neuen dramatischen Werk mit und teilte ihr mit: „My Cherry Orchard wird in drei Akten erscheinen. Das denke ich, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Sobald es mir besser geht, werde ich wieder Entscheidungen treffen, aber jetzt habe ich alles aufgegeben“ (ebd., S. 101).
2
Als Tschechow über das Stück „Der Kirschgarten“ nachdachte, begann er, nach und nach die Figuren auszuwählen und zu komponieren. Dazu nutzte er in großem Umfang sowohl den Bestand an langjährigen Eindrücken als auch das, was ihn umgab, was er jeden Tag sah und hörte. Ab Ende der 70er Jahre beobachtete Tschechow, noch als Gymnasiast, das Leben alter, zerstörter Landgüter und die Bräuche ihrer Bewohner und unternahm Ausflüge in die Donsteppe zu seinem Schüler P. Kravtsov.
Im Mai 1888 lebte er im Anwesen von A.V. Lintvareva in der Provinz Charkow, von wo aus er schrieb, dass dort „Natur und Leben nach genau dem Muster aufgebaut sind, das mittlerweile so überholt ist und in den Redaktionen abgelehnt wird: ganz zu schweigen von den Nachtigallen, die Tag und Nacht singen, und dem Bellen der Hunde.“ Das hört man schon von weitem, oh alte, vernachlässigte Gärten, von dicht gedrängten, sehr poetischen und traurigen Anwesen, in denen die Seelen schöner Frauen leben, ganz zu schweigen von den alten Lakaien-Feudaldienern, die in ihrem letzten Atemzug atmen, von Mädchen, die nach dem dürsten stereotypste Liebe ...“ (P., Bd. 2, S. 277). Tatsächlich wurde in diesem Brief die Handlung von „The Cherry Orchard“ bereits erzählt, und zwar nicht nur in ihrem Hauptgeschehen (dicht gepackte poetische Anwesen), einzelnen Charakteren (unterwürfigen Lakaien), sondern sogar in privaten Episoden (vergleiche zum Beispiel „ die Seelen schöner Frauen“ mit Ranevskayas Bemerkung: „Schau, die verstorbene Mutter geht durch den Garten ... in einem weißen Kleid!“ (S., Bd. 13, S. 210).
Im Jahr 1892 kaufte Tschechow sein eigenes Gut Melikhovo im Bezirk Serpuchow in der Moskauer Provinz und lebte darin bis 1899. Zemstvo und medizinische Aktivitäten gaben ihm die Möglichkeit, viele Grundbesitzer des Bezirks zu besuchen und sich mit deren Anwesen, Einrichtung und Bräuchen vertraut zu machen. Basierend auf seinen Eindrücken vom Leben des örtlichen Adels schuf Tschechow eine Reihe von Prosawerken: „Verspätete Blumen“ (1882), „Drama auf der Jagd“ (1884), „Im Nachlass“ (1894). In der Erzählung „Bei Freunden“ (1898) gab Tschechow nicht nur die Handlung des Stücks „Der Kirschgarten“ im Keim, sondern auch einzelne Bilder, zum Beispiel Losev, die an Gaev erinnern.
Ende 1900 und Anfang 1901 reiste Tschechow ins Ausland. Dort hatte er reichlich Gelegenheit, das müßige Leben russischer Bars zu beobachten, die ihr Vermögen verschwendeten. Am 6. Januar 1901 schrieb er an O.L. Knipper: „Und was für unbedeutende Frauen, oh Liebling, wie unbedeutend! Eine von ihnen hat 45 Gewinnlose, sie lebt hier vom Nichtstun, nur Essen und Trinken, geht oft nach Monte-Carlo, wo sie feige spielt, und geht am 6. Januar nicht zum Spielen, weil morgen ein Feiertag ist! Wie viel russisches Geld wird hier verschwendet, besonders in Monte Carlo“ (P., Bd. 9, S. 176). Es ist merkwürdig, dass Tschechow den alten Gutsbesitzer, also Ranevskaya, zunächst „den Gutsbesitzer aus Monte Carlo“ nannte.
Sowohl für das Bild von Gaev als auch für Ranevskaya mangelte es Tschechow nicht an echten Prototypen. Er versicherte Stanislawski: „Das ist doch die Realität! Das war sie. Ich habe es mir nicht ausgedacht ...“ Und er erzählte von einem alten Herrn, der den ganzen Tag im Bett gelegen hatte, weil sein Lakai das Dorf in Richtung Stadt verlassen hatte , ohne die Hose des Meisters herauszunehmen. Und die Hose hing im Schrank daneben.
Die Grundlage für das Bild von Epikhodov war aller Wahrscheinlichkeit nach ein alter Bekannter des Schriftstellers A.I. Ivanenko, ein großer Verlierer im Leben. M.P. Tschechow, der Bruder des Schriftstellers, nennt ihn direkt „Epichodows Prototyp“. In seinen Memoiren heißt es: „Es war ein freundlicher, unglücklicher Hokhlik, der mit seinem Vater in Kleinrussland nicht zurechtkam, der zum Studium nach Moskau auswanderte.“ Hier legte er am Konservatorium eine Prüfung in der Klavierklasse ab, bestand sie, aber es gab nicht genug Instrumente für ihn und er musste Flöte lernen. Iwanenko lernte Tschechows Familie kennen und blieb ganz bei ihr. „Er war ein erbärmlicher Mann, liebevoll, sanft und anhänglich. Er sprach ungewöhnlich lange und nahm es nicht übel, wenn man ihm nicht zuhörte. Tschechow nannte ihn „dumm“. Einige Eigenschaften von Epikhodov, sein Spitzname „zweiundzwanzig Unglücke“, wurden von Tschechow von einem Jongleur entlehnt. Im Frühsommer 1902 besuchte der Schriftsteller, während er in Moskau lebte, gelegentlich das Aquarium, wo er den geschickten Jongleur mochte. „Er war“, erinnert sich Stanislavsky, „ein großer Mann im Frack, dick, ein wenig schläfrig, ausgezeichnet, mit großer Komik spielte er bei seinen Jonglierübungen einen Verlierer.“ „Zweiundzwanzig Unglücke“ sind ihm widerfahren ... Ich glaube, - endet K.S. Stanislavsky, - dass es der Prototyp von Epikhodov war. Oder einer der Prototypen.
Im selben Jahr, als er in Lyubimovka lebte, wurde der Nachlass von K.S. Stanislawski lernte Tschechow einen Mitarbeiter kennen, von dem er auch bestimmte Merkmale für das Bild Epichodows übernahm. „Tschechow sprach oft mit ihm und überzeugte ihn davon, dass man studieren muss, man muss ein gebildeter und gebildeter Mensch sein. Um einer zu werden, kaufte sich der Prototyp Epichodows zunächst eine rote Krawatte und wollte Französisch lernen“ (Stanislawski, Bd. 1, S. 267). Bei der Gestaltung des Bildes von Epikhodov nutzte der Autor auch seine Beobachtungen über den Lakaien Jegor, der sehr unbeholfen und unglücklich war. Der Schriftsteller begann ihn davon zu überzeugen, dass „der Dienst als Lakai eine Beleidigung für eine Person sei“, und riet ihm, Buchhaltung zu lernen und als Angestellter irgendwohin zu gehen. Jegor hat genau das getan. Anton Pawlowitsch „... war sehr zufrieden.“ Es ist möglich, dass Tschechow einige Merkmale von Epikhodov in der Gestalt von I.G. bemerkte. Witte, ein Zemstvo-Chirurg, den Tschechow aus seiner medizinischen Tätigkeit im Bezirk Serpuchow kannte. In seinem Notizbuch notierte Tschechow: „Witte – Epikhodov“ (S., Bd. 17, S. 148).
Der wahre Prototyp des Bildes von Charlotte war eine Engländerin, die Tschechow während seines Aufenthalts in Lyubimovka kennenlernte (Stanislavsky, Bd. 1, S. 226-267). Aber Tschechow nutzte auch seine Beobachtungen an anderen ihm bekannten Frauen dieser Art. Er zeichnete einen Typ. Und deshalb war er so aufgeregt, als Stanislawski, der Charlotte als Ljubimows Engländerin erkannte, beschloss, den Künstler, der die Rolle der Charlotte spielte, so zu schminken, dass er wie diese Engländerin aussah. Tschechow sah darin die Gefahr des Naturalismus, der Nachahmung einer individuellen Persönlichkeit, und versicherte dem Regisseur, dass Charlotte „mit Sicherheit eine Deutsche sein muss, und mit Sicherheit dünn und groß, wie die Schauspielerin Muratova, ganz anders als die Engländerin, mit der Charlotte abgeschrieben wurde“ ( ebd., S. 267).
Tschechow mangelte es nicht an Materialien für das Bild Trofimows. Er selbst war Student an der Moskauer Universität und kannte das studentische Umfeld sehr gut. Tschechows Wohnung wurde oft von Studenten besucht – Kameraden und Freunden der Schwester und der Brüder des Schriftstellers. Im Sommer 1888 traf sich Tschechow, als er auf dem Gut Lintvarev lebte, täglich mit P.M. Lintvarev, aus dem 4. Jahr der Universität ausgeschlossen. Tschechow behandelte die Studenten mit großer Sympathie. Im Jahr 1899 sagte er in Taganrog: „Es wird viel darüber geredet, dass es den Studenten heute schlechter geht als in unserer Zeit.“ Ich bin damit nicht einverstanden. Meiner Meinung nach sind sie viel besser ... sie arbeiten viel mehr und trinken weniger. Zu Beginn desselben Jahres schrieb Tschechow in einem Brief an I.I. Orlow schrieb: „Studenten und Studentinnen sind ehrliche, gute Menschen, das ist unsere Hoffnung, das ist die Zukunft Russlands“ (P., Bd. 8, S. 101). Einer der wahren Prototypen von Trofimov war der Sohn einer Magd auf dem Anwesen von Stanislavskys Mutter. Anton Pawlowitsch überzeugte ihn, „das Amt aufzugeben, sich auf die Immatrikulationsprüfung vorzubereiten und an der Universität zu studieren!“ Tschechows Rat wurde befolgt. Einige Merkmale dieses jungen Mannes: „Winkligkeit“, „wolkiges Aussehen“ – der Schriftsteller „führte in das Bild von Petya Trofimov ein“.
Tschechow zeichnete Bilder des Stücks „Der Kirschgarten“ und verwendete dafür einige Wörter, Ausdrücke und Phrasen, die in seinen Notizbüchern standen. Zum Beispiel für Trofimov – „ewiger Schüler“ (S., V. 17, S. 14); für Lopachin – „das ist eine Erfindung Ihrer Fantasie, bedeckt mit der Dunkelheit des Unbekannten“ (ebd., S. 43, 156); für Pishchik „glaubt ein hungriger Hund nur an Fleisch“ (ebd., S. 44, 156), „in ein Rudel geraten, bellen Sie nicht, sondern wedeln Sie mit dem Schwanz“ (S. 157); für Tannen – „Klutty!“ (ebd., S. 94); für Gaev: „ein Mann liebt mich“ (ebd., S. 95); für Ranevskaya – „spielt diese Musik?“ - Ich höre nicht“ (S. 149).
Im Notizbuch finden wir auch einen Teil des Dialogs zwischen Firs und seinen Herren, der im zweiten Akt stattfindet: „Firs: Vor dem Unglück war es so geschäftig. Vor welchem Unglück? – Vor dem Willen“ (S., Bd. 17, S. 148). Tschechows Notizbücher enthielten auch andere Materialien, die der Autor entnommen und im Stück weiterentwickelt hatte. So gibt es im ersten Buch einen Eintrag: „Das Kabinett steht seit hundert Jahren in der Gegenwart, wie aus den Papieren hervorgeht; Die Beamten feiern ernsthaft seinen Jahrestag“ (ebd., S. 96). Dieser Eintrag wurde für die Rolle des Gaev verwendet. Es gibt auch Fragmente von Trofimovs Reden: „Wir müssen nur mit Blick auf die Zukunft arbeiten“ (ebd., S. 17), „die Intelligenz ist für nichts zu gebrauchen, weil sie viel Tee trinkt, viel redet, den Raum.“ ist voller Rauch, leere Flaschen.“ Wahrscheinlich war die Grundlage für Ranevskayas Bemerkung „Tischdecken riechen nach Seife“ der Eintrag: „In russischen Tavernen stinkt es nach sauberen Tischdecken“ (ebd., S. 9). In Tschechows Notizbüchern finden sich Hinweise auf ein Anwesen, das unter den Hammer kam (ebd., S. 118), eine Villa in der Nähe von Menton und andere, die Tschechow für sein Stück nutzen könnte. Daraus wurde auch der Titel des Stücks abgeleitet (ebd., S. 122).
Die in Tschechows Kopf eingeprägten Lebenseindrücke dienten bis ins einzelne Detail als Grundlage und Schauplatz für „Der Kirschgarten“. Aber er hat sie nicht kopiert. Er wählte und transformierte seine Beobachtungen entsprechend seiner eigenen Lebensauffassung und den Aufgaben der Kunst und ordnete sie dem ideologischen Konzept dieses Werkes unter.
Laut Stanislavskys Memoiren zeichnete sich eine mit Tschechow vertraute Engländerin, die Charlotte als Prototyp diente, durch Fröhlichkeit und Exzentrizität aus. Charlotte behielt die Exzentrizität der Engländerin, aber die Schriftstellerin verlieh ihr zusätzlich die Bitterkeit der Einsamkeit, die Unzufriedenheit mit einem zerbrochenen und ungeklärten Schicksal.
Iwanenko, offenbar der Hauptprototyp Epichodows, war ein freundlicher, guter und zuvorkommender Mensch, dessen Fehler allgemeines Mitgefühl hervorriefen. Der Autor schuf das Bild von Epikhodov und verlieh ihm sehr verwirrte Ansichten, Unhöflichkeit, Arroganz und andere Merkmale eines typischen Tollpatschs, der einen nominellen Wert erlangt hat.
K.S. Stanislawski charakterisierte einst Tschechows kreativen Prozess und sagte: „Er stellt sich einen hohen, hohen Felsen vor, auf dem Tschechow sitzt.“ Unten wimmelt es von Menschen, kleinen Menschen; Er beugt sich aufmerksam und untersucht sie. Ich habe Epikhodov gesehen – schnapp es dir! Gefangen und in seiner Nähe platziert; dann Tannen, Gaev, Lopakhin, Ranevskaya usw. Und dann wird er sie arrangieren, ihnen Leben einhauchen, und sie bewegen sich mit ihm, und er sorgt nur dafür, dass sie nicht stehen bleiben, nicht einschlafen, Hauptsache, sie handeln.
3
Das von Tschechow als Komödie konzipierte und von ihm bereits in seinen Hauptfiguren präsentierte Stück „Der Kirschgarten“ erlangte lange Zeit nicht in allen Teilen den nötigen, nachdenklichen Ereignisbezug. Ohne alle Handlungsbeziehungen der Charaktere vollständig aufzuklären, ohne die gesamte Komposition des Stücks zu verstehen, konnte der Dramatiker nicht mit dem Schreiben beginnen. Am 1. Januar 1903 versprach er Stanislawski: „Ich werde das Stück im Februar beginnen, zumindest rechne ich damit.“ Ich werde mit einem fertigen Stück nach Moskau kommen“ (S., Bd. 11, S. 110). Tschechow arbeitete zu dieser Zeit an Prosawerken, insbesondere an der Erzählung „Die Braut“, doch die Überlegungen zum Stück „Der Kirschgarten“, zu dessen Bildern, Handlung und Komposition hörten nicht auf und fesselten den Autor immer eindringlicher.
Reflexionen über den „Kirschgarten“ und alle anderen Aktivitäten des Schriftstellers wurden durch einen schmerzhaften Zustand unterbrochen. Er litt an Rippenfellentzündung. Er wurde gezwungen, nichts zu tun. Dies führte zu einem Vertrauensverlust in ihre Fähigkeiten. Am 23. Januar benachrichtigte er O.L. Knipper: „Heute erhielt ich einen Brief von Nemirovich ... mit der Frage nach meinem Stück. Dass ich mein Stück schreiben werde, ist so wahr wie zwei mal zwei vier macht, vorausgesetzt natürlich, dass ich bei guter Gesundheit bin; aber ob es gelingt, ob etwas dabei herauskommt, weiß ich nicht“ (P., Bd. 11, S. 129). Die Unsicherheit äußerte sich auch in einem Brief an V.F. Komissarzhevskaya, die die Schriftstellerin um ein Stück für das von ihr eröffnete Theater bat. Am 27. Januar antwortete ihr Tschechow: „Was das Stück betrifft, sage ich Folgendes: 1) Das Stück ist zwar konzipiert, es stimmt, und ich habe bereits seinen Titel („Der Kirschgarten“ – aber das ist immer noch ein Geheimnis). ), und ich werde wahrscheinlich spätestens Ende Februar damit beginnen, es zu schreiben, vorausgesetzt natürlich, ich bin gesund; 2) In diesem Stück spielen alte Frauen die zentrale Rolle!! – zum großen Bedauern des Autors…“ (ebd., S. 134).
Sobald die Krankheit gelindert war, begann Tschechow sofort mit der Arbeit. Er gewann wieder Vertrauen in seine eigene Stärke. Bereits am 30. Januar versprach er O.L. Knipper: „Ich werde ein Theaterstück schreiben“ (S., Bd. 11, S. 138). Es schien ihm, dass das Schreiben des Stücks in seinen bereits durchdachten Grundzügen nicht länger als einen Monat dauern würde. Am 5. Februar teilte er Stanislawski mit: „... nach dem 20. Februar werde ich voraussichtlich ein Stück aufführen und es bis zum 20. März fertigstellen.“ Es ist schon in meinem Kopf. Es heißt „The Cherry Orchard“, vier Akte, im ersten Akt kann man Kirschblüten durch die Fenster sehen, einen soliden weißen Garten. Und Damen in weißen Kleidern. Mit einem Wort, Wischnewski wird viel lachen – und aus welchem Grund ist natürlich nicht bekannt“ (ebd., S. 142).
11. Februar Tschechow verspricht O.L. Knipper, der am 21. Februar mit dem Schreiben des Stücks beginnen wird, äußerte seine Vermutung, dass sie „die Alberne“ (also Warja – A.R.) spielen würde, und fragte: „Wer wird die alte Frau spielen – die Mutter?“ (S., Bd. 11, S. 151). Am 27. Februar beendete er die Erzählung „Die Braut“ und am 1. März teilte er seiner Frau mit: „... für das Stück habe ich bereits das Papier auf den Tisch gelegt und den Titel geschrieben“ (ebd., S. 168 ). Tschechow begann weder im März noch im Mai 1903 mit dem Schreiben des Stücks. Aber die ganze Zeit über dachte er intensiv über die Charaktere nach und klärte ihre Beziehungen und ihren Platz im Stück. Seine Gedanken zu den Bildern des Stücks spiegelten sich in seinem Notizbuch wider, in dem er mit seinen engsten Verwandten und Bekannten korrespondierte.
Im Notizbuch gibt es also folgende Einträge über Lopakhin: 1) „Lopakhins Vater war Leibeigener in Terbetsky“; 2) „Lop.: Ich habe mir ein kleines Anwesen gekauft, ich wollte es schöner gestalten und habe mir außer einem Brett nichts einfallen lassen: Der Zutritt für Außenstehende ist strengstens untersagt“; 3) Lopp. Rishu: - in den Gefangenenkompanien hättest du dich“; 4) „Die Männer begannen stark zu trinken – Lopakhin: das stimmt“ (S., Bd. 17, S. 148, 149). Dies ist wahrscheinlich die erste Skizze des Bildes von Lopakhin, die sich im Laufe der Arbeit an dem Stück allmählich ändert.
Am 5. März schrieb er an O.L. Knipper: „Im Kirschgarten wirst du Warwara Jegorowna oder Warja sein, adoptiert, 22 Jahre alt“ (S., Bd. 11, S. 172). Am 6. März bemerkte er, dass die Rolle der Warja komisch sei. Tschechow stellte auch die Rolle Lopakhins als komisch dar, die seiner ursprünglichen Annahme zufolge Stanislawski zugeschrieben wurde (ebd.).
Beim Nachdenken über die Bilder stieß Tschechow auf unerwartete Komplikationen und Schwierigkeiten. „Und übrigens das Stück“, informiert er O.L. Knipper – Das gelingt mir nicht ganz. Eine Hauptfigur ist noch nicht ausreichend durchdacht und mischt sich ein; aber bis Ostern, denke ich, wird dieses Gesicht schon klar sein und ich werde frei von Schwierigkeiten sein“ (S., Bd. 11, S. 179). Was ist das für ein Gesicht? Ist es nicht Ranevskaya, die ursprünglich im wahrsten Sinne des Wortes eine alte Frau war? 11. April Tschechow fragt O.L. Knipper: Wird es eine Schauspielerin geben, die die alte Dame in „Der Kirschgarten“ spielt? Wenn nicht, dann wird es kein Theaterstück geben, und ich werde es nicht einmal schreiben“ (ebd., S. 192). Und 4 Tage später, am 15. April, noch einmal: „Ich möchte eigentlich nicht für Ihr Theater schreiben – vor allem deshalb, weil Sie keine alte Frau haben.“ Sie werden Ihnen die Rolle einer alten Frau aufzwingen, in der Zwischenzeit gibt es eine andere Rolle für Sie, aber Sie haben bereits in „Die Möwe“ eine alte Dame gespielt“ (ebd., S. 194-195).
Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Die Bilder des Stücks, ihre Wechselbeziehungen und Entwicklungen traten Tschechow immer klarer vor Augen. Er warf alles weg, was sie überfüllte, ihr die Wärme entzog. Am 21. März versicherte er O.L. Knipper: „The Cherry Orchard wird sein, ich versuche es so zu gestalten, dass es so wenige Schauspieler wie möglich gibt; so intim“ (S., Bd. 11, S. 182).
In seinem neuen Stück entwickelte er die ideologischen und künstlerischen Prinzipien weiter, die er bereits in früheren dramatischen Werken umgesetzt hatte, die Prinzipien der Darstellung der alltäglichen Realität in ihrer inhärenten Komplexität und Widersprüchlichkeit. Und das Leben erhob sich von seinen gewohnten Ufern und zeigte neue, bisher unbekannte Seiten. Und es schien Tschechow, dass er kreativ aufhörte. Zweifel packten ihn, und am 17. April schrieb er voller Angst: „Das Stück wird nach und nach besser, nur fürchte ich, dass mein Ton allgemein veraltet ist, wie es scheint“ (ebd., S. 196).
Der Rhythmus von Tschechows Leben und Werk während seines Aufenthalts in Jalta wurde ständig durch zahlreiche Besucher gestört: Freunde, Bekannte, Bewunderer von Talenten, Bittsteller und einfach neugierige Menschen. Tschechow litt sehr darunter. 9. April 1903, Beschwerde bei O.L. Als Knipper die Besucher störte, teilte er ihr mit: „Ich werde das Stück in Moskau schreiben, es ist unmöglich, hier zu schreiben.“ Auch Korrekturlesen darf nicht gelesen werden“ (P., Bd. 11, S. 191). 17. Juni in einem Brief an N.E. Er sagte Efros, dass er „noch nicht einmal angefangen habe, das Stück zu schreiben“ (ebd., S. 226). Tschechow war noch damit beschäftigt, Skizzen anzufertigen und anzufertigen, hatte aber noch nicht begonnen, das Gesamtbild zu malen.
4
Am 25. Mai 1903 ließ sich Tschechow in einer Datscha in der Nähe von Moskau in Naro-Fominsk nieder. Am 4. Juni informierte er L.V. Mitte: „Ich sitze am großen Fenster und arbeite nach und nach“ (S., Bd. 11, S. 217). In der zweiten Junihälfte begann er schließlich, einen zusammenhängenden Text für das Theaterstück „Der Kirschgarten“ zu schreiben. Damals gingen übrigens mehrere bereits geschriebene Szenen des Stücks verloren, was seine Arbeit daran möglicherweise verzögert hat. Einmal „ließ Anton Pawlowitsch ihre Laken auf dem Schreibtisch liegen und ging selbst zu den Nachbarn. Zu dieser Zeit zog plötzlich ein Sommergewitter auf, ein Wirbelsturm brach durch das Fenster herein und trug zwei oder drei Blätter des Stücks, mit Tinte in Tschechows kleiner Handschrift geschrieben, vom Tisch in den Garten ...
„Erinnerst du dich nicht daran, was sie anhatten?“ sie fragten ihn.
Stellen Sie sich vor, ich erinnere mich nicht“, antwortete er mit einem Lächeln. - Wir müssen diese Szenen noch einmal schreiben.
Am 7. Juli reiste Tschechow nach Jalta ab und verbrachte seine gesamte Freizeit nur mit dem Theaterstück. Am 28. Juli informierte er K.S. Stanislavsky: „Mein Stück ist noch nicht fertig, es bewegt sich langsam, was ich mit Faulheit, dem wunderbaren Wetter und der Schwierigkeit der Handlung erkläre ... Ihre Rolle ist anscheinend wow geworden“ (S., Bd. 11, S. 236).
Tschechow versuchte, den Schauplatz des Stücks so weit wie möglich zu vereinfachen. „Der situative Teil des Stücks“, schrieb er am 22. August an V.I. Nemirovich-Danchenko, – ich habe es auf ein Minimum reduziert, es werden keine besonderen Dekorationen erforderlich sein und Schießpulver muss nicht erfunden werden“ (ebd., S. 242).
Für den zweiten Akt, der ihm im ersten Entwurf langweilig, zäh und eintönig vorkam, fand der Dramatiker lange Zeit nicht die nötige Bühnenverkörperung. Am 2. September schrieb er an V.I. Nemirovich-Danchenko: „Mein Stück (wenn ich so weiterarbeite wie bis heute) wird bald fertig sein, seien Sie beruhigt. Es war schwierig, sehr schwierig, den zweiten Akt zu schreiben, aber es scheint, als sei nichts dabei herausgekommen“ (P., Bd. 11, S. 246).
Im Laufe der Arbeit an dem Stück veränderten sich seine Charaktere. So wurde die „alte Frau“ etwas jünger und ihre Rolle konnte bereits O.L. angeboten werden. Knipper. Im Brief an V.I. Tschechow schrieb an Nemirowitsch-Dantschenko: „Olga wird in meinem Stück die Rolle der Mutter übernehmen“ (ebd.).
Das Stück „The Cherry Orchard“ entstand in echter „Kreativität“. Tschechow hatte immer wieder Zweifel an der Würde dessen, was er geschrieben hatte, und es kam ihm so vor, als ob er, weit entfernt vom Theater, vom Zentrum der Kultur, vom brodelnden gesellschaftlichen Leben, bereits seine Ärsche wiederholte und zu nichts Neuem fähig war , Original. Da er ein fast fertiges Stück vor sich hatte, schrieb er am 20. September an seine Frau: „Ich bin so weit von allem entfernt, dass ich langsam den Mut verliere. Mir kommt es so vor, als sei ich als Schriftsteller bereits überholt, und jeder Satz, den ich schreibe, erscheint mir wertlos und nutzlos für irgendetwas“ (P., Bd. 11, S. 252).
Der letzte Akt des Stücks fiel Tschechow leichter. Am 23. September informierte Anton Pawlowitsch O.L. Knipper: „Der vierte Akt meines Stücks wird im Vergleich zu anderen Akten inhaltlich dürftig, aber wirkungsvoll sein. Das Ende Ihrer Rolle erscheint mir nicht schlecht“ (ebd., S. 253-254).
Am 25. September beendete Tschechow das Schreiben dieses Aktes und am 26. September wurde das Stück fertiggestellt. Der Dramatiker hatte das ganze Werk bereits vor sich gesehen, und diesmal schien es ihm nicht veraltet zu sein. „Mir kommt es so vor“, gab er gegenüber O.L. zu. Knipper, – dass in meinem Stück, egal wie langweilig es ist, etwas Neues ist“ (S., Bd. 11, S. 256). Für ihn war es unbestreitbar, dass ihre Gesichter „lebendig hervorkamen“ (ebd., S. 257).
5
Der Entstehungsprozess des Stücks wurde zurückgelassen. Es musste nur neu geschrieben werden. Doch als Tschechow den Text des Stücks während der Korrespondenz sorgfältig las, entdeckte er erneut Schwächen darin, die eine Änderung und Verfeinerung erforderten. „Das Stück ist bereits vorbei“, informierte er O.L. Knipper, - aber ich schreibe langsam um, weil ich noch einmal überdenken muss; Ich schicke zwei oder drei unvollendete Werke, ich verschiebe sie auf später – entschuldigen Sie“ (P., Bd. 11, 258-259). Tschechow hat viele Szenen komplett überarbeitet. „Einige Passagen“, schrieb er am 3. Oktober, „fallen mir wirklich nicht gefallen, ich schreibe sie noch einmal und schreibe sie noch einmal um“ (ebd., S. 262). Anton Pawlowitsch gefiel vor allem der zweite Akt nicht, der seiner Meinung nach auch nach der Überarbeitung „langweilig und eintönig wie ein Spinnennetz“ blieb (ebd., S. 267). Dieser Akt begann mit der folgenden Inszenierung: Jascha und Dunjascha sitzen auf einer Bank und Epichodow steht in ihrer Nähe. Trofimov und Anya kommen vom Anwesen aus die Straße entlang. Die Aktion begann mit einem Dialog zwischen Anya und Trofimov:
« Anya. Großmutter ist Single, sehr reich. Sie liebt ihre Mutter nicht. In der Anfangszeit hatte ich Schwierigkeiten mit ihr, sie sprach wenig mit mir. Dann nichts, weicher. Sie versprach, Geld zu schicken, gab mir und Charlotte Iwanowna Geld für die Reise. Aber wie schrecklich ist es, wie schwer ist es, sich wie ein armer Verwandter zu fühlen.
Trofimov. Es scheint schon jemand hier zu sein ... sie sitzen. In diesem Fall machen wir weiter.
Anya. Ich war seit drei Wochen nicht zu Hause. So gelangweilt! (Sie gehen.)"
Nach dem Weggang von Anya und Trofimov wandte sich Dunyasha mit den Worten an Yasha: „Trotzdem, was für ein Glück, im Ausland zu sein“, und dann entwickelte sich die Handlung in der uns bereits bekannten Reihenfolge, jedoch mit einem zusätzlichen Dialog von Vari und Charlotte Wir gingen die Straße vom Anwesen entlang und endeten mit einer großen Szene mit Fiers und Charlotte.
Der Dialog zwischen Warja und Charlotte unterbrach das Gespräch zwischen Ranevskaya, Gaev und Lopakhin und begann, nachdem Lopakhin ausrief: „Woran gibt es da zu denken?“ Hier ist der Inhalt:
« Warja. Sie ist ein kluges und wohlerzogenes Mädchen, es kann nichts passieren, aber trotzdem sollte man sie nicht mit einem jungen Mann allein lassen. Abendessen um neun Uhr, Charlotte Iwanowna, komm nicht zu spät.
Charlotte. Ich will nicht essen... (singt leise ein Lied).
Warja. Das ist egal. Es ist für die Bestellung notwendig. Siehst du, sie sitzen da am Ufer ... (Warja und Charlotte gehen).
Im weiteren Verlauf der Handlung, als Anya und Trofimov sich vor Warja versteckten, kam Firs auf die Bühne und suchte, etwas murmelnd, auf dem Boden in der Nähe der Bank. Dann tauchte Charlotte auf. Zwischen diesen Menschen, die sich sehr einsam fühlten, kam es zu einem Gespräch:
« Tannen(Gemurmel). Oh, du Narr!
Charlotte. (setzt sich auf eine Bank und nimmt seine Mütze ab). Bist du das, Firs? Wonach suchst du?
« Tannen. Die Dame hat ihre Handtasche verloren.
Charlotte(Auf der Suche nach). Hier ist ein Fächer... Und hier ist ein Taschentuch... es riecht nach Parfüm... (Pause). Mehr gibt es nicht. Lyubov Andreevna verliert ständig. Auch sie hat ihr Leben verloren (singt leise ein Lied). Ich, Großvater, habe keinen richtigen Pass, ich weiß nicht, wie alt ich bin, und es kommt mir vor, als wäre ich jung ... (setzt Fars eine Mütze auf, er sitzt regungslos da). Oh, ich liebe dich, mein lieber Herr! (lacht). Ein, zwei, drei! (nimmt die Mütze von Firs ab und setzt sie sich selbst auf). Als ich ein kleines Mädchen war, gingen mein Vater und meine Mutter auf Jahrmärkte und gaben Auftritte. Sehr gut. Und ich bin Salto Mortale gesprungen und solche Sachen. Und als mein Vater und meine Mutter starben, nahm mich eine deutsche Dame zu sich und begann, mich zu unterrichten. Bußgeld. Ich bin aufgewachsen und dann Gouvernante geworden, aber wo ich bin und wer ich bin, weiß ich nicht ... Wer sind meine Eltern, vielleicht haben sie nicht geheiratet ... Ich weiß es nicht ... . (holt eine Gurke aus der Tasche und isst sie). Ich weiß gar nichts.
Tannen. Ich war 20 oder 25 Jahre alt, lass uns gehen, ich bin es und der Sohn des Vaters des Diakons und der Koch Wassili, und gerade hier sitzt ein Mann auf einem Stein ... jemand anderem, unbekannt ... Aus irgendeinem Grund Ich wurde schüchtern und ging, aber sie nahmen ihn und töteten ihn ohne mich ... Er hatte Geld.
Charlotte. Also? Weiter.
Tannen. Dann, das heißt, das Gericht kam in großer Zahl, sie begannen zu verhören ... Sie nahmen mich mit ... Und mich auch ... Ich verbrachte zwei Jahre im Gefängnis ... Dann nichts, sie ließen mich frei. Es ist lange her... (Pause). Du wirst dich nicht an alles erinnern...
Charlotte. Es ist Zeit für dich zu sterben, Großvater... (isst Gurke).
Tannen. A? (murmelt vor sich hin). Das bedeutet also, dass wir alle zusammen gingen und es einen Halt gab ... Onkel sprang vom Karren ... nahm einen Sack ... und in diesem Sack war wieder ein Sack ... Und er schaute, und da ist irgendetwas – Idiot, Idiot!
Charlotte(lacht leise). Trocken, Idiot!
Damit endete der zweite Akt.
Mit der sorgfältigen Feinarbeit, die Tschechow vornahm, wurden in zwölf Tagen (bis zum 7. Oktober) nur zweieinhalb Akte umgeschrieben. „Ich ziehe, ziehe, ziehe“, berichtete er an diesem Tag O.L. Knipper, – und weil ich ziehe, kommt es mir vor, als wäre mein Spiel unermesslich riesig, kolossal, ich bin entsetzt und habe jegliche Lust darauf verloren“ (P., Bd. 11, S. 265). Am 6. Oktober 1903 teilte Tschechow M. Gorki mit: „Ich habe das Stück beendet, aber ich schreibe es äußerst langsam um. Am 10. Oktober werde ich es voraussichtlich fertigstellen und absenden“ (ebd., S. 264). Der Dramatiker wurde von den Leitern und Künstlern des Kunsttheaters beworben. Sie brauchten wie die Luft ein neues Tschechow-Stück. Bereits im September hatte V.I. Nemirowitsch-Dantschenko fragte: „Prinalyag, Anton Pawlowitsch! .. Oh, wie sehr wir sie brauchen ...“. Fast täglich O.L. Knipper erinnerte den Autor beharrlich an die Notwendigkeit, das Stück so schnell wie möglich fertigzustellen.
Doch der an sich selbst fordernde Künstler verzögerte das Stück und arbeitete mühsam weiter. „Ich schreibe das Stück neu“, sagte er zu O.L. Knipper 9. Oktober 1903 – Ich werde bald fertig sein ... Ich versichere Ihnen, jeder zusätzliche Tag ist nur gut, denn mein Spiel wird immer besser und meine Gesichter sind bereits klar. Nur jetzt fürchte ich, dass es Orte gibt, die durch die Zensur gestrichen werden können, es wird schrecklich sein“ (P., Bd. 11, S. 269).
Um das Bild von Gaev zu präzisieren, benötigte der Dramatiker spezifische Ausdrucksformen der Billardspieler. Er fragte den Bruder seiner Frau – K.L. Knipper, um sich das Spiel der Billardspieler anzuschauen und deren Jargon aufzuschreiben. 9. Oktober K.L. Knipper teilte ihm mit: „Ich habe zwei kleine Männchen gesehen, ich habe zwei Stunden im Billardzimmer des Stadtgartens gesessen, aber ich habe ein wenig über diese spezielle Billardterminologie gelernt: Sie spielen mürrischer und murmeln Bewegungen vor sich hin ...“ .
K.L. Knipper hat für Tschechow 22 Ausdrücke von Billardspielern niedergeschrieben. Hier ist der Anfang der Liste dieser Ausdrücke, die er dem Autor schickte:
„1 – (setzen) – von 2 Seiten zur Mitte.
2 – Krause in der Mitte.
3 - Ich schneide in der Mitte, in der Ecke.
4 - Wams in der Ecke, in der Mitte.
5 - Ich habe sauber gemacht.
6 - Vom Ball nach rechts (links) bis zur Ecke.
7 - Mit einem Ball (also mit deinem anderen Ball) in die Ecke! .
Diese Ausdrücke waren für Tschechow nützlich, er fügte einige davon in die Rolle von Gaev ein. Es ist wichtig anzumerken, dass der Autor im Bemühen um Genauigkeit mit den Beobachtungen von K.L. nicht zufrieden war. Knipper schrieb am 14. Oktober an seine Frau: „Bitten Sie Vishnevsky, sich anzuhören, wie sie Billard spielen, und weitere Billardbegriffe aufzuschreiben. Ich spiele kein Billard, oder ich habe früher gespielt, aber jetzt habe ich alles vergessen und alles in meinem Spiel ist Zufall ...“ (S., Bd. 11, S. 273).
Tschechows Anspruch an sich selbst war so groß, dass er, nachdem er das Stück bereits zum zweiten Mal umgeschrieben hatte, kurz vor seiner Versendung nach Moskau eine Reihe von Korrekturen, Ergänzungen und Kürzungen daran vornahm. Im ersten Akt fragte Ranevskaya ihren Bruder, wie viel sie Lopakhin schuldeten, und Gaev nannte den Betrag von 40.000 (RGB. F. 331, Z. 13). Tschechow hielt diese Episode für überflüssig und strich sie durch. Im selben Akt änderte der Schriftsteller Ranevskayas Ausdruck „Glück ist mit mir aufgewacht“ in einen ausdrucksstärkeren Ausdruck: „Glück ist mit mir aufgewacht“ (Z. 14). Gleichzeitig wurde im ersten Akt Anyas Ansprache an Gaev „nur ein lieber Onkel“ durch das rhythmischere „aber lieber Onkel“ korrigiert (Z. 16).
Im zweiten Akt enthält die Rolle der Ranevskaya eine Bemerkung, in der sie Gaevs trügerische Hoffnungen auf einen General widerlegt. Ljubow Andrejewna teilt voll und ganz Lopachins Misstrauen gegenüber Gajews Vorhaben, Geld von einem unbekannten General zu leihen, und sagt: „Er ist wahnhaft. Es gibt keine Generäle“ (RGB. F. 331, Z. 25). Trofimov wandte sich zunächst an Anya und sagte: „Schließlich hat das euch alle korrumpiert.“ Aber offensichtlich aus Angst vor Zensur strich Tschechow das Wort „korrupt“ durch und schrieb stattdessen: „wiedergeboren“ (Z. 29).
Im dritten Akt enthielt Jaschas Bitte, ihn nach Paris zu bringen, mit der er sich an Ranevskaya wendet, auch die Worte: „Was soll ich sagen, Sie sehen selbst“ (l. 40). Dies verstärkte den unverschämt vertrauten Ton des „zivilisierten“ Lakaien.
Im vierten Akt wird in Pishchiks Geschichte über einen Philosophen, der zum Springen von Dächern rät, der Ausdruck eingefügt: „Denken Sie einfach darüber nach!“. Aber derselbe Ausdruck wird vom Autor nach Pishchiks Botschaft über die Übergabe des Grundstücks mit Lehm an die Briten für 24 Jahre durchgestrichen. Vielleicht fand Tschechow, dass eine genaue Wiederholung von Piszczyks Lieblingssprichwort in einer Szene zu aufdringlich wäre. Zum Abschied von Ranevskaya sagte Pishchik zunächst: „Erinnern Sie sich an genau dieses ... Pferd und sagen Sie: „Es gab so und so ... Simeonov-Pishchik ... ein Pferd auf der Welt“ (l. 50). Auch das letzte, wiederkehrende Wort streicht Tschechow. Er schließt auch die Bemerkung „Spaß“ aus, die die von Ranevskaya gesagten Abschiedsworte von Pishchik charakterisiert.
Die doppelte Neufassung des Stücks wurde am 12. oder 13. Oktober abgeschlossen und am 14. Oktober nach Moskau geschickt. Trotz der großen Überarbeitung während des Umschreibens erschien dem Autor das Stück noch nicht ganz fertig. Wäre er nicht so dringend in Eile gewesen, hätte Tschechow den Text weiter verfeinert. „Da ist etwas in dem Stück“, schrieb er an O.L. Knipper, - es muss erneuert werden ... Akt IV ist noch nicht abgeschlossen und in II muss etwas aufgewühlt werden, und vielleicht sollten am Ende von III 2-3 Wörter geändert werden, sonst sieht es vielleicht so aus wie das Ende von „Onkel Wanja““ (S. , Bd. 11, S. 276). Der Dramatiker glaubte, dass die Rolle der Ranevskaya „nur in den Akten III und I gespielt wurde, im Rest war sie nur verputzt“ (ebd., S. 271).
Nachdem er das Stück nach Moskau geschickt hatte, wartete Tschechow gespannt auf die Beurteilung durch die Leiter und Künstler des Kunsttheaters. „Ich habe dir gestern nicht geschrieben“, gab er am 19. Oktober gegenüber O.L. zu. Knipper, - weil ich die ganze Zeit mit angehaltenem Atem auf ein Telegramm gewartet habe ... Ich blieb feige, ich hatte Angst. Ich hatte vor allem Angst vor der Unbeweglichkeit des zweiten Aktes und dem unvollendeten Werk eines Studenten Trofimov“ (P., Bd. 11, S. 278-279). Am selben Tag erhielt Tschechow ein Telegramm von Vl.I. Nemirovich-Danchenko, der schrieb, dass „The Cherry Orchard“ „als Bühnenwerk vielleicht eher ein Theaterstück ist als alle vorherigen“. Zwei Tage später las der Dramatiker ein Telegramm von K.S. Stanislavsky: „Ich bin schockiert, ich komme nicht zur Besinnung. Ich bin in einer unglaublichen Freude. Ich halte das Stück für das Beste von all den schönen Dingen, die Sie geschrieben haben. Ich gratuliere dem brillanten Autor herzlich. Ich habe das Gefühl, ich schätze jedes Wort. Diese enthusiastische Lobrede erregte Tschechows Unmut. Am selben Tag informierte er O.L. Knipper: „Ich habe ein Telegramm von Alekseev erhalten, in dem er mein Stück als brillant bezeichnet, das bedeutet, das Stück zu loben und ihm gut die Hälfte des Erfolgs zu nehmen, den es unter glücklichen Bedingungen hätte haben können“ (S., Bd. 11 , S. 280).
Am 21. Oktober wurde das Stück der gesamten Truppe des Kunsttheaters vorgelesen. Die Schauspieler waren vom ersten Akt an gefangen, schätzten jede Feinheit und weinten im letzten Akt. Stanislawski teilte Tschechow mit, dass „noch nie zuvor ein Stück mit solch einhelliger Begeisterung aufgenommen wurde“.
6
Das von Tschechow nach Moskau geschickte Manuskript des Stücks „Der Kirschgarten“ wurde in mehreren Exemplaren nachgedruckt. Eine Kopie des Stücks wurde sofort zur Theaterzensur nach St. Petersburg geschickt, wo es am 25. November 1903 auf der Bühne aufgeführt werden konnte. Diese Kopie des Stücks, die eine der wichtigsten Phasen der kreativen Arbeit daran widerspiegelt, nennen wir Jalta, oder zensiert Manuskript (darauf befindet sich eine Inschrift: „Es darf präsentiert werden. St. Petersburg, 25. November 1903, Zensor für dramatische Kompositionen. Wereschtschagin“).
4. Dezember A.P. Tschechow kam in Moskau an. Hier bereitete das Kunsttheater The Cherry Orchard aktiv auf die Inszenierung vor. Bei seiner Ankunft fühlte sich Tschechow unwohl, und um ihn nicht zu ermüden, wurden „die ersten Lesungen“ durchgeführt, sagt der Künstler E.M. Muratov – fand in seiner Wohnung statt. In der Folgezeit besuchte der Dramatiker fast täglich die Proben seines Stücks im Theater, besprach deren Rollen mit den Aufführungsteilnehmern und arbeitete täglich weiter am Text des Stücks. Trotz der Tatsache, dass die Theatermanager und die an der Aufführung beteiligten Schauspieler mit großem Vertrauen in den Erfolg arbeiteten, stand Tschechow der Sache skeptisch gegenüber. Seine Skepsis war so entscheidend, dass er dem Theater anbot, das Stück für nur 3.000 Rubel in ewigen Besitz zu kaufen.
Die neuen Korrekturen, die Tschechow vornahm und in das Hauptmanuskript einfügte, erwiesen sich als sehr zahlreich. Bereits am 16. Dezember benachrichtigte M. Gorki K.P. Pjatnizki über die Bitte Tschechows, ihm eine Probe des Stücks zuzusenden, die der Sammlung „Wissen“ zur Änderung desselben übergeben wurde. „Schon jetzt“, schrieb Gorki, „hat er viele Änderungen am Stück vorgenommen.“ Bei der Verfeinerung des Textes strebte Tschechow eine deutlichere Offenlegung des sozialpsychologischen Wesens der Charaktere mit ihrer inhärenten Komplexität und Widersprüchlichkeit, eine größtmögliche Übereinstimmung ihrer Handlungen und Charaktere und eine größere Farbigkeit ihrer Sprache an. Er legte großen Wert auf die kompositorische Harmonie, Lebendigkeit und Bühnenpräsenz des Stücks.
Wenden wir uns zunächst den Korrekturen des ersten Aktes zu.
Um Ranevskayas Gutherzigkeit zu unterstreichen, werden neue liebevolle Appelle in ihre Rolle eingeführt: „Danke, mein alter Mann“, sagt sie zu Firs und küsst ihn (gest. I) (RSL. F. 331, Z. 9) . "Verringern?" - Lyubov Andreevna wiederholte verwirrt und unzufrieden Lopakhins Vorschlag über einen Kirschgarten. Und dann fuhr sie fort: „Wenn es in der ganzen Provinz etwas Interessantes, sogar Wunderbares gibt, dann ist es nur unser Kirschgarten“ (Z. 7). Die Gewissheit und Kategorisierung dieser Bemerkung gefiel Ranevskaya nicht ganz. Und Tschechow, der das spürte, begleitete ihre Frage mit einem mildernden Ausdruck: „Mein Lieber, verzeih mir, du verstehst nichts“ (Z. 10). In Ranevskayas Erinnerung an ihren Sohn wird das Wort „Sohn“ durch einen herzlicheren, intimeren Ausdruck ersetzt: „mein Junge ertrank“ (l. 23). Zuvor sagte Ranevskaya, als sie die Bewegung von Gaev bemerkte und sich an das Billardspiel erinnerte: „Gelb in der Ecke! Wams in der Mitte! Tschechow leitete diese Worte mit einer Einleitung ein: „Wie ist es? Lass mich daran denken ...“ (l. 8). Und ihre Bemerkung erlangte die nötige Natürlichkeit.
Als er sich auf das Bild von Gaev bezog, verstärkte Tschechow in ihm den Charakterzug der Unbegründetheit, der Phrasendrescherei. Der Autor ergänzte Gaevs Zusicherungen über die Zahlung von Zinsen für das Anwesen mit folgenden Worten: „Bei meiner Ehre, was auch immer Sie wollen, ich schwöre, dass das Anwesen nicht verkauft wird!“ Ich schwöre bei meinem Glück! Hier ist meine Hand für Sie, dann nennen Sie mich einen miesen, unehrlichen Menschen, wenn ich Sie zur Auktion gehen lasse. Ich schwöre mit ganzem Herzen!“ (RSL. F. 331, Z. 17).
Das Bild von Lopachin wurde noch weiter verfeinert, Tschechow nimmt Korrekturen und Ergänzungen vor, die die Figur des Kaufmanns veredeln und ihn intelligent machen. So betonte der Dramatiker Lopakhins kulturelle Affinität und seine charakteristischen Ausbrüche von Herzlichkeit und appellierte an Ranevskaya mit Beinamen wie „großartig“, „erstaunliche, rührende Augen“, „Gott barmherzig!“, „Mehr als einheimisch“ (ebd., Blatt 9). In Lopakhins Ansprache an Raevskaya wird eingefügt: „Damit deine erstaunlichen, rührenden Augen mich wie zuvor ansehen, barmherziger Gott!“
Auch Lopakhins Ratschläge, die darauf abzielen, das Anwesen vor dem Verkauf auf einer Auktion zu bewahren, sowie seine Argumentation gegenüber den Sommerbewohnern werden sanfter, feinfühliger und aufrichtiger. In einem frühen (zensierten) Manuskript sagte Lopakhin: „Das möchte ich sagen, bevor ich gehe ( auf die Uhr schauen). Ich spreche vom Anwesen... kurz gesagt... ich möchte Ihnen einen Weg anbieten, einen Ausweg zu finden. Damit Ihr Vermögen keinen Verlust erleidet, müssen Sie jeden Tag um vier Uhr morgens aufstehen und den ganzen Tag arbeiten. Für Sie ist das natürlich unmöglich, ich verstehe ... Aber es gibt einen anderen Ausweg“ (GTB, Z. 6), - weiter, wie im Druck. Es war der Rat eines Geschäftsmannes, eines Unternehmers, der den Besitzern des Kirschgartens fremd und sogar feindselig gegenüberstand.
In der endgültigen Fassung malte Tschechow Lopakhin anders. Deshalb änderte er diesen gefühllosen Rat in einen sanften, zarten Appell einer Person, die Ranevskaya zutiefst zugetan ist. „Ich möchte dir etwas sehr Angenehmes, Fröhliches sagen ( auf die Uhr schauen). Ich gehe jetzt, ich habe keine Zeit zum Reden ... nun ja, ich sage es in zwei, drei Worten. Sie wissen bereits, dass Ihr Kirschgarten wegen Schulden verkauft wird, eine Auktion ist für den 22. August geplant, aber keine Sorge, schlafen Sie ruhig, es gibt einen Ausweg ... Hier ist mein Projekt“ (RSL. F. 331, l. 10) usw. Lopakhins Rede über die Sommerbewohner wird im gleichen Sinne korrigiert. Beim Abschied von Ranevskaya erinnert Lopakhin sie noch einmal: „Denken Sie ernsthaft nach“ (l. 12).
Die zweite Hälfte von Lopakhins Argumentation über die Sommerbewohner lautete zunächst so: „... in zehn oder zwanzig Jahren wird er zeigen, was er wirklich ist.“ Jetzt trinkt er nur noch Tee auf dem Balkon, aber es kann passieren, dass er sich mit seinem einen Zehnten um den Haushalt kümmert und dann, was zum Teufel ist kein Scherz, muss man mit ihm rechnen“ (GTB, L. 8) . Tschechow überarbeitet erneut den Anfang („in zehn oder zwanzig Jahren wird es sich vermehren und zu wirken beginnen“) und das Ende („und dann würde Ihr Kirschgarten glücklich und reich werden, und Sie würden ihn nicht wiedererkennen“) dieses Teils der Begründung (RSL. F. 331, Z. elf). Gleichzeitig führte Tschechow zwei Ausdrücke in die Rolle des Lopakhin ein, die im ersten Akt ausgesprochen wurden: „Herzlichen Glückwunsch („Mit einem Wort, herzlichen Glückwunsch, Sie sind gerettet“) und „Ich schwöre Ihnen“ („Es gibt keinen anderen Weg“) ... ich schwöre es“) (Bl. 10, elf). Gleichzeitig wurde die Bemerkung geändert „ summt" An " summt leise"(l. 24).
Tschechow erweitert die Rolle der Firs und betont seine Hingabe an die Meister. Vorhin zu Warjas Frage: „Firs, wovon redest du?“ Er antwortete: „Was willst du?“ Jetzt geht seine Bemerkung weiter. Er sagt glücklich: „Meine Dame ist angekommen! Gewartet! Jetzt stirb wenigstens ... ( Schluchzte vor Freude)“ (RSL. F. 331, Z. 8). In der ersten Ausgabe reagierte Firs auf Ranevskayas Appell gleich: „Was wollen Sie?“ Doch indem Tschechow die Farbigkeit, die Bühnenpräsenz seiner Rolle steigert, ändert er diese Bemerkung. Taube Tannen statt „Was möchtest du?“ antwortet „Vorgestern“ (ebd., L. 9).
In derselben Ausgabe sagte Firs: „Früher, vor 40 bis 50 Jahren, wurden Kirschen getrocknet, eingeweicht, eingelegt, Marmelade gekocht, und früher wurden getrocknete Kirschen in Wagenladungen nach Moskau und Charkow geschickt“ ( GTB, Fol. 7). Um die Theatralik dieser Geschichte zu steigern, unterbrach Tschechow sie mit einer Bemerkung von Gaev, und die Geschichte nahm die folgende Form an:
« Tannen. Früher, vor 40-50 Jahren, wurden Kirschen getrocknet, eingeweicht, eingelegt, Marmelade gekocht und es geschah ...
Gaev. Halt die Klappe, Tannen.
Tannen. Und es geschah ...“ (RSL. F. 331, Z. 11) usw.
Tschechow wandte sich dem Bild Warjas zu und hielt es für notwendig, ihre Unzufriedenheit mit ihrer Position zu verstärken und den Wunsch nach einem ruhigen, besinnlichen Leben deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Er fügte in ihre Bemerkung die Worte ein: „Ich würde immer noch zu heiligen Stätten gehen ... ich würde gehen und gehen“ (ebd., fol. 7).
Die Arbeit an anderen Charakteren beschränkte sich hauptsächlich auf das Hinzufügen einzelner Ausdrücke und Wörter. Die Rolle von Epikhodov wurde mit dem Satz ergänzt: „Es ist einfach wunderbar!“ Mit diesem Satz schloss er seine Überlegungen ab, bevor er zu Beginn des ersten Aktes das Kinderzimmer verließ. Anyas Bemerkungen sind mit Bemerkungen ausgestattet: leider(„Mama hat das gekauft“) (RGB. F. 331, Z. 3), kindlicher Spaß(„Und in Paris bin ich in einem Ballon geflogen!“) (l. 7).
Größere Korrekturen erforderten den zweiten Akt. Tschechow konkretisierte das farbenfrohe Bild von Epichodow, indem er ihm gleich zu Beginn dieses Aktes die Worte gab: „Ich bin ein entwickelter Mensch, ich lese verschiedene wissenschaftliche Bücher, aber ich kann einfach nicht verstehen, in welche Richtung ich eigentlich möchte, nämlich zu leben.“ oder um mich selbst zu erschießen, aber trotzdem habe ich immer einen Revolver bei mir. Da ist er... ( zeigt einen Revolver)“ (ebd., L. 19). In der ersten Ausgabe endete Epikhodovs Argumentation, die mit den Worten „eigentlich, ohne andere Themen zu berühren“ begann, wie folgt: „Das bin übrigens ich, Avdotya Fedorovna, und Sie verstehen sehr gut, warum ich das sage. . ( Pause). Lass mich mit dir reden, Awdotja Fjodorowna“ (Staatsbibliothek, Fol. 15-16). Die abschließenden Worte dieser Ansprache waren für Epikhodov nicht sehr charakteristisch, und deshalb ersetzte Tschechow sie durch Folgendes: „Haben Sie Buckle gelesen? ( Pause.) Ich möchte Sie, Awdotja Fjodorowna, für ein paar Worte stören“ (RSL, F. 331, fol. 20). Der Autor erweiterte die Rolle Epichodows und betonte seine Phrasendrescherei: „Jetzt weiß ich, was ich mit meinem Revolver machen soll.“ Diese Bemerkung bestimmte auch die zusätzlichen Worte von Dunyasha: „Gott bewahre, er wird sich erschießen“ (ebd.).
Um das Bild von Yasha satirisch zu schärfen, führt der Autor in seine Rede folgende Argumentation ein: „( gähnt.) Ja, mein Herr ... Meiner Meinung nach ist es so: Wenn ein Mädchen jemanden liebt, dann ist sie unmoralisch. Der Dramatiker betonte in Yasha die Qualitäten eines kalten, verdorbenen Egoisten, der sich nur mit Dunyasha amüsiert und sie nicht liebt, und ergänzte die letzte Zeile der Figur in dieser Episode mit den Worten: „Sonst werden sie sich treffen und an mich denken, als ob ich ein Date mit dir hätte. Ich kann es nicht ertragen“ (ebd.).
In die Szene „Herren“, die die Szene „Diener“ ersetzt, fügte der Dramatiker nach Lopakhins Worten, dass Menschen „eigentlich Riesen sein sollten“, folgenden Zusatz ein:
« Ljubow Andrejewna. Brauchen Sie Riesen? Sie sind nur in Märchen gut und deshalb machen sie Angst.
(Epikhodov geht im hinteren Teil der Bühne vorbei).
Ljubow Andrejewna(nachdenklich). Epichodow kommt...
Anya(nachdenklich). Epichodow kommt.
Warja. Warum lebt er bei uns? Isst und trinkt den ganzen Tag nur nebenbei...
Ljubow Andrejewna. Ich liebe Epichodow. Wenn er über sein Unglück spricht, wird es lustig. Feuern Sie ihn nicht, Warja.
Warja. Das kannst du nicht, Mama. Es ist notwendig, ihn, den Schurken, zu feuern“ (RSL. F. 331, Z. 27).
Tschechow bereichert die Rollen fast aller Teilnehmer der „Gentlemen“-Szene. In der ersten Jalta-Ausgabe sprach Lopakhin auf der Bühne kategorisch, fordernd und trocken: „Wir müssen uns endlich entscheiden – die Zeit wartet nicht.“ Sind Sie damit einverstanden, das Land für Datschen zur Verfügung zu stellen oder nicht?“ (AGB, Z. 16). Nach der Änderung wurde Lopakhins Appell sanfter und sogar bettelnd: „Wir müssen uns endlich entscheiden – die Zeit wartet nicht.“ Die Frage ist völlig leer. Sind Sie damit einverstanden, das Land für Datschen zur Verfügung zu stellen oder nicht? Antwort in einem Wort: ja oder nein? Nur ein Wort!" (RSL. F. 331, Z. 20). In der nächsten Bemerkung wiederholte Lopakhin fast wörtlich die Worte des ersten Appells: „Sind Sie damit einverstanden, das Land für Datschen zur Verfügung zu stellen, oder nicht?“ Um Lopakhins Rede abwechslungsreicher zu gestalten, ersetzte der Autor diese Bemerkung durch eine andere: „Nur ein Wort ( flehend). Gib mir eine Antwort!" (ebd., L. 21).
In einem weiteren Gespräch sagte er zu Ranevskaya: „Ihr Anwesen steht zum Verkauf. Verstehen Sie, dass es im Angebot ist! Müssen Sie etwas tun?“ (AGB, Z. 17). Die letzten Worte aus Lopakhins Mund, der wusste, was zu tun war und Ranevskaya beharrlich den einzig zuverlässigen Ausweg aus der Situation anbot, schienen Tschechow unangemessen, und er änderte sie wie folgt: „Ihr Anwesen steht zum Verkauf, aber Sie definitiv nicht.“ 'nicht verstehen“ (RSL. F. 331, Blatt 22).
Lopakhin bot Ranevskaya einen rettenden Weg an und erklärte: „Sobald Sie sich endgültig dafür entschieden haben, dass es Datschen gibt, können Sie in drei Tagen so viel Geld bekommen, wie Sie möchten“ (GTB, S. 17). In Übereinstimmung mit allen früheren Warnungen Lopachins vor der drohenden Katastrophe – dem Verkauf des Anwesens – bekräftigt Tschechow die Konkretheit, Kategorisierung und Überzeugungskraft dieses Satzes: „Sobald Sie sich endgültig dafür entschieden haben, dass es Datschen gibt, werden sie Ihnen so viel Geld geben, wie Sie möchten.“ , und dann wirst du gerettet“ (RGB. F 331, Blatt 22).
In der Rolle der Ranevskaya werden mehrere neue Akzente gesetzt. Zuvor antwortete Ranevskaya auf Lopakhins scharfe Vorwürfe der Untätigkeit irgendwie träge und vage: „Was? Lernen, was?" (AGB, Z. 17). Ihre Antwort weckte großes Interesse: „Was sollen wir tun?“ Lernen, was?" (RSL. F. 331, Z. 22). Dementsprechend erscheinen in ihrem weiteren Appell an Lopakhin die Worte: „Liebling“ („bleib, mein Lieber“), „mein Freund“ („Du musst heiraten, mein Freund“) (ebd., L. 26 ).
Wie wir sehen, hat Tschechow in dem vom Theater bereits akzeptierten und von der Zensur zugelassenen Stück mit außergewöhnlicher Sorgfalt neue Nuancen in die Bilder aller Figuren eingebracht.
Ein Beispiel für Tschechows überraschend gründliche Verarbeitung nicht nur der Sprache seiner Charaktere, sondern auch ihrer Bemerkungen kann der folgende Satz sein: „ Tannen eilten über die Bühne, in alter Livree und mit hohem Hut, auf einen Stock gestützt; er etwas..." usw. Zurück in Jalta nahm diese Bemerkung die folgende Form an: Firs geht hastig über die Bühne, nachdem er Ljubow Andrejewna entgegengegangen ist; Er trägt eine alte Livree und einen hohen Hut, auf einen Stock gestützt, er ist etwas ...". In Moskau erhielt die Bemerkung eine Neuauflage, die den natürlichen Handlungsablauf des Dieners verdeutlicht: „ Firs, der Ljubow Andrejewna entgegengegangen war, geht, auf einen Stock gestützt, eilig über die Bühne; Er trägt eine alte Livree und einen hohen Hut, er ist etwas ..." usw. (RSL. F. 331, Z. 4).
Tschechow musste aufgrund der Zensurauflagen zwei Korrekturen am Stück vornehmen. Im zweiten Akt, in der Szene der Herren, hält der Student Trofimov eine Schmährede, aus der die Zensur die Worte gestrichen hat: „Vor aller Augen essen die Arbeiter ekelhaft, schlafen ohne Kissen, dreißig oder vierzig in einem Zimmer“ ( GTB, fol. 22). Tschechow ersetzte sie durch diese: „Die überwiegende Mehrheit von uns, neunundneunzig von hundert, leben wie Wilde, nur ein bisschen – jetzt stochern sie herum, fluchen, sie essen ekelhaft, sie schlafen im Schlamm, in der Verstopfung.“ Im dritten Akt hat die Zensur die Worte in Trofimovs Ansprache an Anya geschwärzt: „Lebende Seelen besitzen – schließlich hat es euch alle wiedergeboren, die vorher gelebt haben und jetzt leben, sodass eure Mutter, ihr Onkel euch nicht mehr bemerken.“ in Schulden leben, auf Kosten anderer, auf Kosten der Menschen, die man nicht weiter als bis an die Front lässt“ (ebd., L. 24). Tschechow war gezwungen, diese Worte durch folgendes zu ersetzen: „Oh, das ist schrecklich, dein Garten ist schrecklich, und wenn du abends oder nachts durch den Garten gehst, leuchtet die alte Rinde der Bäume schwach und es scheint, als ob die Kirschbäume sehen im Traum, was vor hundert oder zweihundert Jahren war, und schwere Visionen quälen sie. ( Pause.) – Was soll man sagen“ (RSL. F. 331, Z. 29).
Alle Korrekturen, die wir gerade notiert haben, waren im Hauptmanuskript enthalten, das im Oktober 1903 nach Moskau geschickt wurde. Dieses oben zitierte Manuskript wird bedingt als das Moskauer Manuskript bezeichnet (denken Sie daran, dass es in der Abteilung für wissenschaftliche Manuskriptforschung der RSL aufbewahrt wird). .
Tschechows ernsthafte Arbeit am Text des bereits einstudierten Stücks erlangte außerhalb des Kunsttheaters Berühmtheit. So berichtete die Zeitschrift Theater und Kunst, dass der Dramatiker „den ersten Akt des Stücks zurücknahm und einer gründlichen Änderung unterzog“ (1904, Nr. 1, S. 5).
7
Am 17. Januar 1904 wurde das Stück „The Cherry Orchard“ im Art Theatre uraufgeführt. Die Aufführung wurde trotz der sehr widersprüchlichen Reaktionen auf das Stück – positiv, negativ und verwirrend – als großes Theaterereignis wahrgenommen. Am 18. Januar berichtete die Moskauer Zeitung Russki Listok: „Gestern wurde zum ersten Mal ein neues Stück von A.P. Tschechow „Der Kirschgarten“. Im Saal war das gesamte literarische und künstlerische Moskau zu sehen. Der Eindruck vom „Cherry Orchard“ ist enorm. Alle vom Autor gezeichneten Gesichter waren uns so nah und vertraut; Das Leben, das russische Leben, wird in einer ganzen Reihe kleiner Details so originalgetreu eingefangen und anschaulich vermittelt, dass das Interesse am Stück erst in der letzten Szene verschwand. Alle Darsteller haben sich bemüht, aus ihren Rollen helle und interessante Typen zu machen. 25. Januar in der Zeitschrift „Wecker“, signiert Kobold, Gedichte wurden gedruckt: „A.P. Tschechow (nach der Inszenierung von „The Cherry Orchard“):
Literatur unserer Tage
Alles ist mit Kletten bewachsen ...
„The Cherry Orchard“ ist von nun an drin
Lassen Sie es mit „neuen Blumen“ locken.
Das Stück wurde bereits für die zweite Sammlung des Znanie-Verlags geschrieben und eine Korrekturlesung erwartet. Am 20. Januar 1904 informierte Tschechow L.V. Sredinu: „Ich habe keine Lust mehr auf das Stück, jetzt kann ich mich an den Tisch setzen und Ihnen schreiben“ (P., Bd. 12, S. 16). Unterdessen war Tschechow weder mit dem Stück noch mit seiner Inszenierung ganz zufrieden. Der „Rigger“ mit dem Stück ging weiter, obwohl alle wichtigen Dinge erledigt und zurückgelassen wurden. Der Autor lebte jedoch immer noch mit dem Stück, er konnte sich nicht davon losreißen und nahm neue Korrekturen am Text vor. Eine dieser Korrekturen wurde durch die Produktion des Art Theatre ausgelöst. Dem Regisseur schien es, dass am Ende des zweiten Akts die lyrische Episode von Firs und Charlotte, die „nach der lebhaften Szene der Jugend ... ging, die Stimmung der Handlung senkte“ (Stanislavsky, Bd. 1, S. 473). Und nach den ersten Aufführungen, als die Schwächen des zweiten Akts besonders deutlich zutage traten, wurde Tschechow gebeten, diese Episode zu verfilmen. K.S. Stanislawski sagte, dass Tschechow „sehr traurig wurde, blass wurde von dem Schmerz, den wir ihm damals zufügten, aber nachdem er nachgedacht und sich erholt hatte, antwortete er: „Reduzieren!“ (ebd., S. 270).
Offensichtlich nahm Tschechow neue Korrekturen in einer Art maschinengeschriebener Kopie des Stücks vor, von der sie dann auf den Text des Theatermanuskripts und auf das Korrekturlesen des Stücks übertragen wurden, das erstmals in der zweiten Wissenssammlung veröffentlicht wurde. Folglich gab es ein drittes Autorenmanuskript (Ausgabe) des Stücks, das uns jedoch leider nicht erreichte. Diskrepanzen zwischen dem zweiten (Moskau) und dem dritten Manuskript werden nur durch den Vergleich des zweiten Manuskripts mit dem gedruckten Text festgestellt. Was sind diese neuen Korrekturen, abgesehen von der Eliminierung der bereits erwähnten Szene von Fiers und Charlotte?
Der erste Akt beinhaltete einen Dialog zwischen Pishchik und Lyubov Andreevna:
« Pischtschik (Ljubow Andrejewna). Was gibt es in Paris? Wie? Hast du Frösche gegessen?
Ljubow Andrejewna. Aß Krokodile.
Pischtschik. Denkst du..."
Gleichzeitig kam auch die Episode mit Pillen ins Spiel:
« Yasha (gibt Lyubov Andreevna Medikamente). Vielleicht nimmst du jetzt ein paar Pillen...
Pischtschik. Es besteht keine Notwendigkeit, Medikamente einzunehmen, mein Lieber ... sie schaden oder nützen nicht ... Gib mir hier ... Schatz. (Er nimmt Tabletten, schüttet sie in seine Handfläche, bläst darauf, steckt sie in den Mund und trinkt Kwas.) Hier!
Ljubow Andrejewna (erschrocken). Ja, du bist verrückt!
Pischtschik. Ich habe alle Pillen genommen.
Lopakhin. Was für ein Abgrund. (Alle lachen.)
Tannen. Sie waren bei uns in Svyatoy, sie haben einen halben Eimer Gurken gegessen ... "
Die soeben zitierten Ergänzungen haben den komischen Charakter von Pishchiks Bild deutlich gestärkt. Indem er den Dialog zwischen Pishchik und Ranevskaya sowie die Episode mit Pillen einbezog, schloss Tschechow gleichzeitig die Szene mit Charlottes Trick aus. In Jalta ( oder zensiert) des Manuskripts näherte sich Charlotte, bevor sie schließlich die Bühne verließ, der Tür und fragte: „Jemand steht vor der Tür. Wer ist da? ( klopfe von der anderen Seite an die Tür.) Wer klopft? ( klopfen). Das ist mein Verlobter! ( Blätter. Alle lachen)“ (GTB, Z. 9).
Als Tschechow in Moskau ankam, gab er eine andere Version dieser Episode:
« Lopakhin. Charlotte Iwanowna, zeig mir den Trick.
Ljubow Andrejewna. Charlotte, zeig mir den Trick!
Charlotte (zur Tür kommen). Wer ist hinter der Tür? Wer ist da? ( klopfe von der anderen Seite an die Tür). Wen klopft es? ( klopfen). Das ist Herr Bräutigam. ( Blätter. Alle lachen)“ (RSL. F. 331, Z. 12).
Diese Option befriedigte den Dramatiker jedoch nicht und er hielt es für das Beste, die Szene scharf zu drehen. Charlotte antwortet auf die Bitten von Lopakhin und Ranevskaya, den Trick zu zeigen: „Keine Notwendigkeit. Ich möchte schlafen." Und verlässt.
Aufgrund des Wunsches des Regisseurs, die Szene mit Tannen und Charlotte wegzulassen, nahm Tschechow im zweiten Akt sehr bedeutende Umgestaltungen vor. Einen Teil dieser Szene, nämlich Charlottes Geschichte über ihr Leben, behielt Tschechow bei, verschob ihn an den Anfang desselben Aktes und ersetzte ihn durch den Dialog zwischen Anya und Trofimov. Der Dialog junger Menschen brachte nichts Neues in die Entwicklung der Aktion ein, sondern verlangsamte sie nur. So begann der zweite Akt nun mit einer Dienerszene und direkt mit Charlottes Monolog. Epikhodovs Argumentation erschien dem Dramatiker zu lang und verwandelte sich in einen Monolog, und dann trennte er sie mit Charlottes Bemerkung: „Es ist vorbei. Jetzt gehe ich“ usw.
Tschechow führte einige Änderungen in diesem Akt und in der Herrenszene ein. Er entfernte die Episode, in der Warja und Anya die Straße entlang gingen, da ihr Dialog, ohne die Handlung zu entwickeln, Lopakhins Gespräch mit Ranevskaya und Gaev unterbrach. Er strich auch die Bemerkungen von Warja, Lopachin und Ranewskaja zu Epichodow, weil sie seiner ohnehin schon klaren Charakterisierung nichts hinzufügten. Auch die junge Szene, die nun endgültig geworden ist, wurde einer teilweisen Überarbeitung unterzogen. Zuvor, nach Anyas enthusiastischem Ausruf: „Wie gut hast du gesagt!“ - Sie tauschten Bemerkungen aus:
« Trofimov. Psst... Da kommt jemand. Wieder diese Warja! ( wütend). Empörend.
Anya. Also? Lass uns zum Fluss gehen. Es ist gut dort.
Trofimov. Lass uns gehen... ( gehen).
Anya. Der Mond wird bald aufgehen Geh weg)“ (GTB, Z. 24).
Diese zu abrupten Bemerkungen, die sie prosaisch reduzierten, unterbrachen Trofimovs Reden, die tief in der Bedeutung, lebendig in der Ausdruckskraft und pathetisch im Ton waren. Der Student selbst war davon begeistert und entführte seinen jungen Zuhörer in ein neues Leben, in den öffentlichen Dienst. Tschechow spürte diesen Mangel offenbar und korrigierte ihn. Er setzte das erbärmliche Gespräch junger Menschen über Glück fort und gab ihm eine real-symbolische Bedeutung, indem er das Bild des aufgehenden Mondes einführte – Anya und Trofimov gehen zum Fluss, um den Mond zu bewundern.
Im Zusammenhang mit der von Tschechow nach der Uraufführung am 16. Februar 1904 vorgenommenen Änderung des zweiten Aktes erschien in der Zeitung News of the Day folgende Meldung: „A.P. Tschechow nahm mehrere Änderungen an „Der Kirschgarten“ vor, und mit diesen Änderungen ging das Stück zu seinen letzten Aufführungen über. Sie betreffen den 2. Akt, der einen vagen Eindruck hinterließ. Das bisherige Ende des Aktes, das Gespräch zwischen Charlotte und Firs, wird komplett unterbrochen. Nun endet der Akt mit einer Szene zwischen Anya und Trofimov, die zum Fluss fliehen. Ihre Noten von jungem Gefühl, jungem Glauben färben den letzten Eindruck der Tat ganz anders, er wirkt nicht mehr so zäh. Ein Teil von Charlottes Geschichte – über Eltern, Zauberer, Kindheit – wird als Beginn des Aktes platziert. Epikhodovs „grausame Romanze“ wird in die Eröffnungsszene eingefügt. Es wird mit viel Humor von Herrn Moskvin mit einer Gitarre gesungen. Gitarrenbegleitung in einer kurzen stillen Szene hinzugefügt, in der Epikhodov im Hintergrund vorbeigeht. Diese Szene blieb völlig unnötig, überflüssig, jetzt trägt sie etwas zur Gesamtfarbe des Augenblicks bei.“
Im dritten Akt hinterließ die Dramatikerin eine der beiden wiederholten Zeilen von Ranevskaya, die sie in der Szene von Charlottes Streichen ausgesprochen hatte, und übergab die zweite dem Bahnhofsvorsteher. In früheren Ausgaben hieß es: Ljubow Andrejewna (applaudiert). Bravo, Bravo! ( Auch im Saal gab es Applaus)". Es wurde: Stationsmeister (applaudiert). Frau Bauchrednerin, bravo!“
Alle weiteren in diesem Zeitraum vorgenommenen Änderungen dienten dazu, die individuelle Charakterisierung der Charaktere zu vertiefen. Die Rolle der Ranevskaya hat bereits in früheren Ausgaben die nötige Vollständigkeit erlangt. Bei der Überarbeitung des Stücks gelang es Tschechow jedoch, diese Rolle durch mehrere neue Wörter und Ausdrücke zu erweitern. Sie alle beteiligten sich am Gespräch zwischen Ranevskaya und Trofimov, das im dritten Akt stattfindet. Hier sind sie: „Aber ich habe definitiv mein Augenlicht verloren, ich sehe nichts“; „Aber sag es mir, mein Lieber“; „dies“ („ist es, weil du jung bist“); „Nur das Schicksal wirft dich von Ort zu Ort.“ Wenn die ersten drei Einfügungen Ranevskayas Sanftheit und Sentimentalität verstärken, dann enthüllt der letzte Satz zusammen mit anderen Fakten die Gründe für Trofimovs so langen Aufenthalt als Student: Er wurde ständig aus Moskau ausgewiesen.
Ernsthafter war die Bearbeitung von Lopakhins Rolle. Jetzt tauchen Trofimovs Worte auf, die Lopakhin Züge von Zärtlichkeit, Komplexität und Kunst verleihen. „Schließlich“, sagt Trofimov und wendet sich an Lopakhin, „liebe ich dich immer noch. Du hast dünne, zarte Finger, wie ein Künstler, du hast eine so zarte Seele. In Übereinstimmung mit diesem Merkmal treten in der Rolle von Lopakhin Tendenzen einer gewissen sprachlichen Raffinesse auf. Tschechow gibt die dritte Auflage von Lopachins Argumentation über die Sommerbewohner und endet mit den Worten: „Und dann wird Ihr Kirschgarten glücklich, reich, luxuriös.“
Im dritten Akt, in Lopakhins Monolog, nach den Worten „Lach mich nicht aus!“ war: „Ich brauche es nicht, ich brauche es nicht, ich brauche es nicht!“ Tschechow hielt diese Worte für überflüssig und strich sie. Bemerkungen passen in denselben Monolog. Davor hieß es: Hebt die Tasten an„(Von Warja aufgegeben. – A. R.) (RSL. F. 331, L. 43), und es wurde:“ Hebt die Schlüssel hoch und lächelt liebevoll". Lopakhins Ausrufe: „Was ist das? Musik, spiel sie deutlich! Lass alles so sein, wie ich es wünsche!“ Tschechow begleitete die Bemerkung: „ mit Ironie“, was sie sofort komplizierte und ihnen eine grobe Kategorisierung nahm. Dritte Anmerkung“ man kann die Orchesterstimmung hören“ wird hinzugefügt, um Lopakhins Anziehungskraft auf Musiker zu erklären: „Hey, Musiker“ usw. ( Dort). Auch hier wird die Gewissheit in Bezug auf Lopachin und Warja gestärkt. Zuvor antwortete er auf Ranevskayas Vorschlag, Vara zu heiraten: „Na und? Es macht mir nichts aus..." Dort). Tschechow ergänzte diese Bemerkung mit den Worten: „Sie ist ein gutes Mädchen.“ Nach diesen Worten, die Ranevskayas Einschätzung von Warja als bescheidenem Arbeiter buchstäblich wiederholen, wird klar, dass Lopakhin kein besonderes Mitgefühl empfand – ein überhebliches Gefühl für Warja. In diesem Zusammenhang ist auch das gleichzeitig eingebrachte Geständnis Lopachins verständlich: „Ohne Sie werde ich Ihnen wohl kein Angebot machen.“
Lopakhins Rede wird durch zwei weitere Bemerkungen ergänzt: „Lass ihn reden“ (d. h. Gaev über ihn als einen Idioten und eine Faust; d. I), „nur sitzt er nicht still, er ist sehr faul“ (über Gaev, der trat an die Stelle eines Bankbeamten; d. IV).
Die Rolle von Trofimov erhielt neben der bereits gegebenen Einschätzung von Lopakhin auch eine Reihe zusätzlicher Akzente. Auf Lopakhins Frage: „Wirst du dort ankommen?“ - Er antwortete: „Ich werde andere erreichen oder ihnen den Weg zeigen.“ Tschechow, der Trofimovs Glauben an die Zukunft stärkt, geht diesem Satz mit der entscheidenden Aussage „Ich werde es schaffen“ voran und leitet außerdem eine Pause ein, nach der der Schüler seinen Gedanken beendet. Der Dramatiker betont Trofimovs Integrität und Begeisterung und fügt im dritten Akt die folgende Bemerkung und Bemerkung als Antwort auf Ranevskaya hinzu: „( geht, kehrt aber sofort zurück). Es ist vorbei zwischen uns!" Um Warja zu charakterisieren, enthält Trofimovs Rede die an Anya gerichteten Worte: „und verlässt uns nicht für ganze Tage“ (gest. II).
In Anlehnung an die Spontaneität der kindisch leichtgläubigen Anya ergänzte Tschechow ihre Antwort auf Gaevs Eide, Zinsen für das Anwesen zu zahlen, mit einer Bemerkung: Ihre Stimmung ist wieder ruhig, sie ist glücklich“, und in die Antwort schrieb er: „Ich bin glücklich.“ Im selben (ersten) Akt werden zur Konkretisierung von Anyas Rede die Wörter „dazu“ („vor sechs Jahren“) und „hübsch“ („hübscher siebenjähriger Junge“) eingeführt. In diesem Akt werden auch zwei Bemerkungen zu Anya hinzugefügt. Zur Bemerkung „ umarmt Warja» fügte das Wort hinzu « ruhig“, und zu Anyas Nachricht über den Mann in der Küche, der das Gerücht über den Verkauf des Anwesens verbreitete, ist die Bemerkung beigefügt: „ aufgeregt».
Der Rolle von Vari wurden einige Nuancen hinzugefügt. Ihre Worte über Lopakhin, die sie Anya bei ihrem ersten Treffen sagte, wurden gestrichen: „Und er selbst sieht aus, als würde er gerade ein Angebot machen“ (RSL. F. 331, Z. 7). Dies schwächt sofort die Aussichten für ihre Ehe. Außerdem wurden folgende Worte entfernt, in denen Warja in einem untypischen, zu verstörenden, dramatischen Geisteszustand erscheint: „Manchmal wird es sogar unheimlich, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll“ (Z. 9). Tschechow entfernt auch ihre scharfe, unangemessene und im Verlauf der Handlung vorkommende Bemerkung über Firs, der vor Freude weint: „Na, du Narr!“ (l. 8). Darüber hinaus, so Warja: „Onkel hat es gekauft, da bin ich mir sicher“, fügte Tschechow eine Bemerkung hinzu: „ versuche sie zu beruhigen"(gest. III). Bemerkung - " Er schwingt, der Schlag trifft Lopakhin, der gerade hereinkommt„- er gibt in einer anderen Ausgabe:“ Er schwingt, zu diesem Zeitpunkt kommt Lopakhin herein"(gest. III). Teil der Bemerkung – „ Lopakhin prallt ab„ – wie folgt geändert: „ Lopakhin tut so, als hätte er Angst"(gest. IV).
In der Rolle der Dunyasha vertiefte Tschechow die Züge vorgetäuschter Zärtlichkeit, Zerbrechlichkeit und Verträumtheit. Zu den Worten „Hände zittern“ fügte er hinzu; "Ich werde ohnmächtig." Der Ausdruck „Herr ... Herr“ wurde ersetzt durch: „Ich werde jetzt fallen ... Oh, ich werde fallen!“ Er ergänzte ihre Bemerkung im dritten Akt mit dem Bekenntnis: „Ich bin so ein zartes Mädchen.“ Ihre Antwort an Epikhodov im selben Akt: „Bitte, wir reden später... an einem anderen Ort“ wurde geändert in: „Bitte, wir reden später, aber jetzt lassen Sie mich in Ruhe.“ Jetzt träume ich spielt mit einem Ventilator)". Im gleichen Stil falscher Affektiertheit enthält Dunyashas Geschichte über Epikhodov eine stolze Aussage: „Er liebt mich wahnsinnig“ (Fall I).
Die endgültige Verfeinerung des Stücks wirkte sich auch auf andere Charaktere aus, allerdings in geringerem Maße. Tschechow betont die Selbstzufriedenheit Jaschas und gleicht seine abfällige Einschätzung Epichodows mit den Worten aus: „Leerer Mann!“ Der Autor verstärkte die Merkmale egoistischer Gleichgültigkeit und moralischen Zynismus in Yasha weiter. Zuvor beantwortete er die Memoiren von Firs mit der Bemerkung: „Du bist müde, Großvater ( lacht). Wenn du nur früher sterben würdest“ (RSL, F. 331, fol. 39). Bemerkung " lacht' wird jetzt in 'gähnt' geändert. Epikhodov im vierten Akt, der zum ersten Mal geht: „ auf etwas Hartes und Zerquetschtes getreten ist„(l. 48), und in der endgültigen Fassung:“ Er stellte den Koffer auf die Hutschachtel und zerdrückte sie.". Das ist konkreter. In früheren Ausgaben sagte Firs, nachdem er die Dame getroffen hatte: „ schluchzte vor Freude„(l. 8), und im Schlusstext:“ weinte vor Freude". Das ist natürlicher. Der Dramatiker ließ die Worte in Firs' Schlussbemerkung weg: „Ich werde sitzen... mir geht es gut, so ist es schön“ (Z. 55). Unserer Meinung nach fielen diese Worte aus dem allgemeinen Kontext der letzten Szene und entsprachen nicht dem krankhaften Zustand von Firs; In den ersten Ausgaben hieß es: Tannen dringt in den Mantel ein“(l. 24), und für die Presse gab Tschechow eine andere Ausgabe.
Gaevs Abschiedsrede schien dem Dramatiker offenbar zu lang zu sein, und er strich ihr Ende durch: „Meine Freunde, ihr, denen es genauso ging wie mir, die ihr es wisst“ (RSL. F. 331, Z. 52-53) . Zur Rolle von Gaev wurden auch zwei Bemerkungen hinzugefügt: „ lustig- zu den Worten: „In der Tat ist jetzt alles in Ordnung“ und „ leider„- zu den Worten: „Ein gelbes Wams in der Mitte.“
Alle von Tschechow vorgenommenen Korrekturen nach der Übersendung des Manuskripts an den Satz wurden von ihm in die erste Korrekturlesung einbezogen, die er Ende Januar 1904 las (P., Bd. 12, S. 27).
8
Am 24. März auf die Fragen von O.L. Einige Details zur Rolle Dunjascha Tschechows hat Knipper bereits mit Verweis auf den abgedruckten Text beantwortet. „Sagen Sie der Schauspielerin, die die Magd Dunyasha spielt“, schrieb er, „sie soll The Cherry Orchard in der Ausgabe von Knowledge oder als Probeexemplar lesen; dort wird sie sehen, wo sie pudern kann und so weiter. usw. Lass ihn es unbedingt lesen, in deinen Notizbüchern ist alles durcheinander und verschmiert“ (S., Bd. 12, S. 70). Damit begründete Tschechow die Kanonizität des gedruckten Textes. Dennoch wies der Text, nach dem das Stück im Moskauer Kunsttheater aufgeführt wurde, einige Unterschiede zum gedruckten Text auf. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Zunächst wurden bei der Vorbereitung der Aufführung einzelne Nachbildungen von den Schauspielern selbst in ihre Rollen eingeführt, die sich an die Rolle gewöhnten und diese bereichern wollten. 16. März 1904 O.L. Knipper schrieb an Tschechow: „Moskwin bittet darum, im 4. Akt eine Phrase einzufügen. Als er den Karton zerdrückt, sagt Yasha: „22 Unglücke“, und Moskvin möchte wirklich sagen: „Nun, das kann jedem passieren.“ Er sagte es irgendwie aus Versehen und die Öffentlichkeit akzeptierte es. Tschechow stimmte dieser Einfügung sofort zu. „Sagen Sie Moskvin“, schrieb er, „dass er neue Wörter einfügen kann, und ich werde sie selbst einfügen, wenn ich die Korrekturen lese.“ Ich gebe ihm den vollen Freibrief“ (P., Bd. 12, S. 67).
Ende April las Tschechow das zweite Korrekturlesen des Stücks, das in der zweiten Sammlung von „Wissen“ veröffentlicht wurde, aber Epichodows Bemerkung, vorgeschlagen von I.M. Moskvin hat keinen Beitrag geleistet. Warum? Schließlich hat er es bereits genehmigt. Unserer Meinung nach hat Tschechow einfach vergessen, es aufzunehmen. Er hatte es eilig, Korrekturabzüge zu lesen und zu verschicken, da sich die Veröffentlichung der Sammlung stark verzögerte und die Provinztheater für Aufführungen dringend den Text des Stücks verlangten. Tschechow war an diesen Produktionen sehr interessiert. Außerdem ging es dem Dramatiker in diesen Tagen sehr schlecht. Es besteht kein Zweifel, dass er diese Bemerkung bei der Lektüre der Korrekturfahnen einer separaten Ausgabe des Stücks, veröffentlicht von A.F., eingefügt hätte. Marx. Er beabsichtigte, weitere Korrekturen am Stück vorzunehmen. Am 31. Mai schrieb er an A.F. Marx: „Ich habe Ihnen die Korrekturabzüge geschickt und bitte Sie nun dringend, mein Stück erst zu veröffentlichen, wenn ich es fertiggestellt habe; Ich möchte noch eine Beschreibung der Charaktere hinzufügen“ (P., Bd. 12, S. 110).
Um die Beweise zu korrigieren, änderte Tschechow die Worte von Lopakhin, die zu Beginn des Stücks von „einem Jungen von fünf oder sechs Jahren“ ausgesprochen wurden, in „... fünfzehn“. In diesem Alter wurde deutlich, welchen großen Eindruck sein erstes Treffen mit Ranevskaya auf Lopakhin machte. Vielleicht hätte Tschechow von den Künstlern vorgeschlagene weitere Ergänzungen zu seinem Stück vorgenommen (zwei im Museum des Kunsttheaters aufbewahrte Souffleurexemplare – eine frühe und eine spätere Inszenierung des Stücks „Der Kirschgarten“ – weisen viele Abweichungen vom gedruckten Text auf). Viele „Gags“, wie etwa die französischen Phrasen des Lakaien Jascha, erregten jedoch Tschechows Unmut: „... Das bin nicht ich!“ Das haben sie sich ausgedacht! Es ist schrecklich: Die Schauspieler sagen: „Tu, was ihnen in den Sinn kommt“, und der Autor antwortet!“
9
Tschechow riet jungen Schriftstellern aufgrund seiner Erfahrung beharrlich, ihre Werke noch einmal zu lesen, neu zu gestalten, zu kürzen und sorgfältig zu verfeinern. Schreiben bedeutete für ihn Arbeit und die Belastung aller seiner schöpferischen Fähigkeiten und Kräfte. Tschechow war sehr beleidigt, als L.S. Mizinova bezeichnete 1893 in einem freundlichen Brief (vom 22. August) seine kreative Arbeit als „Schreiben zu ihrem eigenen Vergnügen“. Hier ist, was er ihr antwortete: „Was das Schreiben zu Ihrem eigenen Vergnügen betrifft, Sie, charmant, haben es nur getwittert, weil Sie mit der Schwere und bedrückenden Macht dieses Wurms nicht vertraut sind, der das Leben untergräbt, egal wie klein es auch erscheinen mag.“ du“ (P., Bd. 5, S. 232).
Langjähriges Schreiben überzeugte Tschechow davon, dass die Schaffung wahrhaft künstlerischer Werke, selbst in Anwesenheit eines genialen Talents, nur durch lange, geduldige und sorgfältige Arbeit möglich ist. "Muss arbeiten! Viel arbeiten! er wiederholte. „Und je teurer die Sache, desto strenger muss sie behandelt werden.“
Das Ergebnis künstlerischen Genies und langer, harter kreativer Arbeit war Tschechows poetisches Meisterwerk – das Stück „Der Kirschgarten“.
„... Die Symbolik verbirgt sich bereits im Titel des Stücks. Ursprünglich wollte Tschechow das Stück „Der Kirschgarten“ nennen, entschied sich dann aber für den Titel „Der Kirschgarten“. K.S. Stanislavsky erinnerte sich an diese Episode und erzählte, wie Tschechow, nachdem er ihm die Änderung des Titels angekündigt hatte, sie genoss, indem er „auf den sanften Klang im Wort „Kirsche“ drückte, als würde er mit seiner Hilfe versuchen, das frühere, schöne zu streicheln. aber jetzt unnötiges Leben, das er in seinem Stück mit Tränen zerstörte. Diesmal verstand ich die Subtilität: „The Cherry Orchard“ ist ein geschäftlicher, kommerzieller Garten, der Einkommen generiert. Ein solcher Garten wird jetzt benötigt. Doch der „Kirschgarten“ bringt kein Einkommen, er bewahrt in sich und in seinem blühenden Weiß die Poesie des einstigen Adelslebens. Ein solcher Garten wächst und blüht aus einer Laune heraus, für die Augen verwöhnter Ästheten. Es ist schade, es zu zerstören, aber es ist notwendig, da der Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes es erfordert“ (Stanislavsky, Bd. 1, S. 269).
Es sei darauf hingewiesen, dass die Symbolik des Titels des Stücks „Der Kirschgarten“, wie sie vom Regisseur verstanden wird, keine vollständige Befriedigung darstellt und bei unseren Lesern und Zuschauern zu verwirrten Fragen führen kann. Zum Beispiel wurde „Warum“ als Symbol für das Aufgeschlossene, Veraltete gewählt Der Kirschgarten- die Personifizierung von Poesie und Schönheit? Ich erinnere mich an die wunderbaren Zeilen von Nekrasov:
Wie in Milch getränkt
Es gibt Kirschgärten,
Ruhiges Geräusch...
(„Grünes Rauschen“).
Warum ist die neue Generation aufgerufen, die Schönheit der Vergangenheit zu zerstören, anstatt sie zu nutzen? Und gleichzeitig muss man zugeben, dass in Stanislawskis Interpretation der Symbolik des Titels des Stücks etwas Wahres steckt …
Die Symbolik des Titels des Stücks beschränkt sich jedoch nicht auf das gerade Gesagte, sie ist umfangreicher und vielseitiger. Es befasst sich nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft. Der Kirschgarten von Ranevskaya und Gaev ist eine veraltete, abgehende Vergangenheit. Aber schließlich träumten Trofimov, Anya und hinter ihnen Tschechow von der Zukunft. Und diese Zukunft nahm in ihren Köpfen auch das Bild eines Gartens an, aber noch luxuriöser, der allen Menschen Freude bereiten kann. Und so erscheint im Laufe der Entwicklung des Stücks ein Bild darin Kirschgarten wie die Schönheit des Lebens...
K.S. beschreibt das Stück. Stanislavsky schrieb: „Sein Charme liegt in seinem schwer fassbaren, tief verborgenen Aroma“ (Bd. 1, S. 270).
Dieser Charme von „The Cherry Orchard“ wird größtenteils durch Pausen, Musik und Mittel realer Symbolik verliehen, die die psychologische Spannung des Stücks erhöhen, seinen Inhalt erweitern, seine ideologische Bedeutung vertiefen ...“
Die Idee, das Stück „Der Kirschgarten“ zu schreiben, erwähnt A.P. Tschechow erstmals in einem seiner Briefe vom Frühjahr 1901. Zunächst war sie von ihm als „lustiges Theaterstück konzipiert, in dem der Teufel wie ein Joch wandeln würde“. Im Jahr 1903, als die Arbeit an „Der Kirschgarten“ weitergeht, schreibt A.P. Tschechow an Freunde: „Das ganze Stück ist fröhlich, frivol.“ Das Thema des Stücks „Der Nachlass kommt unter den Hammer“ war für den Autor keineswegs neu.
Zuvor war sie in dem Drama „Vaterlosigkeit“ (1878–1881) von ihm berührt. Während seiner gesamten Karriere war Tschechow interessiert und aufgeregt
Die psychologische Tragödie der Situation des Nachlassverkaufs und des Verlusts des Hauses. Daher spiegelte das Stück „Der Kirschgarten“ viele Lebenserfahrungen des Schriftstellers wider, die mit den Erinnerungen an den Verkauf des Hauses seines Vaters in Taganrog und der Bekanntschaft mit den Kiselevs verbunden waren, denen das Babkino-Anwesen in der Nähe von Moskau gehörte, wo die Familie Tschechow zu Besuch war im Sommer 1885-1887.
In vielerlei Hinsicht wurde das Bild von Gaev von A. S. Kiselev abgeschrieben, der nach dem Zwangsverkauf des Anwesens wegen Schulden Vorstandsmitglied der Bank in Kaluga wurde. In den Jahren 1888 und 1889 ruhte Tschechow auf dem Gut Lintvarev in der Nähe von Sumy in der Provinz Charkow. Dort sah er mit eigenen Augen die vernachlässigten und sterbenden Adligen.
Stände.
Tschechow konnte das gleiche Bild in den Jahren 1892-1898 im Detail beobachten, als er auf seinem Anwesen Melikhovo lebte, und auch im Sommer 1902, als er in Lyubimovka, dem Anwesen von K. S. Stanislavsky, lebte. Die wachsende Stärke des „Dritten Standes“, der sich durch einen harten Geschäftssinn auszeichnete, verdrängte nach und nach seine ruinierten Herren aus den „edlen Nestern“, die gedankenlos ihr Vermögen auslebten. Aus all dem schöpfte Tschechow die Idee zu dem Stück, das später viele Details aus dem Leben der Bewohner der sterbenden Adelsgüter widerspiegelte.
Die Arbeit an dem Stück „The Cherry Orchard“ erforderte vom Autor außerordentliche Anstrengungen. So schreibt er an Freunde: „Ich schreibe vier Zeilen am Tag und diese mit unerträglichen Qualen.“ Tschechow, der ständig mit Krankheiten und Alltagsproblemen zu kämpfen hat, schreibt ein „schwungvolles Theaterstück“.
Am 5. Oktober 1903 schrieb der berühmte russische Schriftsteller N. K. Garin-Michailowski in einem Brief an einen seiner Korrespondenten: „Ich traf Tschechow und verliebte mich in ihn. Er ist schlecht. Und es brennt wie der schönste Tag des Herbstes. Zarte, subtile, kaum wahrnehmbare Töne.
Ein wunderschöner Tag, Liebkosung, Frieden und das Meer, Berge dösen darin, und dieser Moment scheint ewig mit einem wunderbaren Muster gegeben zu sein. Und morgen ... Er kennt sein Morgen und ist froh und zufrieden, dass er sein Drama „Der Kirschgarten“ beendet hat.
(Noch keine Bewertungen)
zusammenhängende Posts:
- Zum ersten Mal erwähnt A.P. Tschechow in einem seiner Briefe im Frühjahr 1901 die Idee, dieses Stück zu schreiben. Sie war von ihm als Komödie konzipiert, „wie ein lustiges Theaterstück, wohin der Teufel wie ein Joch gehen würde.“ Im Jahr 1903, auf dem Höhepunkt der Arbeit an „Der Kirschgarten“, schrieb A.P. Tschechow an Freunde: „Das ganze Stück ist fröhlich, frivol.“ Das Thema lautet: „Der Nachlass kommt unter den Hammer“ [...] ...
- Die Handlung von „The Cherry Orchard“ basiert auf Problemen, die dem Autor wohlbekannt sind: der Verkauf eines Hauses wegen Schulden, der Versuch eines Freundes seines Vaters, das Haus von Tschechow zu kaufen, und schließlich Anyas „Befreiung“, die dem Staat ähnelt des Schriftstellers nach der „Taganrog-Gefangenschaft“. Die Idee für das Stück entstand bereits Anfang 1901, doch die Arbeiten an „Der Kirschgarten“ begannen erst 1903 und waren in wenigen Monaten abgeschlossen […]...
- Die Idee des Theaterstücks „Der Kirschgarten“ von A.P. Tschechow wird dem Frühjahr 1901 zugeschrieben. So erwähnte der Dramatiker im März in einem Brief an seine Frau OL Knipper-Tschechowa, dass er an einem sehr lustigen Stück arbeite. Und im Herbst desselben Jahres teilte Tschechow den Schauspielern des Moskauer Kunsttheaters separate Notizen mit: „Ein Zweig blühender Kirschen, der aus dem Garten durch die offene Tür direkt in den Raum kletterte […]...
- Plan zur Definition des Genres des Stücks von A.P. Tschechow Streitigkeiten über die Genrezugehörigkeit von „Der Kirschgarten“ Definition des Genres des Stücks von A.P. Tschechow Bereits bei der ersten Erwähnung des Beginns der Arbeit an einem neuen Stück im Jahr 1901 teilte A.P. Tschechow seiner Frau mit Dass er geplant hatte, ist ein neues Stück, und zwar eines, in dem alles auf den Kopf gestellt wird. Das ist es, was vorherbestimmt ist […]
- Das Stück „Der Kirschgarten“ ist Tschechows letztes dramatisches Werk, eine traurige Elegie über die vergehende Zeit der „edlen Nester“. In einem Brief an N. A. Leikin gab Tschechow zu: „Ich liebe schrecklich alles, was in Russland als Anwesen bezeichnet wird. Dieses Wort hat seine poetische Konnotation noch nicht verloren.“ Der Dramatikerin lag alles am Herzen, was mit dem Gutsleben zusammenhängt, sie symbolisierte die Herzlichkeit der Familie [...] ...
- Der Plan Die Ursprünge des Werkes Originalität und Aktualität Ein im Schmerz geborenes Stück Künstlerische Methoden und Stil Die Ursprünge des Werkes Sehr oft stellt sich die Frage, was in der Entstehungsgeschichte von Tschechows „Der Kirschgarten“ stehen soll? Um dies zu verstehen, muss man sich daran erinnern, an welcher Epochenwende Anton Pawlowitsch wirkte. Er wurde im 19. Jahrhundert geboren, die Gesellschaft veränderte sich, die Menschen veränderten sich [...] ...
- Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandte sich Gorki der Dramaturgie zu. Fast zeitgleich schreibt er seine ersten Theaterstücke. „At the Bottom“ wurde früher als „Petty Bourgeois“ konzipiert, die Idee von „Summer Residents“ wurde bereits vor der ersten Premiere von „At the Bottom“ skizziert. Die Arbeit an dem Stück begann im Jahr 1900. Im Januar des folgenden Jahres schrieb Gorki an Stanislawski: „Ich habe ein weiteres Stück begonnen. Bosjatskaja. Es sind zwanzig Personen beteiligt. Sehr […]...
- Tschechows Stück „Der Kirschgarten“ wurde zum berühmtesten Werk des Weltdramas des 20. Jahrhunderts, Theaterfiguren auf der ganzen Welt wandten sich seinem Verständnis zu, aber die meisten Bühneninterpretationen von Tschechows Komödie entstanden in der Heimat des Schriftstellers – in Russland. Wie Sie wissen, fand die Uraufführung von „Der Kirschgarten“ 1904 auf der Bühne des Moskauer Kunsttheaters statt, die Regisseure waren K. Stanislavsky und V. Nemirovich-Danchenko. […]...
- Die Helden des Stücks „Der Kirschgarten“ tragen keine symbolische Last. Tschechow überträgt den metaphorischen Schwerpunkt auf das unbelebte Objekt – den Garten, der eine symbolische Bedeutung erhält. Der Garten ist in diesem Stück keine Dekoration, sondern ein Bühnenbild. Es symbolisiert das Maß der Arbeit, das Maß des menschlichen Lebens. Tschechows Garten verkörpert ein langes friedliches Leben, die Kontinuität der Generationen, lange unermüdliche Arbeit, ohne auf [...] ... zu zählen.
- Tschechow bestand darauf, dass „Der Kirschgarten“ eine Komödie sei. Die ersten Regisseure des Moskauer Kunsttheaters interpretierten es als Tragödie. Die Debatte über das Genre des Stücks dauert bis heute an. Das Spektrum der Interpretationen des Regisseurs ist breit: Komödie, Drama, lyrische Komödie, Tragikomödie, Tragödie. Es ist unmöglich, diese Frage eindeutig zu beantworten. Das Tragische in „The Cherry Orchard“ wird immer wieder zur Farce, und durch die Komik entsteht Dramatik. […]...
- Das Stück „Der Kirschgarten“ wurde 1903, zur Zeitenwende, von A.P. Tschechow geschrieben. Der Autor ist derzeit von dem Gefühl erfüllt, dass Russland an der Schwelle großer Veränderungen steht. Wie jeder Mensch träumte Tschechow von der Zukunft, von einem neuen Leben, das den Menschen etwas Helles, Reines und Schönes bringen würde. Es ist dieses Motiv, ein besseres Leben zu erwarten, das im Stück erklingt [...] ...
- Innovation in der Literatur ist die Zerstörung von Kanons, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als Norm wahrgenommen werden. Die Abweichung vom Kanon wird durch die Besonderheiten des Lebensmaterials bestimmt, auf deren Grundlage der innovative Schriftsteller seine Werke schafft. Und das lebenswichtige Material trägt den Stempel seiner Zeit. Es gibt „Zeitvorstellungen“, also „Zeitformen“, in denen sich diese Vorstellungen offenbaren. Der innovative Autor weicht von den etablierten Regeln ab [...] ...
- 1. Der Kirschgarten als Schauplatz und Grundlage der Handlung des Stücks. 2. Die Bedeutung des Kirschgartens in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der Figuren im Stück. 3. Vergleich des Kirschgartens mit Russland. Der Name von A.P. Tschechows Stück „Der Kirschgarten“ erscheint ganz natürlich. Die Handlung spielt in einem alten Adelsgut. Das Haus ist von einem großen Kirschgarten umgeben. Darüber hinaus ist die Entwicklung der Handlung des Stücks mit [...] ... verbunden.
- Im dreiteiligen Figurensystem von Tschechows Stück „Der Kirschgarten“ ist Warja eine der Figuren, die die Gegenwart symbolisieren. Im Gegensatz zu Ranevskaya, ihrer Adoptivmutter, die nicht mit ihrer Vergangenheit brechen kann, und ihrer Halbschwester Anya, die in der fernen Zukunft lebt, ist Warja ein völlig zeitgemäßer Mensch. Dadurch kann sie die Situation vernünftig einschätzen. Streng und rational, […]
- 1. Leben und Garten (nach dem Stück von A.P. Tschechow „Der Kirschgarten“). 2. Das Thema Glück im Stück von A.P. Tschechow „Der Kirschgarten“. 3. „Am Rande einer Klippe in die Zukunft“ (nach dem Stück von A.P. Tschechow „Der Kirschgarten“). 4. Wenn es vor den Fenstern ein anderes Leben gibt ... (nach dem Stück von A.P. Tschechow „Der Kirschgarten“). 5. Die Zukunft aus der Sicht von Tschechows Helden […]...
- Plan Das Problem des Themas des Stücks „Der Kirschgarten“ Das Hauptthema des Stücks Das System der Bilder als Mittel zur Offenlegung des Themas des Werkes Das Problem des Themas des Stücks „Der Kirschgarten“ Im letzten gespielt von A.P., dann der luxuriöse Kirschgarten ruinierter Adliger. Allerdings liegt der Verkauf des Gartens auf […]...
- Betrachten Sie Tschechows Geschichten. Lyrische Stimmung, durchdringende Traurigkeit und Gelächter... Das sind seine Stücke – ungewöhnliche Stücke, die Tschechows Zeitgenossen noch seltsamer vorkamen. Aber in ihnen manifestierte sich das „Aquarell“ von Tschechows Farben, seine durchdringende Lyrik, seine durchdringende Genauigkeit und Offenheit am deutlichsten und tiefsten. Tschechows Dramaturgie hat mehrere Pläne, und was die Figuren sagen, ist keineswegs [...] ...
- Tschechow konzipierte dieses Werk als Komödie, als lustiges Theaterstück, „wohin der Teufel wie ein Joch geht“. Aber K. S. Stanislavsky und V. I. Nemirovich-Danchenko, die das Werk sehr schätzten, empfanden es als Drama. Das Außengrundstück von The Cherry Orchard ist der Besitzerwechsel von Haus und Garten, der Verkauf eines gewöhnlichen Anwesens wegen Schulden. Der sachliche und praktische Kaufmann Lopakhin stellt sich hier dem Schönen entgegen, aber absolut nicht [...] ...
- Am 5. Oktober 1903 schrieb N. K. Garin-Mikhailovsky an einen seiner Korrespondenten: „Ich habe Tschechow kennengelernt und mich in ihn verliebt. Er ist schlecht. Und es brennt wie der schönste Tag des Herbstes. Zarte, subtile, kaum wahrnehmbare Töne. Ein wunderschöner Tag, Liebkosung, Frieden und das Meer, Berge dösen darin, und dieser Moment scheint ewig mit einem wunderbaren Muster gegeben zu sein. Und morgen… Er kennt sein Morgen […]…
- Das Stück „Der Kirschgarten“ ist das letzte Werk Tschechows. In den achtziger Jahren schilderte Tschechow die tragische Situation von Menschen, die den Sinn ihres Lebens verloren haben. Das Stück wurde 1904 im Art Theatre aufgeführt. Das 20. Jahrhundert steht vor der Tür und Russland wird endlich ein kapitalistisches Land, ein Land der Fabriken, Fabriken und Eisenbahnen. Dieser Prozess beschleunigte sich mit der Befreiung der Bauernschaft durch Alexander P. Zu den Merkmalen des Neuen gehören […]...
- Das Stück „Der Kirschgarten“ ist das letzte Werk von A.P. Tschechow. Es wurde 1904 im Art Theatre aufgeführt. Das 20. Jahrhundert steht vor der Tür und Russland wird zu einem kapitalistischen Land, einem Land der Fabriken, Fabriken und Eisenbahnen. Dieser Prozess beschleunigte sich nach der Emanzipation der Bauernschaft. Die Merkmale des Neuen beziehen sich nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Gesellschaft, sie verändern sich […]...
- Dann wird ein Mensch besser, wenn Wir ihm zeigen, was er ist. AP Tschechow Wie verständlich waren die Konflikte in klassischen Stücken vor Tschechow: Hamlet und Claudius, Chatsky und Famusov, Katerina und Kabanova. Tschechow ist nicht so. Sie wissen nicht, mit wem Sie Mitleid haben sollen. Sie scheinen alle gute Menschen zu sein: Ranevskaya, Lopakhin, Trofimov. Aber warum nicht […]
- „The Cherry Orchard“ ist ein weitläufiger und mehrdeutiger Name, genau wie dieses Bild selbst. Es ist falsch, es nur als Schauplatz des Stücks zu verstehen. Der Verkauf des Kirschgartens steht im Mittelpunkt der Handlung, und man kann sagen, dass alle Helden der Komödie in Bezug darauf charakterisiert werden. Aber noch wichtiger ist die Bedeutung, die dem Bild des Kirschgartens beigemessen wird. Es ist bekannt, dass Tschechow zunächst […]
- Vorbereitung auf das Einheitliche Staatsexamen: Ein Essay zum Thema: Die Hauptfiguren des Theaterstücks „Der Kirschgarten“ von A.P. Tschechow: Bilder, Charakterisierung von Helden, Hilflosigkeit im Leben A.P. Tschechow schilderte den Wendepunkt des 20. Jahrhunderts in Russland Imperium im Leben der Gutsbesitzer, Leibeigenen und der Intelligenz. Die Hauptfiguren des Stücks „Der Kirschgarten“ von A.P. Tschechow fungieren als Vertreter verschiedener Schichten des Gesellschaftssystems: feudal (L.A. Ranevskaya, Gaev, Anna) und bürgerlich [...] ...
- „Der Kirschgarten“ war das letzte und, man könnte sagen, letzte Stück von Anton Tschechow. Er schrieb es kurz vor seinem Tod, im Jahr 1904, zur Zeit der Zeitenwende, als die Vorwegnahme gesellschaftlicher Veränderungen besonders spürbar war. Am Vorabend der sozialen Explosion konnte er als kreativer Mensch nicht umhin, die allgemeine Stimmung zu spüren, die Ungewissheit des Augenblicks weckte fast unwillkürlich das Bedürfnis, die Realität seiner Zeit von Anfang an zu begreifen.
- Streitigkeiten über das Genre „Der Kirschgarten“ sind bis heute nicht abgeklungen, sie wurden jedoch von den Leitern des Moskauer Kunsttheaters und dem Autor selbst initiiert. Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko sahen in dem Stück „das schwere Drama des russischen Lebens“, und Tschechow behauptete: „Ich habe kein Drama herausgebracht, sondern eine Komödie, an manchen Stellen sogar eine Farce.“ Er bestand darauf, dass es in der Aufführung keinen „weinenden Ton“ geben dürfe. Wirklich, […]...
- 1. Welche für die russische Literatur traditionellen Themen und Bilder spiegeln sich in A.P. Tschechows Stück „Der Kirschgarten“ wider? Das traditionelle Thema ist der Untergang der Adelsnester, der Untergang des Adels und die bevorstehende Ersetzung durch das Bürgertum. Der Kirschgarten ist ein typisches Adelsnest. 2. Welche Rolle spielt Gaev im Bildersystem von A.P. Tschechows Stück „Der Kirschgarten“? Gaev ist ein Fragment des entarteten Adels, [...] ...
- Alle Stücke von A.P. Tschechow sind interessante, facettenreiche Gemälde, die bis in die entlegensten Winkel der Seele des Lesers vordringen. Sie sind lyrisch, offen, tragisch ... Sie haben sowohl fröhliches Lachen als auch traurige Töne. Das macht die Werke des Autors besonders und ungewöhnlich. Sehr oft ist es schwierig zu bestimmen, zu welchem Genre Tschechows Werke gehören. „Der Kirschgarten“ Der Autor bezieht sich auf [...] ...
- „Der Kirschgarten“ war Tschechows letztes und sozusagen letztes Stück. Er schrieb es kurz vor seinem Tod, am Wendepunkt der Epochen, als die Vorwegnahme gesellschaftlicher Veränderungen besonders spürbar war. Am Vorabend der sozialen Explosion konnte er als kreativer Mensch nicht umhin, die allgemeine Stimmung zu spüren, die Ungewissheit des Augenblicks weckte fast unwillkürlich das Bedürfnis, die gegenwärtige Realität vom Standpunkt der Vergangenheit aus zu begreifen […]...
- Das Stück „Der Kirschgarten“ wurde von Tschechow kurz vor seinem Tod geschrieben. Es ist unmöglich, sich jemanden vorzustellen, der dieses Stück nicht kennt. In diesem berührenden Werk verabschiedet sich Tschechow sozusagen von der Welt, die barmherziger und menschlicher sein könnte. Beim Studium von Tschechows Werk „Der Kirschgarten“ möchte ich ein Merkmal seiner Helden hervorheben: Sie sind alle gewöhnliche Menschen und keiner [...] ...
- In dem Stück verallgemeinert Tschechow das Thema des Todes edler Nester, enthüllt den Untergang des Adels und das Kommen neuer gesellschaftlicher Kräfte, die ihn ersetzen sollen. Das Russland der Vergangenheit, das Russland der Kirschgärten mit ihrer elegischen Schönheit, wird durch die Bilder von Ranevskaya und Gaev repräsentiert. Dies sind Fragmente des örtlichen Adels. Sie sind unentschlossen, nicht an das Leben angepasst, passiv. Das Einzige, was sie tun können, ist pompöse Reden zu halten wie Gaev [...] ...
- Das Schicksal eines jeden Menschen wird durch seine Moral bestimmt. Der antike Aphorismus „Der Kirschgarten“ ist das letzte Stück von A.P. Tschechow. Als er ihre Abdrücke in seinen Händen hielt, hatte er nicht mehr lange zu leben, nur ein paar Monate. Wie jedes Stück wird es von verschiedenen Schauspielern bewohnt: darunter sind die Haupt-, Neben- und Episodenakteure. Aber alle vom reifen Tschechow geschaffenen Charaktere öffnen sich fast immer [...] ...
- A.P. Tschechow hat keine „überflüssigen“, zufälligen Phrasen, Wörter. Jedes Detail ist immer fest und logisch mit dem Hauptinhalt verbunden. Daher ist die Szenerie des zweiten Akts des Stücks „Der Kirschgarten“ symbolisch: „eine alte, klapprige, längst verlassene Kapelle…“, „Steine, die einst Grabsteine waren…“, „eine vage markierte Stadt, die nur sein kann.“ bei sehr gutem Wetter gesehen…“. Das Verständnis der Helden für Vergangenheit und Zukunft manifestiert sich [...] ...
- In Tschechows alten Stücken war das Haus der stille Teilnehmer des Geschehens, der Wohnsitz, der viel über die Besitzer verraten konnte. Je weiter sich die Handlung entfaltete, desto klarer wurden die Beteiligten und desto weniger achtete der Betrachter auf die zusätzliche Beredsamkeit der Innenräume. Man ging davon aus, dass die jetzigen Besitzer rechtzeitig abziehen würden und andere Stimmen unter einem Dach erklingen würden. Ganz anders im letzten Stück: Unter dem Dach der Gaevs [...] ...
- Am 15. September 1903 schrieb Tschechow an Stanislawskis Frau, M.P. Alekseeva (Lilina): „Ich habe kein Drama bekommen, sondern eine Komödie, an manchen Stellen sogar eine Farce ...“ Nachdem er das Stück gelesen hatte, antwortete Stanislawski Tschechow: „ Das ist keine Komödie, keine Farce, wie Sie geschrieben haben. Das ist eine Tragödie …“ Seitdem hat die Kontroverse um das Genre „The Cherry Orchard“ nicht aufgehört. Die Studierenden wurden gebeten, die traditionelle Frage zu beantworten: „Warum [...]
- „Der Kirschgarten“ ... Es ist unmöglich, jemanden zu finden, der dieses Stück von Anton Pawlowitsch Tschechow nicht kennt. Der Klang dieser Worte hat etwas überraschend Berührendes: „Kirschgarten“. Dies ist der Abgesang des Schriftstellers, der letzte „verzeiht“ der Welt, die menschlicher, barmherziger, schöner sein könnte. Komödie in vier Akten. Ich erinnere mich an Gespräche in der Lektion, in denen Tschechow eindringlich empfahl, dass […]
- Tschechow kennt keine „überflüssigen“, zufälligen Phrasen, Wörter. Jedes Detail ist immer fest und logisch mit dem Hauptinhalt verbunden. Daher ist die Szenerie des zweiten Aktes symbolisch: „Eine alte, klapprige, längst verlassene Kapelle…“, „Steine, die einst Grabsteine waren…“, „eine undeutlich markierte Stadt, die man nur bei sehr gutem Wetter sehen kann…“. Das Verständnis der Helden für Vergangenheit und Zukunft wird sich nicht nur in gezielten Monologen manifestieren, […] ...
- Plan Der soziale Status der Helden des Stücks – als eines der Merkmale Kurzcharakteristik der Hauptfiguren Kurzcharakteristik der Nebenfiguren Der soziale Status der Helden des Stücks – als eines der Merkmale Im letzten Stück von A.P. Tschechow Bei „The Cherry Orchard“ gibt es keine Unterteilung in Haupt- und Nebencharaktere. Es sind alles große, auch scheinbar episodische Rollen, die für [...] ... von großer Bedeutung sind.
Die Idee, das Stück „Der Kirschgarten“ zu schreiben, erwähnte A.P. Tschechow erstmals in einem seiner Briefe vom Frühjahr 1901. Zunächst war es von ihm als „lustiges Stück“ konzipiert, „wohin der Teufel wie ein Joch gehen würde“. Als 1903 die Arbeit an „Der Kirschgarten“ fortgesetzt wurde, schrieb A.P. Tschechow an seine Freunde: „Das ganze Stück ist fröhlich, frivol.“ Das Thema des Stücks „Der Nachlass kommt unter den Hammer“ war für den Autor keineswegs neu. Zuvor war sie in dem Drama „Vaterlosigkeit“ (1878–1881) von ihm berührt. Während seiner gesamten Karriere war Tschechow interessiert und besorgt über die psychologische Tragödie der Situation des Verkaufs des Anwesens und des Verlusts des Hauses. Daher spiegelte das Stück „Der Kirschgarten“ viele Lebenserfahrungen des Schriftstellers wider, die mit dem Verkauf des Hauses seines Vaters in Taganrog und der Bekanntschaft mit den Kiselevs verbunden waren, denen das Babkino-Anwesen in der Nähe von Moskau gehörte, das die Familie Tschechow im Sommer besuchte 1885-1887. In vielerlei Hinsicht wurde das Bild von Gaev von A. S. Kiselev abgeschrieben, der nach dem Zwangsverkauf des Anwesens wegen Schulden Vorstandsmitglied der Bank in Kaluga wurde. In den Jahren 1888 und 1889 ruhte Tschechow auf dem Gut Lintvarev in der Nähe von Sumy in der Provinz Charkow. Dort sah er mit eigenen Augen die vernachlässigten und sterbenden Adelsgüter. Tschechow konnte das gleiche Bild in den Jahren 1892-1898 im Detail beobachten, als er auf seinem Anwesen Melikhovo lebte, und auch im Sommer 1902, als er in Lyubimovka, dem Anwesen von K. S. Stanislavsky, lebte. Die wachsende Stärke des „Dritten Standes“, der sich durch einen harten Geschäftssinn auszeichnete, verdrängte nach und nach seine ruinierten Herren aus den „edlen Nestern“, die gedankenlos ihr Vermögen auslebten. Aus all dem schöpfte Tschechow die Idee zu dem Stück, das später viele Details aus dem Leben der Bewohner der sterbenden Adelsgüter widerspiegelte.
Die Arbeit an dem Stück „The Cherry Orchard“ erforderte vom Autor außerordentliche Anstrengungen. So schreibt er an Freunde: „Ich schreibe vier Zeilen am Tag und diese mit unerträglichen Qualen.“ Tschechow, der ständig mit Krankheiten und Alltagsproblemen zu kämpfen hat, schreibt ein „schwungvolles Theaterstück“.
Am 5. Oktober 1903 schrieb der berühmte russische Schriftsteller N. K. Garin-Mikhailovsky in einem Brief an einen seiner Korrespondenten: „Ich traf Tschechow und verliebte mich in ihn. Er ist schlecht. , Liebkosung, Frieden und das Meer, Berge dösen ein.“ es, und dieser Moment scheint ewig mit einem wunderbaren Muster.
Tschechow schickt auch mehrere Briefe an Regisseure und Schauspieler, in denen er einige Szenen aus „Der Kirschgarten“ ausführlich kommentiert, die Charakteristika seiner Figuren darlegt und dabei besonderen Wert auf die komödiantischen Aspekte des Stücks legt. Aber K.S. Stanislavsky und Vl. I. Nemirowitsch-Dantschenko, der Gründer des Kunsttheaters, empfand es als Drama. Laut Stanislavsky wurde die Lesung des Stücks durch die Truppe mit „einhelliger Begeisterung“ aufgenommen. Er schreibt an Tschechow: „Ich weinte wie eine Frau, ich wollte, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich höre Sie sagen: „Entschuldigung, aber das ist eine Farce.“ Nein, für einen einfachen Menschen ist das eine Tragödie. .. Ich empfinde für dieses Stück Zärtlichkeit und Liebe als etwas Besonderes.“
Die Inszenierung des Stücks erforderte eine besondere Theatersprache, neue Intonationen. Dies wurde sowohl von seinem Schöpfer als auch von den Schauspielern gut verstanden. M. P. Lilina (die erste Darstellerin der Rolle der Anya) schrieb am 11. November 1903 an A. P. Tschechow: „... Es schien mir, dass „Der Kirschgarten“ kein Theaterstück, sondern ein Musikstück, eine Symphonie ist. Und das.“ Das Spiel muss besonders wahrheitsgetreu, aber ohne wirkliche Härte gespielt werden.
Die Interpretation von „Der Kirschgarten“ durch den Regisseur befriedigte Tschechow jedoch nicht. „Dies ist eine Tragödie, ganz gleich, welche Folgen für ein besseres Leben man im letzten Akt entdeckt“, schreibt Stanislawski an den Autor und bekräftigt damit seine Vision und die Logik der Bewegung des Stücks in ein dramatisches Finale, das das Ende des ersteren bedeutete Leben, der Verlust des Hauses und der Tod des Gartens. Tschechow war äußerst empört darüber, dass der Aufführung der komödiantische Unterton fehlte. Er glaubte, dass Stanislavsky, der die Rolle des Gaev spielte, die Handlung im vierten Akt zu sehr in die Länge zog. Tschechow gesteht seiner Frau: „Wie schrecklich es ist! Der Akt, der maximal 12 Minuten dauern sollte, haben Sie 40 Minuten. Stanislawski hat mein Stück ruiniert.“
Im Dezember 1903 beklagte sich Stanislawski: „Der Kirschgarten“ „blüht noch nicht. Blumen waren gerade erschienen, da kam der Autor und verwirrte uns alle. Die Blumen sind abgefallen, und jetzt erscheinen nur noch neue Knospen.“
A.P. Tschechow schrieb „Der Kirschgarten“ als Theaterstück über die Heimat, über das Leben, über das Vaterland, über die Liebe, über Verluste, über die schnell vergehende Zeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schien dies jedoch nicht unumstritten zu sein. Jedes neue Stück Tschechows löste unterschiedliche Einschätzungen aus. Die Komödie „Der Kirschgarten“ war keine Ausnahme, wo die Art des Konflikts, die Charaktere und die Poetik von Tschechows Dramaturgie neu und unerwartet waren.
A. M. Gorki beschrieb beispielsweise Tschechows „Der Kirschgarten“ als eine Wiederholung alter Motive: „Ich habe mir Tschechows Stück angehört – beim Lesen erweckt es nicht den Eindruck einer großen Sache. Neu – kein Wort. Alles – Stimmungen, Ideen.“ - wenn man darüber sprechen kann - Gesichter - das alles war schon in seinen Stücken. Natürlich - schön und - natürlich - von der Bühne weht es mit grüner Melancholie auf das Publikum. Aber ich weiß nicht, was die Melancholie ist um.
Trotz ständiger Meinungsverschiedenheiten fand die Uraufführung von „The Cherry Orchard“ dennoch am 17. Januar 1904 statt – am Geburtstag von A.P. Tschechow. Das Kunsttheater hat es auf den 25. Jahrestag der literarischen Tätigkeit von A.P. Tschechow abgestimmt. Im Saal versammelte sich die gesamte künstlerische und literarische Elite Moskaus, unter den Zuschauern waren A. Bely, V. Ya. Bryusov, A. M. Gorki, S. V. Rachmaninow und F. I. Schaljapin. Der Auftritt des Autors nach dem dritten Akt auf der Bühne wurde mit langem Applaus bedacht. Das letzte Stück von A.P. Tschechow, das zu seinem kreativen Testament wurde, begann sein eigenständiges Leben.
Das anspruchsvolle russische Publikum begrüßte das Stück mit großer Begeisterung, dessen strahlender Geist den Zuschauer einfach in seinen Bann ziehen konnte. Aufführungen von „The Cherry Orchard“ wurden in vielen Theatern Russlands erfolgreich aufgeführt. Dennoch erlebte Tschechow nie eine Aufführung, die seinen kreativen Vorstellungen vollständig entsprach. „Das Kapitel über Tschechow ist noch nicht zu Ende“, schrieb Stanislawski und erkannte an, dass A.P. Tschechow die Entwicklung des Theaters weit überholt hatte.
Entgegen kritischer Prognosen ist „Der Kirschgarten“ zu einem unvergänglichen Klassiker des Nationaltheaters geworden. Die künstlerischen Entdeckungen des Autors in der Dramaturgie, seine ursprüngliche Vision der widersprüchlichen Aspekte des Lebens kommen in diesem nachdenklichen Werk ungewöhnlich deutlich zum Ausdruck.
Tschechows Kirschgarten.
Anton Pawlowitsch Tschechow! Wie viel ist mit diesem Namen in der Seele eines russischen Menschen verbunden? Er war mit erstaunlichem Talent und harter Arbeit ausgestattet. Diese Eigenschaften stellen ihn nämlich auf eine Stufe mit den besten Vertretern der russischen Literatur.
Die hohe Kunst der Einfachheit und Kürze reizte ihn stets und gleichzeitig strebte er in seinen Werken danach, die emotionale und semantische Ausdruckskraft der Erzählung zu steigern.
Das Werk von A.P. Tschechow ist von einem ständigen Kampf mit der unerträglichen Sehnsucht des Seins durchdrungen. Einer der wenigen, deren Blick nicht nur auf die Zukunft gerichtet war – er lebte diese Zukunft. Mit seiner Feder zwingt er uns Leser, über Probleme nachzudenken, die nicht vorübergehender Natur sind, sondern viel wichtiger und bedeutsamer.
IN 1904
1998 feierte die Uraufführung von A.P. Tschechows Stück „Der Kirschgarten“ einen triumphalen Erfolg auf der Bühne des Moskauer Kunsttheaters. Nach vorangegangenen gemischten kritischen Kritiken zu Tschechows Inszenierungen wurde „Der Kirschgarten“ sofort und bedingungslos angenommen. Darüber hinaus gab das Stück den Anstoß zur Geburt eines „neuen Theaters“, das sich dem Symbolismus und dem Grotesken widmete.
Der Kirschgarten wurde zum Epilog, zum Requiem für eine ganze Ära. Eine lebendige Parodie und eine verzweifelte Komödie mit einem Finale, das uns Hoffnung für die Zukunft gibt, das ist vielleicht das wichtigste, innovative Phänomen dieses Stücks.
Indem Tschechow die Akzente ziemlich genau setzt, vermittelt er uns deutlich ein Verständnis für das Ideal, ohne das seiner Meinung nach ein sinnvolles menschliches Leben unmöglich ist. Er ist sicher, dass Pragmatismus ohne Spiritualität zum Scheitern verurteilt ist. Deshalb steht Tschechow nicht Lopachin, einem Vertreter des in Russland entstehenden Kapitalismus, näher, sondern dem „ewigen Studenten“ Petja Trofimow, der auf den ersten Blick erbärmlich und lustig ist, aber für ihn sieht der Autor die Zukunft. weil Petya nett ist.
Anya, eine weitere Figur, mit der Tschechow sympathisiert. Es scheint ungeschickt und lächerlich zu sein, aber in ihr steckt ein gewisser Charme und eine gewisse Reinheit, für die Anton Pawlowitsch bereit ist, ihr alles zu verzeihen. Er versteht vollkommen, dass Lopakhins, Ranevskaya usw. nicht aus unserem Leben verschwinden werden, Tschechow sieht immer noch die Zukunft für gute Romantiker. Auch wenn sie etwas hilflos sind.
Die Empörung von Anton Pawlowitsch führt zu Lopakhins Selbstgefälligkeit. Bei aller Originalität von Tschechows Humanismus kann man das weder spüren noch hören. „Firs“, vergessen in einem vernagelten Haus, klingt wie eine Metapher, deren Bedeutung auch heute noch aktuell ist. Lass Firs dumm sein, alt, aber er ist ein Mann, und er wurde vergessen. Der Mann ist vergessen!
Die Essenz des Stücks liegt in seiner Alltäglichkeit. Aber ein leeres, mit Brettern vernageltes Haus, darin vergessene Tannen und das Geräusch einer Axt, die einen Kirschgarten abholzt, machen einen deprimierenden Eindruck, berühren und offenbaren den subtilen und schmerzhaften Zustand unserer Seele. Einmal sagte Shukshin durch den Mund seines Helden: „Es ist nicht der Tod, der schrecklich ist, sondern der Abschied.“
Genau darum geht es im Stück „Der Kirschgarten“ von A.P. Tschechow, um den Abschied. Im philosophischen Sinne Abschied vom Leben nehmen. Im Großen und Ganzen nicht ganz erfolgreich, etwas unglücklich, vorbei an nutzlosen Bestrebungen, die es aber nie geben wird. Leider kommt dieses Verständnis normalerweise am Ende unserer Existenz auf der sterblichen Erde.
„Der Kirschgarten“ ist eine zutiefst tragische Sache, dennoch wird es von Tschechow als Komödie bezeichnet. Paradox? Gar nicht. Dies, sein letztes Sterbewerk, ist eine Art Abschied vom Leser, der Ära, dem Leben ... Anscheinend sind daher Angst, Traurigkeit und zugleich Freude durch das ganze Stück „gegossen“.
Tschechow nannte „Der Kirschgarten“ eine Komödie, nicht um das Genre zu definieren, sondern als Hinweis auf Handlung. Indem ein Stück als Tragödie gespielt wird, kann keine Tragödie erreicht werden. Sie wird nicht traurig, unheimlich oder traurig sein, sie wird nichts sein. Erst in einer Komödieninterpretation, die zur Dissonanz gelangt ist, kann man die Schärfe der Probleme der menschlichen Existenz verstehen.
A.P. Tschechows Überlegungen zu universellen menschlichen Werten lassen uns auch heute noch nicht gleichgültig. Der Beweis dafür sind die Theateraufführungen von „The Cherry Orchard“ auf modernen Bühnen.
Die Ursprünge der Arbeit
Sehr oft stellt sich die Frage: Was soll in der Entstehungsgeschichte von Tschechows „Kirschgarten“ geschehen? Um dies zu verstehen, muss man sich daran erinnern, an welcher Epochenwende Anton Pawlowitsch wirkte. Er wurde im 19. Jahrhundert geboren, die Gesellschaft veränderte sich, die Menschen und ihre Weltanschauung veränderten sich, Russland bewegte sich auf ein neues System zu, das sich nach der Abschaffung der Leibeigenschaft rasch entwickelte. Die Entstehungsgeschichte des Theaterstücks „The Cherry Orchard“ von A.P. Tschechow – das letzte Werk seines Schaffens – beginnt vielleicht mit der Abreise des jungen Anton nach Moskau im Jahr 1879.
Anton Tschechow liebte schon in jungen Jahren die Dramaturgie und versuchte als Gymnasiast, in diesem Genre zu schreiben, doch diese ersten Schreibversuche wurden nach dem Tod des Schriftstellers bekannt. Eines der Stücke heißt „Vaterlosigkeit“ und wurde um 1878 geschrieben. Es handelt sich um ein sehr umfangreiches Werk, das erst 1957 auf der Bühne des Theaters aufgeführt wurde. Der Umfang des Stücks entsprach nicht Tschechows Stil, wo „Kürze die Schwester des Talents ist“, aber jene Akzente, die das gesamte russische Theater veränderten, sind bereits sichtbar.
Anton Pawlowitschs Vater hatte einen kleinen Laden im ersten Stock des Tschechow-Hauses, die Familie wohnte im zweiten. Doch seit 1894 ging es im Laden immer schlimmer, und 1897 ging der Vater völlig bankrott, die ganze Familie musste nach dem Verkauf des Eigentums nach Moskau ziehen, wo sich die älteren Kinder bereits niedergelassen hatten diese Zeit. Deshalb lernte Anton Tschechow schon in jungen Jahren, wie es ist, wenn man sich vom Kostbarsten trennen muss – seinem Zuhause, um seine Schulden zu begleichen. Bereits in einem reiferen Alter stieß Tschechow immer wieder auf Fälle des Verkaufs von Adelsgütern auf Auktionen an „neue Leute“ und, modern ausgedrückt, an Geschäftsleute.
Originalität und Aktualität
Die Schaffensgeschichte von „Der Kirschgarten“ beginnt im Jahr 1901, als Tschechow zum ersten Mal in einem Brief an seine Frau verkündete, dass er ein neues Stück konzipiert habe, das sich von den zuvor geschriebenen Stücken unterschied. Von Anfang an konzipierte er es als eine Art komödiantische Farce, in der alles sehr frivol, lustig und unbeschwert sein würde. Die Handlung des Stücks war der Verkauf des Anwesens eines alten Grundbesitzers wegen Schulden. Tschechow hatte bereits früher in „Vaterlosigkeit“ versucht, dieses Thema aufzudecken, aber dafür brauchte er 170 Seiten handgeschriebenen Textes, und ein Stück von einem solchen Umfang konnte nicht in den Rahmen einer Aufführung passen. Ja, und Anton Pawlowitsch erinnerte sich nicht gern an seinen frühen Nachwuchs. Nachdem er die Fähigkeiten des Dramatikers perfektioniert hatte, nahm er sie erneut auf.
Die Situation beim Verkauf des Hauses war für Tschechow nah und vertraut, und nach dem Verkauf des Hauses seines Vaters in Taganrog war er von der psychischen Tragödie solcher Fälle interessiert und begeistert. So wurden seine eigenen schmerzhaften Eindrücke und die Geschichte seines Freundes A.S. Kiselev zur Grundlage des Stücks. Vor den Augen des Schriftstellers passierten auch viele verlassene Adelsgüter in der Provinz Charkow, wo er sich ausruhte. Die Handlung des Stücks spielt sich übrigens in diesen Teilen ab. Anton Pawlowitsch beobachtete den gleichen beklagenswerten Zustand der Güter und die Situation ihrer Besitzer auf seinem Anwesen in Melikhovo und als Gast im Anwesen von K.S. Stanislawski. Er beobachtete das Geschehen und verstand mehr als 10 Jahre lang, was geschah.
Der Verarmungsprozess der Adligen dauerte lange, sie lebten einfach ihr Vermögen aus, verschwendeten es unklug und dachten nicht an die Folgen. Das Bild von Ranevskaya ist kollektiv geworden und zeigt stolze, edle Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich an das moderne Leben anzupassen, aus dem das Recht auf den Besitz einer menschlichen Ressource in Form von Leibeigenen, die für das Wohlergehen ihrer Herren arbeiten, verschwunden ist.
Ein im Schmerz geborenes Stück
Vom Beginn der Arbeit an dem Stück bis zur Inszenierung vergingen etwa drei Jahre. Dies hatte mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist der schlechte Gesundheitszustand des Autors, und selbst in Briefen an Freunde beklagte er sich darüber, dass die Arbeit sehr langsam vorankam, manchmal stellte sich heraus, dass er nicht mehr als vier Zeilen pro Tag schrieb. Obwohl er sich unwohl fühlte, versuchte er jedoch, ein Werk zu schreiben, dessen Genre locker war.
Der zweite Grund kann Tschechows Wunsch genannt werden, in sein für die Bühneninszenierung gedachtes Stück das gesamte Ergebnis von Gedanken über das Schicksal nicht nur ruinierter Gutsbesitzer, sondern auch über für diese Zeit typische Menschen wie Lopakhin, den ewigen Studenten, einzubauen Trofimov, in dem man sich als revolutionär gesinnten Intellektuellen fühlt. Schon die Arbeit am Bild Jaschas erforderte enorme Anstrengungen, denn durch ihn zeigte Tschechow, wie die historische Erinnerung an seine Wurzeln ausgelöscht wird, wie sich die Gesellschaft und die Haltung gegenüber dem Vaterland insgesamt verändern.
Die Arbeit an den Charakteren war sehr akribisch. Für Tschechow war es wichtig, dass die Schauspieler dem Publikum die Idee des Stücks vollständig vermitteln konnten. In Briefen beschrieb er detailliert die Charaktere der Charaktere und gab detaillierte Kommentare zu jeder Szene. Und er betonte, dass sein Stück kein Drama, sondern eine Komödie sei. Allerdings haben V.I. Nemirovich-Danchenko und K.S. Stanislavsky schaffte es nicht, in dem Stück etwas Komisches zu berücksichtigen, was den Autor sehr verärgerte. Die Produktion von „The Cherry Orchard“ war sowohl für die Regisseure als auch für den Dramatiker schwierig. Nach der Uraufführung, die am 17. Januar 1904, an Tschechows Geburtstag, stattfand, kam es zu Streitigkeiten zwischen Kritikern, doch niemand blieb ihr gegenüber gleichgültig.
Künstlerische Methoden und Stil
Einerseits ist die Geschichte des Schreibens von Tschechows Komödie „Der Kirschgarten“ nicht so lang, und andererseits ging Anton Pawlowitsch sein ganzes kreatives Leben lang zu ihr. Seit Jahrzehnten werden Bilder gesammelt, seit mehr als einem Jahr werden auch künstlerische Techniken gefeilt, die den Alltag ohne Pathos auf der Bühne zeigen. „Der Kirschgarten“ wurde zu einem weiteren Eckpfeiler in den Annalen des neuen Theaters, das vor allem dank Tschechows Talent als Dramatiker begann.
Vom Moment der Uraufführung bis heute haben die Regisseure dieser Aufführung keine gemeinsame Meinung über das Genre dieses Stücks. Jemand sieht in dem Geschehen eine tiefe Tragödie und nennt es ein Drama, manche empfinden das Stück als Tragikomödie oder Tragödie. Aber alle sind sich einig, dass „Der Kirschgarten“ nicht nur in der russischen, sondern auch in der globalen Dramaturgie längst zu einem Klassiker geworden ist.
Eine kurze Beschreibung der Entstehungs- und Schreibgeschichte des berühmten Theaterstücks wird Schülern der 10. Klasse dabei helfen, eine Zusammenfassung und Lektionen vorzubereiten, während sie diese wunderbare Komödie studieren.
Artwork-Test