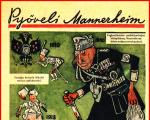Schlüsseldaten im Leben Alexanders II. Biographie von Kaiser Alexander II. Nikolajewitsch Herrschaft Alexanders 2 Veranstaltungsdaten
13. März (1. März im alten Stil) – Gedenktag Zar-Befreier Alexander II. Nikolajewitsch , der am 1. März 1881 Opfer revolutionärer Terroristen wurde.
Er wurde am 17. April 1818, am Hellen Mittwoch, im Bischofshaus des Chudov-Klosters im Kreml geboren. Sein Lehrer war der Dichter V.A. Schukowski, der ihm ein romantisches Lebensgefühl vermittelte.
Zahlreichen Zeugenaussagen zufolge war er in seiner Jugend sehr beeinflussbar und verliebt. So verliebte er sich während einer Reise nach London im Jahr 1839 in die junge Königin Victoria (später, als Monarchen, erlebten sie gegenseitige Feindseligkeit und Feindschaft).
Im Jahr 1837 unternahm Alexander eine lange Reise durch Russland und besuchte 29 Provinzen des europäischen Teils, Transkaukasien und Westsibirien, und in den Jahren 1838-1839 besuchte er Europa.
Alexander hat sich in seinen Ansichten über die Geschichte Russlands und die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung weder in seiner Jugend noch in seinen reifen Jahren an eine bestimmte Theorie oder ein bestimmtes Konzept gehalten. Seine allgemeinen Ansichten waren geprägt von der Idee der Unantastbarkeit der Autokratie und der bestehenden Staatlichkeit Russlands als Hochburg seiner Einheit sowie vom göttlichen Ursprung der zaristischen Macht. Er gesteht seinem Vater, der Russland auf einer Reise kennengelernt hat: „Ich schätze mich glücklich, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, mein ganzes Leben ihr zu widmen.“. Als Autokrat identifizierte er sich mit Russland und betrachtete seine Rolle, seine Mission darin, der souveränen Größe des Vaterlandes zu dienen.
Privatleben
Das Privatleben Alexanders II. verlief erfolglos. 1841 heiratete er auf Drängen seines Vaters Prinzessin Maximilian Wilhelmina Augusta Sophia Maria (†1880) von Hessen-Darmstadt. Sie hatten sieben Kinder: Alexandra, Nikolaus, Alexander (späterer Kaiser Alexander III.), Wladimir, Maria, Sergej. Pavel (die ersten beiden starben: Tochter 1849, Thronfolger 1865).

Zarenfrau Maria Alexandrowna
Die gebürtige Deutsche Maria Alexandrowna war von ihrer Aristokratie besessen. Sie liebte oder respektierte Russland nicht, verstand oder schätzte ihren Mann nicht und verbrachte die meiste Zeit damit, zu sticken oder zu stricken und über Hofromanzen, Intrigen, Hochzeiten und Beerdigungen an den Höfen Europas zu schwadronieren. Alexander war mit einer solchen Frau nicht zufrieden. 1866 verliebte er sich in Prinzessin Ekaterina Dolgorukaya (†1922), die er unmittelbar nach dem Tod seiner ersten Frau im Jahr 1880 in einer morganatischen Ehe heiratete (eine Ehe zwischen Personen mit ungleichem Stand, bei der der Ehegatte mit dem niedrigeren Stand durch diese Ehe nicht den gleichen hohen sozialen Status erhält). Aus dieser Ehe hatte er 4 Kinder.
Beginn der Herrschaft
Alexander II. bestieg den Thron im Alter von 36 Jahren nach dem Tod seines Vaters, Kaiser Nikolaus I., am 19. Februar 1855. Die Krönung fand am 26. August 1856 in der Mariä Himmelfahrt-Kathedrale des Kremls statt. (Die Zeremonie wurde vom Moskauer Metropoliten Filaret (Drozdov) geleitet.). Der vollständige Titel des Kaisers klang wie Kaiser und Autokrat von ganz Russland, Zar von Polen und Großfürst von Finnland. Anlässlich der Krönung erklärte der Kaiser eine Amnestie für die Dekabristen, Petrascheviten und Teilnehmer des polnischen Aufstands von 1830–31.
Die Thronbesteigung Alexanders II. erfolgte unter sehr schwierigen Umständen. Die Finanzen wurden durch den erfolglosen Krimkrieg, in dem sich Russland in völliger internationaler Isolation befand, äußerst durcheinander gebracht (Russland wurde von den vereinten Kräften fast aller europäischen Großmächte bekämpft). Der erste wichtige Schritt war Abschluss des Pariser Friedens (1856) - zu Bedingungen, die in der aktuellen Situation nicht die schlechtesten waren(In England gab es starke Gefühle dafür, den Krieg bis zur vollständigen Niederlage und Zerstückelung des Russischen Reiches fortzusetzen.) Dank einiger diplomatischer SchritteAlexander II. war erfolgreichBrechen Sie die außenpolitische Blockade Russlands. In Paris versammelten sich Vertreter von sieben Mächten (Russland, Frankreich, Österreich, England, Preußen, Sardinien und Türkei). Sewastopol wurde an Russland übergeben, der Zar war jedoch verpflichtet, keine Flotte im Schwarzen Meer aufzubauen. Ich musste diese für Russland schrecklich demütigende Bedingung akzeptieren. Der Pariser Frieden war für Russland zwar nicht vorteilhaft, aber angesichts der zahlreichen und starken Gegner dennoch ehrenhaft.
Reformen Alexanders II
.jpg)
Alexander II. ging als Reformator und Befreier in die Geschichte ein (im Zusammenhang mit der Abschaffung der Leibeigenschaft laut Manifest vom 19. Februar 1861). Er schaffte die körperliche Züchtigung ab und verbot die Prügelstrafe gegen Soldaten. Vor ihm dienten Soldaten 25 Jahre lang, Soldatenkinder wurden von Geburt an als Soldaten eingezogen. Alexander führte die allgemeine Wehrpflicht ein und weitete sie auf alle Nationalitäten aus, während zuvor nur Russen Dienst leisteten.
Die Staatsbank, Kreditämter, Eisenbahnen, Telegraphen, Regierungspost, Fabriken, Fabriken – alles entstand unter Alexander II., ebenso städtische und ländliche öffentliche Schulen.
Während seiner Herrschaft wurde die Leibeigenschaft abgeschafft (1861) . Die Befreiung der Bauern war Anlass für einen neuen polnischen Aufstand im Jahr 1863. Alexander verwandelte Russland und machte die Russifizierung der Außenbezirke Finnlands, Polens und des Baltikums zum Eckpfeiler der Transformation.
GROSSE REFORM VON ALEXANDER II

Die Bewertungen einiger Reformen Alexanders II. sind widersprüchlich. Die liberale Presse nannte seine Reformen „großartig“. Gleichzeitig bewerteten ein erheblicher Teil der Bevölkerung (Teil der Intelligenz) sowie eine Reihe von Regierungsbeamten dieser Zeit diese Reformen negativ.
Außenpolitik
Während der Regierungszeit von Alexander II. kehrte Russland zu der Politik der umfassenden Expansion des Russischen Reiches zurück, die zuvor für die Regierungszeit von Katharina II. charakteristisch war.
In dieser Zeit wurden Zentralasien, der Nordkaukasus, der Ferne Osten, Bessarabien und Batumi an Russland angegliedert. In den ersten Jahren seiner Herrschaft wurden Siege im Kaukasuskrieg errungen. Der Vormarsch nach Zentralasien endete erfolgreich (1865-1881 wurde der größte Teil Turkestans Teil Russlands).
Auch am östlichen Rand Asiens machte Russland während der Herrschaft Alexanders II. recht wichtige Errungenschaften, und zwar auf friedliche Weise. Gemäß dem Vertrag mit China (1857) fiel das gesamte linke Ufer des Amur an Russland, und der Pekinger Vertrag (1860) stellte uns auch einen Teil des rechten Ufers zwischen dem Fluss zur Verfügung. Ussuri, Korea und das Meer. Seitdem begann die rasche Besiedlung der Amur-Region und nach und nach entstanden verschiedene Siedlungen und sogar Städte.
Unter Alexander II. kam es zum „Deal des Jahrhunderts“ mit dem Verkauf Alaskas. Im Jahr 1867 beschloss die Regierung, Russlands Besitztümer in Nordamerika aufzugeben und Alaska (Russland-Amerika) für 7 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten zu verkaufen (Übrigens kostete ein dreistöckiges Bezirksgerichtsgebäude in New York damals mehr als ganz Alaska).
1875 gab Japan den Teil Sachalins, der noch nicht zu Russland gehörte, im Tausch gegen die Kurilen ab.
Seine größte Errungenschaft war jedoch der Russisch-Türkische Krieg von 1877–1878, der den Balkanvölkern die Befreiung vom türkischen Joch brachte.
Die Türken eroberten die Balkanhalbinsel und alle Christen wurden versklavt. 500 Jahre lang schmachteten Griechen, Serben, Bulgaren, Kroaten und Armenier unter dem Joch der Muslime. Sie waren alle Sklaven. Ihr Eigentum und ihr Leben gehörten den Türken. Ihre Frauen und Töchter wurden in Harems verschleppt, ihre Söhne in die Sklaverei. Schließlich rebellierten die Bulgaren. Die Türken begannen, sie durch brutale Hinrichtungen und Folter zu besänftigen. Alexander versuchte, auf friedlichem Wege die Befreiung zu erreichen, jedoch vergeblich. Dann erklärte Russland der Türkei den Krieg und alle Russen gingen voller Begeisterung los, um ihr Blut für ihre christlichen Brüder zu vergießen. 1877 wurden die Balkanslawen befreit!
Wachsende öffentliche Unzufriedenheit
Die Herrschaft Alexanders II. verlief trotz liberaler Reformen nicht ruhig. Die wirtschaftliche Lage des Landes verschlechterte sich: Die Industrie wurde von einer anhaltenden Depression heimgesucht, und auf dem Land kam es mehrfach zu Massenhungerattacken.
Das Außenhandelsdefizit und die öffentliche Auslandsverschuldung erreichten große Ausmaße (fast 6 Milliarden Rubel), was zu einem Zusammenbruch des Geldumlaufs und der öffentlichen Finanzen führte.
Das Problem der Korruption hat sich verschärft.
In der russischen Gesellschaft bildeten sich Spaltungen und akute soziale Widersprüche, die gegen Ende der Herrschaft ihren Höhepunkt erreichten.
Weitere negative Aspekte sind in der Regel die für Russland ungünstigen Ergebnisse des Berliner Kongresses von 1878, exorbitante Ausgaben im Krieg von 1877–1878, zahlreiche Bauernaufstände (1861–1863: mehr als 1150 Aufstände) und groß angelegte nationalistische Aufstände im Königreich in Polen und im Nordwesten (1863) sowie im Kaukasus (1877-1878).
Attentatsversuche
Unter Alexander II. entwickelte sich die revolutionäre Bewegung stark. Mitglieder revolutionärer Parteien verübten mehrmals Attentate auf den Zaren.
Die Terroristen organisierten eine regelrechte Jagd auf den Kaiser. Es gab mehrere Attentate auf ihn: Karakozov 4. April 1866 , polnischer Emigrant Berezovsky 25. Mai 1867 in Paris, Solowjew 2. April 1879 in St. Petersburg ein Versuch, einen kaiserlichen Zug in der Nähe von Moskau in die Luft zu jagen 19. November 1879 , Explosion im Winterpalast durch Khalturin 5. Februar 1880 .
Gerüchten zufolge erzählte ein Pariser Zigeuner 1867 dem russischen Kaiser Alexander II.: „Sechs Mal steht dein Leben auf der Kippe, aber es endet nicht, und beim siebten Mal wird dich der Tod ereilen.“ Die Vorhersage wurde wahr...
Mord
1. März 1881 - der letzte Anschlag auf Alexander II., der zu seinem Tod führte.
Am Tag zuvor, dem 28. Februar (Samstag der ersten Fastenwoche), empfing der Kaiser zusammen mit einigen anderen Familienmitgliedern in der kleinen Kirche des Winterpalastes die Heiligen Mysterien.

Am frühen Morgen des 1. März 1881 verließ Alexander II. in Begleitung einer eher kleinen Wache den Winterpalast in Richtung Manege. Er war beim Wachwechsel anwesend und nachdem er mit seiner Cousine, Großfürstin Katharina Michailowna, Tee getrunken hatte, kehrte der Kaiser über den Katharinenkanal zum Winterpalast zurück. Das Attentat ereignete sich, als die königliche Wagenkolonne auf den Uferdamm des Katharinenkanals in St. Petersburg fuhr. Nikolai Rysakov warf als erster eine Bombe, der Zar blieb jedoch unverletzt (Dies war der sechste erfolglose Versuch). Er stieg aus der Kutsche und sprach mit dem Mitglied der Narodnaja Wolja und fragte ihn nach seinem Namen und Dienstgrad. In diesem Moment rannte Ignatius Grinevitsky auf Alexander II. zu und warf eine Bombe zwischen sich und den Zaren. Beide wurden tödlich verwundet. Die Druckwelle warf Alexander II. zu Boden und blutete stark aus seinen gequetschten Beinen. Der gefallene Kaiser flüsterte: „Bring mich zum Palast ... Dort möchte ich sterben.“ Alexander II. wurde in einen Schlitten gesetzt und zum Palast geschickt. Dort starb nach einiger Zeit Alexander II.

Im Krankenhaus kam der Königsmörder vor seinem Tod zur Besinnung, nannte aber seinen Nachnamen nicht. Rysakov blieb unverletzt und wurde sofort von Ermittlern festgenommen und verhört. Aus Angst vor einem Todesurteil erzählte der 19-jährige Terrorist alles, was er wusste, einschließlich des Verrats am gesamten Kern von Narodnaja Wolja. Es begannen Verhaftungen der Organisatoren des Attentats. Im Prozess gegen die „Ersten Marschierer“ wurde Grinevitsky als Kotik, Elnikov oder Michail Iwanowitsch behandelt. Der wahre Name des Königsmörders wurde erst in bekannt  Sowjetzeit. Seltsamerweise war dieser junge Mann im Leben kein „Höllenfeind“. Ignatius Joachimovich Grinevitsky wurde 1856 in der Provinz Minsk in die Familie eines verarmten polnischen Adligen geboren. Er absolvierte erfolgreich das Bialystok Real Gymnasium und trat 1875 in das Technologische Institut von St. Petersburg ein. Jeder kannte ihn als sanften, bescheidenen, freundlichen Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Im Gymnasium war Ignatius einer der besten Schüler und erhielt dort den Spitznamen Kotik, der später zu seinem Untergrund-Spitznamen wurde. Am Institut schloss er sich einem revolutionären Zirkel an, war einer der Organisatoren der Veröffentlichung der Arbeiterzeitung und Teilnehmer des „Spaziergangs unter dem Volk“. Den Beweisen zufolge hatte Grinevitsky nicht nur ein sanftmütiges Gemüt, sondern war auch Katholik. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie ein gläubiger Christ einen Mord begehen könnte. Offensichtlich glaubte er, dass die Autokratie in Russland ein großes Übel sei und dass alle Mittel gut seien, um sie zu zerstören. Er erklärte sich zu bewusster Selbstaufopferung und bereit, sich „in die Hände des Teufels“ zu begeben. Was war das? Größter ideologischer Geist oder schlichte Geistestrübung?
Sowjetzeit. Seltsamerweise war dieser junge Mann im Leben kein „Höllenfeind“. Ignatius Joachimovich Grinevitsky wurde 1856 in der Provinz Minsk in die Familie eines verarmten polnischen Adligen geboren. Er absolvierte erfolgreich das Bialystok Real Gymnasium und trat 1875 in das Technologische Institut von St. Petersburg ein. Jeder kannte ihn als sanften, bescheidenen, freundlichen Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Im Gymnasium war Ignatius einer der besten Schüler und erhielt dort den Spitznamen Kotik, der später zu seinem Untergrund-Spitznamen wurde. Am Institut schloss er sich einem revolutionären Zirkel an, war einer der Organisatoren der Veröffentlichung der Arbeiterzeitung und Teilnehmer des „Spaziergangs unter dem Volk“. Den Beweisen zufolge hatte Grinevitsky nicht nur ein sanftmütiges Gemüt, sondern war auch Katholik. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie ein gläubiger Christ einen Mord begehen könnte. Offensichtlich glaubte er, dass die Autokratie in Russland ein großes Übel sei und dass alle Mittel gut seien, um sie zu zerstören. Er erklärte sich zu bewusster Selbstaufopferung und bereit, sich „in die Hände des Teufels“ zu begeben. Was war das? Größter ideologischer Geist oder schlichte Geistestrübung?

Der Tod des „Befreiers“, der von der Narodnaja Wolja im Namen der „Befreiten“ getötet wurde, schien vielen ein symbolisches Ende seiner Herrschaft zu sein, die aus Sicht des konservativen Teils der Gesellschaft zu einer grassierenden Herrschaft führte "Nihilismus". Man sagt, dass halb Russland seinen Tod wollte. Rechte Politiker sagten, der Kaiser sei „zur richtigen Zeit“ gestorben: Hätte er noch ein oder zwei Jahre regiert, wäre die Katastrophe Russlands (der Zusammenbruch der Autokratie) unvermeidlich geworden.
Dämonen- also F.M. Dostojewski nannte Revolutionäre Terroristen. In seinem letzten Werk „Die Brüder Karamasow“ wollte Dostojewski das Thema der Dämonen weiterführen. Der Autor plante, Aljoscha Karamasow, fast einen Heiligen, zu einem Terroristen zu „machen“, der sein Leben auf dem Schafott beendete! Dostojewski wird oft als Prophet-Schriftsteller bezeichnet. Tatsächlich hat er den zukünftigen Mörder des Zaren nicht nur vorhergesagt, sondern sogar beschrieben: Aljoscha Karamasow ist Ignatius Grinevitsky sehr ähnlich. Der Schriftsteller erlebte die Ermordung Alexanders II. nicht mehr – er starb einen Monat vor dem tragischen Ereignis.
Trotz der Verhaftung und Hinrichtung aller Anführer der Narodnaja Wolja kam es in den ersten zwei bis drei Regierungsjahren Alexanders III. weiterhin zu Terroranschlägen.
Ergebnisse der Regierungszeit Alexanders II
Alexander II. hinterließ tiefe Spuren in der Geschichte; ihm gelang, wovor andere Autokraten Angst hatten – die Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft. Wir freuen uns noch heute über die Früchte seiner Reformen. Während seiner Herrschaft festigte Russland seine Beziehungen zu den europäischen Mächten und löste zahlreiche Konflikte mit Nachbarländern. Die inneren Reformen Alexanders II. sind in ihrem Ausmaß nur mit den Reformen Peters I. vergleichbar. Der tragische Tod des Kaisers veränderte den weiteren Verlauf der Geschichte stark, und dieses Ereignis führte 35 Jahre später Russland und Nikolaus in den Tod II zu einem Märtyrerkranz.
Die Ansichten moderner Historiker zur Ära Alexanders II. unterlagen unter dem Einfluss der vorherrschenden Ideologie dramatischen Veränderungen und sind nicht verbindlich.
Material vorbereitet von Sergey Shulyak
Kaiser Alexander II. wurde am 29. April 1818 geboren. Als Sohn Nikolaus I. und Thronfolger erhielt er eine hervorragende und umfassende Ausbildung. Alexanders Lehrer waren Schukowski und der Militäroffizier Merder. Auch sein Vater hatte spürbaren Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung Alexanders II. Alexander bestieg den Thron nach dem Tod von Nikolaus I. im Jahr 1855. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er bereits über einige Führungserfahrung, da er als Herrscher fungierte, während sein Vater nicht in der Hauptstadt war. Dieser Herrscher ging als Alexander der 2. Befreier in die Geschichte ein. Bei der Zusammenstellung einer Kurzbiographie Alexanders II. ist es notwendig, seine Reformaktivitäten zu erwähnen.
Die Frau von Alexander II. war 1841 Prinzessin Maximilian Wilhelmina Augusta Sophia Maria von Hessen-Darmstadt, besser bekannt als Maria Alexandrowna. Sie gebar Alexander sieben Kinder, die beiden ältesten starben. Und seit 1880 war der Zar (in einer morganatischen Ehe) mit Prinzessin Dolgorukaya verheiratet, mit der er vier Kinder hatte.
Die Innenpolitik Alexanders II. unterschied sich deutlich von der Politik Nikolaus I. und war ausgeprägt. Die wichtigste davon war die Bauernreform von Alexander dem 2., nach der sie am 19. Februar 1861 stattfand. Diese Reform führte zu einem dringenden Bedarf an weiteren Veränderungen in vielen russischen Institutionen und führte zur Umsetzung von Alexander dem Zweiten.
Im Jahr 1864 wurde es auf Erlass Alexanders II. durchgeführt. Sein Ziel war die Schaffung eines Systems der kommunalen Selbstverwaltung, für das die Einrichtung des Bezirkssemstwo gegründet wurde.
Alexander I. wurde am 29. April 1818 in Moskau geboren. Zu Ehren seiner Geburt wurde in Moskau eine Salve von 201 Kanonen abgefeuert. Die Geburt Alexanders II. erfolgte während der Herrschaft Alexanders I., der keine Kinder hatte, und Alexanders erster Bruder Konstantin hatte keine imperialen Ambitionen, weshalb der Sohn von Nikolaus I., Alexander II., sofort als zukünftiger Kaiser in Betracht gezogen wurde. Als Alexander II. 7 Jahre alt war, war sein Vater bereits Kaiser geworden.
Nikolaus I. ging bei der Ausbildung seines Sohnes sehr verantwortungsbewusst vor. Alexander erhielt zu Hause eine hervorragende Ausbildung. Seine Lehrer waren herausragende Köpfe dieser Zeit, wie der Anwalt Michail Speranski, der Dichter Wassili Schukowski, der Finanzier Jegor Kankrin und andere. Alexander studierte das Gesetz Gottes, Gesetzgebung, Außenpolitik, physikalische und mathematische Wissenschaften, Geschichte, Statistik, Chemie und Technologie. Darüber hinaus studierte er Militärwissenschaften. Beherrschte Englisch, Deutsch und Französisch. Zum Lehrer des künftigen Kaisers wurde der Dichter Wassili Schukowski ernannt, der auch Alexanders Lehrer für die russische Sprache war.
Alexander II. in seiner Jugend. Unbekannter Künstler. OK. 1830
Alexanders Vater überwachte seine Ausbildung persönlich und nahm an Alexanders Prüfungen teil, die er selbst alle zwei Jahre organisierte. Nikolaus bezog seinen Sohn auch in Regierungsangelegenheiten ein: Ab seinem 16. Lebensjahr musste Alexander an Senatssitzungen teilnehmen, später wurde Alexander Mitglied der Synode. Im Jahr 1836 wurde Alexander zum Generalmajor befördert und in das Gefolge des Zaren aufgenommen.
Die Ausbildung endete mit einer Reise ins Russische Reich und nach Europa.
Nikolaus I., aus der „Ermahnung“ an seinen Sohn vor seiner Reise nach Russland: „Ihre erste Pflicht wird es sein, alles zu sehen, mit dem unabdingbaren Ziel, sich gründlich mit dem Staat vertraut zu machen, über den Sie früher oder später herrschen werden. Deshalb sollte Ihre Aufmerksamkeit gleichermaßen auf alles gerichtet sein ... um ein Verständnis für den gegenwärtigen Stand der Dinge zu erlangen.“
Im Jahr 1837 unternahm Alexander in Begleitung von Schukowski, Adjutant Kavelin und mehreren anderen ihm nahestehenden Personen eine lange Reise durch Russland und besuchte 29 Provinzen des europäischen Teils, Transkaukasiens und Westsibiriens.
Nikolaus I., aus der „Ermahnung“ an seinen Sohn vor seiner Europareise: „Vieles wird Sie verführen, aber bei näherer Betrachtung werden Sie überzeugt sein, dass nicht alles eine Nachahmung verdient; ... wir müssen immer unsere Nationalität, unsere Prägung bewahren und es tut uns weh, wenn wir dahinter zurückfallen; In ihm liegt unsere Stärke, unser Heil, unsere Einzigartigkeit.“
In den Jahren 1838-1839 besuchte Alexander die Länder Mitteleuropas, Skandinaviens, Italiens und Englands. In Deutschland lernte er seine zukünftige Frau Maria Alexandrowna kennen, Tochter des Großherzogs Ludwig von Hessen-Darmstadt, mit der sie zwei Jahre später heirateten.
Beginn der Herrschaft
Der Thron des Russischen Reiches ging am 3. März 1855 an Alexander. In diese für Russland schwierige Zeit fiel der Krimkrieg, in dem Russland keine Verbündeten hatte und die Gegner fortgeschrittene europäische Mächte waren (Türkei, Frankreich, England, Preußen und Sardinien). Der Krieg um Russland war zum Zeitpunkt der Thronbesteigung Alexanders fast vollständig verloren. Alexanders erster wichtiger Schritt bestand darin, die Verluste des Landes durch den Abschluss des Pariser Friedens im Jahr 1856 auf ein Minimum zu reduzieren. Anschließend besuchte der Kaiser Frankreich und Polen, wo er dazu aufrief, „mit dem Träumen aufzuhören“ (gemeint waren Träume von der Niederlage Russlands). Später ging er ein Bündnis mit dem König von Preußen ein und bildete so ein „Doppelbündnis“. Solche Aktionen schwächten die außenpolitische Isolation des Russischen Reiches, in dem es sich während des Krimkrieges befand, erheblich.
Das Kriegsproblem war jedoch nicht das einzige, das der neue Kaiser aus den Händen seines verstorbenen Vaters erbte: Die Bauern-, Polen- und Ostfragen wurden nicht gelöst. Darüber hinaus wurde die Wirtschaft des Landes durch den Krimkrieg stark geschwächt.
Nikolaus I. wandte sich vor seinem Tod an seinen Sohn: „Ich übergebe Ihnen mein Team, aber leider nicht in der Reihenfolge, in der ich es wollte, was Ihnen viel Arbeit und Sorgen beschert.“
Zeit großer Reformen
Zunächst unterstützte Alexander die konservative Politik seines Vaters, doch langjährige Probleme konnten nicht länger ungelöst bleiben und Alexander begann eine Reformpolitik.
Im Dezember 1855 wurde das Oberste Zensurkomitee geschlossen und die kostenlose Ausstellung ausländischer Pässe erlaubt. Im Sommer 1856, anlässlich der Krönung, gewährte der neue Kaiser den Dekabristen, Petrascheviten (Freidenker, die das politische System in Russland wieder aufbauen wollten und von der Regierung Nikolaus I. verhaftet wurden) und Teilnehmern des polnischen Aufstands Amnestie . Im gesellschaftspolitischen Leben des Landes ist ein „Tauwetter“ eingetreten.
Darüber hinaus Alexander II 1857 liquidiert Militärsiedlungen, unter Alexander I. gegründet.
Als nächstes ging es um die Lösung der Bauernfrage, die die Entwicklung des Kapitalismus im Russischen Reich stark behinderte und der Abstand zu den fortgeschrittenen europäischen Mächten jedes Jahr größer wurde.
Alexander II., aus einer Ansprache an den Adel im März 1856: „Es gibt Gerüchte, dass ich die Befreiung von der Leibeigenschaft verkünden möchte. Das ist nicht fair... Aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass ich völlig dagegen bin. Wir leben in einer Zeit, in der dies irgendwann geschehen muss ... Es ist viel besser, dass es von oben geschieht als von unten
Die Reform dieses Phänomens wurde lange und sorgfältig vorbereitet, und zwar nur in 1861 Alexander II. unterzeichnete Manifest zur Abschaffung der Leibeigenschaft Und Vorschriften über Bauern, die aus der Leibeigenschaft hervorgehen, zusammengestellt von Stellvertretern der Kaiser, meist Liberalen wie Nikolai Miljutin, Jakow Rostowzew und anderen. Der liberale Geist der Reformbefürworter wurde jedoch vom Adel unterdrückt, der größtenteils auf persönliche Vorteile nicht verzichten wollte. Aus diesem Grund wurde die Reform eher im Interesse des Adels als im Interesse des Volkes durchgeführt, da die Bauern nur persönliche Freiheit und Bürgerrechte erhielten und für den Bedarf der Bauern Land von den Grundbesitzern kaufen mussten . Dennoch half die Regierung den Bauern bei der Rückzahlung mit Subventionen, die es den Bauern ermöglichten, das Land sofort zu kaufen, während sie weiterhin Schuldner des Staates blieben. Trotz dieser Aspekte wurde Alexander II. als „Zarenbefreier“ dieser Reform in die Geschichte eingegangen.

Lesung des Manifests von Alexander II. von 1861 auf dem Smolnaja-Platz in St. Petersburg. Künstler A.D. Kiwschenko.
Der Reform der Leibeigenschaft folgten eine Reihe von Reformen. Die Abschaffung der Leibeigenschaft schuf eine neue Art von Wirtschaft, während das auf dem Feudalsystem basierende Finanzwesen einen veralteten Typ seiner Entwicklung widerspiegelte. Im Jahr 1863 wurde die Finanzreform durchgeführt. Im Zuge dieser Reform wurden die Staatsbank des Russischen Reiches und die Haupteinlösungsinstitution des Finanzministeriums geschaffen. Der erste Schritt war die Einführung des Grundsatzes der Transparenz bei der Bildung des Staatshaushalts, der es ermöglichte, Unterschlagungen zu minimieren. Außerdem wurden Staatskassen geschaffen, um alle Staatseinnahmen zu verwalten. Nach der Reform begann die Besteuerung einer modernen Besteuerung zu ähneln, wobei die Steuern in direkte und indirekte Steuern unterteilt wurden.
Im Jahr 1863 wurde eine Bildungsreform durchgeführt, die den Zugang zur Sekundar- und Hochschulbildung ermöglichte, ein Netz öffentlicher Schulen entstand und Schulen für das Bürgertum geschaffen wurden. Universitäten erhielten einen Sonderstatus und eine relative Autonomie, was sich wiederum positiv auf die Bedingungen der wissenschaftlichen Tätigkeit und das Ansehen des Lehrberufs auswirkte.
Die nächste große Reform war Die Zemstvo-Reform wurde im Juli 1864 durchgeführt. Nach dieser Reform wurden lokale Selbstverwaltungsorgane geschaffen: Zemstwos und Stadtdumas, die selbst Wirtschafts- und Haushaltsfragen lösten.
Es bestand Bedarf an einem neuen Justizsystem, um das Land zu regieren. Auch eine Justizreform wurde 1864 durchgeführt, die die Gleichheit aller Klassen vor dem Gesetz garantierte. Die Institution der Jurys wurde geschaffen. Außerdem wurden die meisten Treffen offen und öffentlich. Alle Treffen wurden wettbewerbsorientiert.
Im Jahr 1874 wurde eine Militärreform durchgeführt. Anlass für diese Reform war die demütigende Niederlage Russlands im Krimkrieg, bei der alle Mängel der russischen Armee und ihr Rückstand gegenüber den europäischen zutage traten. Es stellte Übergang von der Wehrpflicht zur allgemeinen Wehrpflicht und Verkürzung der Dienstzeiten. Durch die Reform wurde die Größe der Armee um 40 % reduziert, ein Netz von Militär- und Kadettenschulen für Menschen aller Klassen geschaffen, das Hauptquartier der Armee und Militärbezirke geschaffen, die Aufrüstung der Armee erfolgte und Marine, die Abschaffung der körperlichen Züchtigung in der Armee und die Schaffung von Militärgerichten und Militärstaatsanwälten mit kontradiktorischer Prozessführung.
Historiker haben festgestellt, dass Alexander II. Entscheidungen über Reformen nicht aufgrund seiner eigenen Überzeugung traf, sondern weil er deren Notwendigkeit erkannte. Daraus können wir schließen, dass sie für das damalige Russland gezwungen waren.
Territoriale Veränderungen und Kriege unter Alexander II
Innere und äußere Kriege während der Herrschaft Alexanders II. verliefen erfolgreich. Der Kaukasuskrieg endete 1864 erfolgreich, wodurch der gesamte Nordkaukasus von Russland erobert wurde. Gemäß den Verträgen von Aigun und Peking mit dem Chinesischen Reich annektierte Russland 1858–1860 die Gebiete Amur und Ussuri. 1863 schlug der Kaiser den Aufstand in Polen erfolgreich nieder. In den Jahren 1867-1873 vergrößerte sich das Territorium Russlands durch die Eroberung der Region Turkestan und des Fergana-Tals sowie den freiwilligen Eintritt in die Vasallenrechte des Emirats Buchara und des Khanats Chiwa.
Im Jahr 1867 wurde Alaska (Russisch-Amerika) für 7 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten verkauft. Was damals für Russland aufgrund der Abgelegenheit dieser Gebiete und im Interesse guter Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ein lukratives Geschäft war.
Wachsende Unzufriedenheit mit den Aktivitäten Alexanders II., Attentaten und Morden
Während der Herrschaft Alexanders II. gab es im Gegensatz zu seinen Vorgängern mehr als genug soziale Proteste. Zahlreiche Bauernaufstände (von Bauern, die mit den Bedingungen der Bauernreform unzufrieden waren), der polnische Aufstand und in der Folge die Versuche des Kaisers, Polen zu russifizieren, führten zu Wellen der Unzufriedenheit. Darüber hinaus traten zahlreiche Protestgruppen unter den Intellektuellen und Arbeitern auf und bildeten Kreise. Zahlreiche Kreise begannen, revolutionäre Ideen zu propagieren, indem sie „zum Volk gingen“. Die Versuche der Regierung, die Kontrolle über diese Prozesse zu übernehmen, verschlimmerten den Prozess nur. Im Prozess 193 der Populisten beispielsweise war die Gesellschaft über das Vorgehen der Regierung empört.
„Generell hat sich in allen Teilen der Bevölkerung eine Art vager Unmut breitgemacht. Jeder beschwert sich über etwas und scheint Veränderungen zu wollen und zu erwarten.“
Es kommt immer häufiger zu Attentaten und Terroranschlägen auf bedeutende Regierungsbeamte. Während die Öffentlichkeit den Terroristen buchstäblich applaudierte. Terrororganisationen wuchsen immer mehr; beispielsweise hatte Narodnaja Wolja, die Ende der 70er Jahre Alexander II. zum Tode verurteilte, mehr als hundert aktive Mitglieder.
Plason Anton-Antonovich, Zeitgenosse Alexanders II.: „Nur während eines bewaffneten Aufstands, der bereits ausgebrochen ist, kann es zu einer solchen Panik kommen, wie sie Ende der 70er und in den 80er Jahren alle Menschen in Russland erfasste. In ganz Russland verstummten alle in Clubs, in Hotels, auf der Straße und auf Basaren... Und sowohl in der Provinz als auch in St. Petersburg warteten alle auf etwas Unbekanntes, aber Schreckliches, niemand war sich der Zukunft sicher. ”
Alexander II. wusste buchstäblich nicht, was er tun sollte, und war völlig ratlos. Neben der öffentlichen Unzufriedenheit hatte der Kaiser auch Probleme in seiner Familie: 1865 starb sein ältester Sohn Nikolaus, sein Tod beeinträchtigte die Gesundheit der Kaiserin. Die Folge war eine völlige Entfremdung in der Familie des Kaisers. Alexander kam ein wenig zur Besinnung, als er Ekaterina Dolgorukaya traf, aber diese Beziehung löste auch Kritik in der Gesellschaft aus.
Regierungschef Pjotr Valuev: „Der Kaiser sieht müde aus und spricht selbst von nervöser Verärgerung, die er zu verbergen versucht. Gekrönte Halbruine. In einer Zeit, in der Stärke gefragt ist, kann man sich natürlich nicht darauf verlassen.“

Osip Komissarow. Foto aus der Sammlung von M.Yu Meshchaninov
Der erste Anschlag auf das Leben des Zaren wurde am 4. April 1866 von einem Mitglied der Gesellschaft „Hölle“ (einer der Organisation „Volk und Freiheit“ benachbarten Gesellschaft) Dmitri Karakozow verübt; Im Moment des Schusses wurde er vom Bauern Osip Komisarov (später erblicher Adliger) geschubst.
„Ich weiß nicht was, aber mein Herz schlug irgendwie, besonders als ich sah, wie dieser Mann sich hastig seinen Weg durch die Menge bahnte; Ich beobachtete ihn unwillkürlich, vergaß ihn dann aber, als der Herrscher näherkam. Plötzlich sah ich, dass er eine Pistole herausgenommen hatte und darauf zielte: Es kam mir sofort so vor, als würde er jemand anderen oder mich töten, wenn ich auf ihn zustürmte oder seine Hand zur Seite drückte, und ich drückte seine Hand unwillkürlich und gewaltsam nach oben ; Dann erinnere ich mich an nichts mehr, ich fühlte mich wie im Nebel.“
Der zweite Versuch wurde am 25. Mai 1867 in Paris durch den polnischen Emigranten Anton Berezovsky unternommen, doch die Kugel traf ein Pferd.
Am 2. April 1879 feuerte ein Mitglied der Narodnaja Wolja, Alexander Solowjow, aus einer Entfernung von 10 Schritten fünf Schüsse auf den Kaiser ab, als er ohne Wache oder Eskorte durch den Winterpalast ging, aber keine einzige Kugel traf das Ziel.
Am 19. November desselben Jahres versuchten Mitglieder der Narodnaja Wolja erfolglos, den Zug des Zaren zu verminen. Das Glück lächelte dem Kaiser wieder zu.
Am 5. Februar 1880 sprengte das Volkswillensmitglied Stepan Khalturin den Winterpalast, doch nur Soldaten seiner Leibgarde kamen ums Leben, der Kaiser selbst und seine Familie wurden nicht verletzt.

Foto der Säle des Winterpalastes nach der Explosion.
Alexander II. starb am 1. März 1881, eine Stunde nach einem weiteren Attentat durch die Explosion einer zweiten Bombe, die Ignatius Grinevitsky, Mitglied der Narodnaja Wolja, am Ufer des Katharinenkanals in St. Petersburg zu seinen Füßen geworfen hatte. Der Kaiser starb an dem Tag, an dem er Loris-Melikovs Verfassungsentwurf genehmigen wollte.

Ergebnisse der Herrschaft
Alexander II. ging als „Zarenbefreier“ und Reformator in die Geschichte ein, obwohl die durchgeführten Reformen viele der jahrhundertealten Probleme Russlands nicht vollständig lösten. Das Territorium des Landes vergrößerte sich trotz des Verlustes Alaskas erheblich.
Allerdings verschlechterte sich unter ihm die wirtschaftliche Lage des Landes: Die Industrie geriet in eine Depression, die Staats- und Auslandsverschuldung erreichte große Ausmaße und es entstand ein Außenhandelsdefizit, das zu einem Zusammenbruch der Finanzen und Währungsbeziehungen führte. Die Gesellschaft war bereits unruhig, und am Ende der Herrschaft kam es zu einer völligen Spaltung.
Privatleben
Alexander II. verbrachte oft Zeit im Ausland, war ein leidenschaftlicher Liebhaber der Großtierjagd, liebte das Eislaufen und machte dieses Phänomen sehr populär. Ich selbst litt an Asthma.
Er selbst war ein sehr verliebter Mensch; während einer Europareise nach seinem Studium verliebte er sich in Königin Victoria.
Er war zweimal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit Maria Alexandrowna (Maximilian von Hessen) hatte er 8 Kinder, darunter Alexander III. Aus seiner zweiten Ehe mit Ekaterina Dolgorukova hatte er vier Kinder.

Familie von Alexander II. Foto von Sergei Levitsky.
Zum Gedenken an Alexander II. wurde an der Stelle seines Todes die Auferstehungskirche errichtet.
Das Schicksal dieses Kaisers ist in vielerlei Hinsicht das Schicksal Russlands, in vielerlei Hinsicht ein Spiel am Rande des Möglichen und des Unmöglichen. Sein ganzes Leben lang handelte Alexander II. nicht so, wie er es wollte, sondern wie es die Umstände, die Verwandten und das Land erforderten. Ist es möglich, dass der König namens Befreier von denen zerstört wird, die sich für die besten Vertreter des Volkes hielten?
Am 17. April 1818 wurde im Chudov-Kloster der erstgeborene Sohn des russischen Kaisers Nikolaus I. geboren. Prominente Lehrer und Wissenschaftler waren an der Erhebung des Thronfolgers beteiligt: V.A. Schukowski, Gesetzgebung wurde von M.M. gelehrt. Speransky und Finanzen E.F. Kankrin. Der zukünftige Kaiser entwickelte schnell ein vollständiges Bild des Staates Russland und seiner potenziellen Zukunft und entwickelte auch staatliches Denken.
Bereits 1834-1635 führte Nikolaus I. seinen Sohn in die wichtigsten Regierungsorgane des Reiches ein: den Senat und die Heilige Synode. Alexander steht wie seine Vorgänger im Militärdienst und war während des Russisch-Türkischen Krieges 1853–1856 für die Kampfkraft der Miliz in St. Petersburg verantwortlich. Als glühender Verfechter der Autokratie glaubt Alexander sehr schnell an die Rückständigkeit des sozioökonomischen Systems Russlands und leitet gleichzeitig eine ganze Reihe von Reformen ein, die das Gesicht des Imperiums für immer verändern werden.
Die Reformen Alexanders II. werden als großartig bezeichnet: Abschaffung der Leibeigenschaft (1861), Justizreform (1863), Bildungsreform (1864), Zemstvo-Reform (1864), Militärreform (1874). Die Veränderungen betrafen alle Bereiche der russischen Gesellschaft und prägten die wirtschaftlichen und politischen Konturen Russlands nach der Reform. Die Aktivitäten Alexanders II. zielten vor allem darauf ab, die über Jahrhunderte bestehende Ordnung aufzubrechen, was einerseits zu einem Anstieg der gesellschaftlichen Aktivität führte, andererseits aber auch eine Reaktion seitens der Gutsbesitzerschicht hervorrief. Infolge einer solchen Haltung gegenüber dem Zaren-Befreier starb Kaiser Alexander II. am 1. März 1881 am Ufer des Katharinenkanals (heute Gribojedow-Kanal) durch Bomber der Narodnaja Wolja. Historiker streiten immer noch darüber, was aus Russland geworden wäre, wenn der Souverän mindestens vier Tage gelebt hätte, als Loris-Melikovs Verfassungsentwurf im Staatsrat diskutiert werden sollte.
Während der Herrschaft Alexanders II. feierte die russische Gesellschaft und der Staat ihr 1000-jähriges Bestehen. Rückblickend, tief in die Jahrhunderte, sah jeder Russe die Jahre des Kampfes mit der hartnäckigen Natur um die Ernte, das 240-jährige tatarische Joch und Iwan den Großen, der es abwarf, die Feldzüge des Schrecklichen gegen Kasan und Astrachan erster Kaiser Peter und seine Gefährten sowie Alexander I. der Selige, der Frieden und den Triumph des Rechts in Europa brachte! Die Liste der ruhmreichen Vorfahren und ihrer Taten wurde im Denkmal „Millennium Russlands“ festgehalten (im Geiste der Zeit wurde es nicht auf dem Denkmal verewigt), das in der ersten Hauptstadt des russischen Staates, Nowgorod, errichtet wurde 1862.
Heute gibt es viele Denkmäler für Alexander II., den Befreier, eines davon steht in Helsinki. In St. Petersburg am Ufer des Kanals. Gribojedow, an der Stelle der tödlichen Wunde des Kaiser-Befreiers wurde die Auferstehungskirche errichtet, in der noch heute die Pflastersteine zu sehen sind, auf denen am 1. März 1881 Alexanders Blut vergossen wurde.
Am 3. März 1855 bestieg Alexander II. Nikolajewitsch den Thron. In seiner ersten Rede vor den Mitgliedern des Rates sagte der neue Kaiser: „Mein unvergesslicher Elternteil liebte Russland und sein ganzes Leben lang dachte er ständig nur an seine Vorteile. In seiner ständigen und täglichen Arbeit mit mir sagte er mir, dass ich alles Unangenehme und alles Schwierige für mich nehmen möchte, nur um Ihnen ein geordnetes, glückliches und ruhiges Russland zu übergeben. Die Vorsehung urteilte anders, und der verstorbene Kaiser sagte mir in den letzten Stunden seines Lebens, dass ich mein Kommando an Sie übergebe, aber leider nicht in der von ihm gewünschten Reihenfolge, was Ihnen viel Arbeit und Sorgen hinterließ.“
Der erste wichtige Schritt war das Ende des blutigen Krimkrieges von 1853–1856. Alexander II. schloss im März 1856 den Vertrag von Paris. Als die äußeren Feinde aufhörten, Russland zu quälen, begann der Kaiser mit der Wiederherstellung des Landes und begann mit Reformen.
Große Reformen Alexanders II.
Aufhebung der Militärsiedlungen im Jahr 1857.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in der Zeit der Kriege mit Napoleon, entstand der Vorschlag, in den Binnenprovinzen groß angelegte Militärsiedlungen zu organisieren. Diese Idee wurde von Kaiser Alexander I. vorgebracht. Er hoffte, dass militärische Siedlungen die Reservearmeen in Russland ersetzen und es ermöglichen würden, die Truppenzahl bei Bedarf um ein Vielfaches zu erhöhen. Solche Siedlungen gaben den unteren Rängen die Möglichkeit, während ihres Dienstes bei ihren Familien zu bleiben, ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten fortzusetzen und sich im Alter mit einer Wohnung und Nahrung zu versorgen.
Doch die militärischen Siedlungen hielten nicht lange an und brachten nur Verluste für die Staatskasse. Nachdem Kaiser Alexander II. den Thron bestiegen hatte, wurde Adjutant Dmitri Stolypin in Militärsiedlungen geschickt. Nachdem er alle Siedlungen besichtigt hatte, berichtete Stolypin dem Kaiser, dass die Bevölkerung der Bezirke stark verarmt sei, viele Besitzer kein Vieh hätten, die Gartenarbeit verfallen sei, Gebäude in den Bezirken repariert werden müssten und dass, um die Truppen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, Es wurde so viel Land benötigt, dass den Dorfbewohnern nur ungünstige Gebiete blieben. Sowohl die örtlichen als auch die Hauptbehörden der Militärsiedlungen kamen zu dem Schluss, dass die Militärsiedlungen materiell unrentabel seien und ihr Ziel nicht erreichten. Vor diesem Hintergrund wurden 1857 Militärsiedlungen und Ackersoldatenbezirke aufgelöst und der Verwaltung des Ministeriums für Staatseigentum übertragen.
Abschaffung der Leibeigenschaft im Jahr 1861.
Die ersten Schritte zur Einschränkung und weiteren Abschaffung der Leibeigenschaft wurden von Paul I. im Jahr 1797 mit der Unterzeichnung des Manifests über die dreitägige Korvee unternommen, gefolgt von Alexander I. im Jahr 1803 mit der Unterzeichnung des Dekrets über freie Landwirte, und auch von Nikolaus I., der die Bauernpolitik Alexanders I. fortsetzte.
Die von Alexander II. zusammengestellte neue Regierung beschloss, diese Politik nicht nur fortzusetzen, sondern auch die Bauernfrage vollständig zu lösen. Und bereits am 3. März 1861 unterzeichnete Alexander II. in St. Petersburg das Manifest über die Abschaffung der Leibeigenschaft und die Verordnung über den Austritt der Bauern aus der Leibeigenschaft, das aus 17 Gesetzgebungsakten bestand.
- Bauern galten nicht mehr als Leibeigene, sondern galten als vorübergehend verschuldet. Die Bauern erhielten die volle bürgerliche Rechtsfähigkeit in allem, was nicht mit ihren besonderen Klassenrechten und -pflichten zusammenhing – der Mitgliedschaft in der ländlichen Gesellschaft und dem Besitz von Kleingartengrundstücken.
- Bauernhäuser, Gebäude und sämtliches bewegliches Eigentum der Bauern wurden als ihr persönliches Eigentum anerkannt.
- Die Bauern erhielten eine gewählte Selbstverwaltung, die unterste wirtschaftliche Einheit der Selbstverwaltung war die Landgesellschaft, die höchste Verwaltungseinheit war der Volost.
- Die Grundbesitzer behielten das Eigentum an allen ihnen gehörenden Ländereien, waren jedoch verpflichtet, den Bauern ein Hausgrundstück und eine Ackerparzelle zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Ackerland wurde den Bauern nicht persönlich zur Verfügung gestellt, sondern zur kollektiven Nutzung durch ländliche Gesellschaften, die es nach eigenem Ermessen auf die Bauernhöfe verteilen konnten. Die Mindestgröße eines Bauerngrundstücks für jeden Ort wurde gesetzlich festgelegt.
- Für die Nutzung des Kleingartenlandes mussten die Bauern Fronarbeit leisten oder Quitrent zahlen und hatten 49 Jahre lang kein Recht, dies zu verweigern.
- Die Größe der Feldparzellen und die Abgaben mussten in Urkunden festgehalten werden, die von den Grundbesitzern für jedes Anwesen erstellt und von Friedensvermittlern überprüft wurden.
- Ländlichen Gesellschaften wurde das Recht eingeräumt, das Gut und im Einvernehmen mit dem Grundbesitzer auch die Feldparzelle aufzukaufen, woraufhin alle Verpflichtungen der Bauern gegenüber dem Grundbesitzer erloschen. Die Bauern, die das Grundstück kauften, wurden Bauernbesitzer genannt. Bauern konnten auch das Rücknahmerecht verweigern und vom Grundbesitzer eine unentgeltliche Zuteilung in Höhe von einem Viertel der Zuteilung erhalten, auf die sie ein Rücknahmerecht hatten. Mit der Zuteilung eines Gratiskontingents endete auch der vorübergehend verpflichtete Staat.
- Der Staat gewährte den Grundbesitzern zu Vorzugskonditionen finanzielle Garantien für den Erhalt der Ablösezahlungen und übernahm deren Zahlung. Die Bauern mussten dementsprechend Abfindungszahlungen an den Staat leisten.
Viele Historiker halten die Reform Alexanders II. für unvollständig und argumentieren, dass sie nicht zur Befreiung der Bauern geführt habe, sondern nur den Mechanismus für eine solche Befreiung festgelegt habe, und zwar einen unfairen. Aus der Rede des „Populisten“ I.N. Myshkina: „Die Bauern sahen, dass ihnen Sand und Sümpfe und einige verstreute Landstücke gegeben wurden, auf denen es unmöglich war, Landwirtschaft zu betreiben, als sie sahen, dass dies mit Genehmigung der Staatsbehörden geschah, als sie sahen, dass es das nicht gab.“ Als sie den mysteriösen Artikel des Gesetzes vertraten, von dem sie annahmen, dass er die Interessen des Volkes schützte, gelangten sie zu der Überzeugung, dass sie sich nicht auf die Staatsgewalt verlassen konnten, sondern dass sie sich nur auf sich selbst verlassen konnten.“
„Die Befreiung der Bauern (Lesung des Manifests).“ Boris Kustodiev.1907
Finanzreform.
Die Abschaffung der Leibeigenschaft schuf in Russland eine neue Art von Wirtschaft. Die Reformen begannen am 22. Mai 1862 mit der Einführung der „Regeln über die Erstellung, Prüfung und Ausführung der Staatslisten und Finanzvoranschläge der Ministerien und Hauptabteilungen“. Der erste Schritt war die Einführung des Grundsatzes der Finanztransparenz und der Beginn der Veröffentlichung des Staatshaushalts. In den Jahren 1864–68 wurden innerhalb der Struktur des Finanzministeriums Staatskassen eingerichtet, die alle Staatseinnahmen verwalteten. Im Jahr 1865 wurden lokale Finanzselbstverwaltungsorgane – Kontrollkammern – geschaffen.
Mit Beginn der Reformen veränderte sich auch der Handel. Um die Korruption auszurotten, beschloss die Regierung, die bisher verwendeten Steuerzahlungen durch Verbrauchsteuermarken auf Alkohol und Tabak zu ersetzen. Der Weinbau, dessen Einkommen traditionell den Löwenanteil des Staatshaushalts ausmachte, wurde abgeschafft. Von nun an konnten Verbrauchsteuern bei speziellen Verbrauchsteuerämtern bezogen werden. Die Währungsreform von 1862 verzögerte sich, weil der Staat nicht über genügend Gold und Silber verfügte, um Papiergeld umzutauschen. Es wurde erst 1895-97 umgesetzt. unter der Leitung von Sergei Witte.
Die Modernisierung hat das staatliche Finanzsystem radikal umgestaltet und es offener und effizienter gemacht. Eine strikte Buchhaltung des Staatshaushalts brachte die Wirtschaft auf einen neuen Entwicklungspfad, die Korruption nahm ab, die Staatskasse wurde für wichtige Posten und Ereignisse ausgegeben und die Beamten wurden stärker für die Verwaltung des Geldes verantwortlich. Dank des neuen Systems konnte der Staat die Krise überwinden und die negativen Folgen der Bauernreform abmildern.
Universitätsreform.
Im Jahr 1863 wurde die Universitätsurkunde verabschiedet. Die neue Satzung gab den Universitäten mehr Unabhängigkeit in Fragen der internen Verwaltung und erweiterte die Möglichkeit, die örtlichen Gegebenheiten ihrer Entwicklung zu berücksichtigen, schuf günstigere Bedingungen für wissenschaftliche und pädagogische Aktivitäten, erhöhte die Attraktivität der Lehrtätigkeit an Universitäten für junge Menschen und trug dazu bei die Schaffung einer ausreichenden Anzahl qualifizierter Universitätslehrkräfte und sah auch eine Reihe besonderer Maßnahmen vor, um die Studierenden zur Beherrschung der Naturwissenschaften zu ermutigen. Der Treuhänder des Bildungsbezirks war nur für die Überwachung der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen des Universitätsrates verantwortlich. An der Universität studierende Studierende hatten keinen Anspruch auf eine korporative Struktur und Außenstehende durften überhaupt keine Vorlesungen besuchen.
Militärreform.
In den Jahren 1860-1870 wurde eine Militärreform durchgeführt. Die wichtigsten Bestimmungen der Reformen wurden vom Kriegsminister D. A. Milyutin entwickelt. Die Ergebnisse der Reform waren:
- Reduzierung der Armeegröße um 40 %;
- die Schaffung eines Netzwerks von Militär- und Kadettenschulen, das Vertreter aller Klassen aufnahm;
- Verbesserung des militärischen Führungs- und Kontrollsystems, Einführung von Militärbezirken, Schaffung des Generalstabs;
- die Schaffung öffentlicher und kontradiktorischer Militärgerichte und einer Militärstaatsanwaltschaft;
- Abschaffung der körperlichen Züchtigung (mit Ausnahme der Prügelstrafe für besonders „Geldstrafen“) in der Armee;
- Aufrüstung von Heer und Marine (Einführung von gezogenen Stahlgeschützen, neuen Gewehren usw.), Wiederaufbau staatlicher Militärfabriken;
- die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahr 1874 anstelle der Wehrpflicht und eine Kürzung der Dienstzeit. Nach dem neuen Gesetz werden alle Jugendlichen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, eingezogen, die Regierung legt jedoch jedes Jahr die erforderliche Anzahl an Rekruten fest und entnimmt den Wehrpflichtigen per Los nur diese Zahl, in der Regel jedoch nicht mehr als 20 bis 25 % der Wehrpflichtigen wurden zum Dienst einberufen. Der einzige Sohn seiner Eltern, der einzige Ernährer der Familie und auch der Fall, dass der ältere Bruder des Wehrpflichtigen im Dienst ist oder war, unterliegen nicht der Wehrpflicht. Darin sind die zum Dienst rekrutierten Personen aufgeführt: 15 Jahre bei den Bodentruppen – 6 Jahre in den Reihen und 9 Jahre in der Reserve, in der Marine – 7 Jahre im aktiven Dienst und 3 Jahre in der Reserve. Für Absolventen der Grundschule verkürzt sich die aktive Dienstzeit auf 4 Jahre, für Absolventen einer städtischen Schule auf 3 Jahre, eines Gymnasiums auf eineinhalb Jahre und für Absolventen eines Hochschulbildung - bis zu sechs Monate.
- Entwicklung und Einführung neuer Militärgesetze in der Truppe.
Es wurde eine Stadtreform durchgeführt. Es diente als Impuls für die kommerzielle und industrielle Entwicklung der Städte und festigte das System der städtischen öffentlichen Verwaltungen. Eines der Ergebnisse der Reformen Alexanders II. war die Einbeziehung der Gesellschaft in das bürgerliche Leben. Der Grundstein für eine neue russische politische Kultur wurde gelegt.
Sowie die Justizreform, die das Justizsystem und die Gerichtsverfahren umfassend reformierte, und die Zemstvo-Reform, die die Schaffung eines Systems der kommunalen Selbstverwaltung in ländlichen Gebieten – Zemstvo-Institutionen – vorsah.
Außenpolitik.
Während der Herrschaft Alexanders II. expandierte das Russische Reich. In dieser Zeit wurden Zentralasien (1865–1881 wurde der größte Teil Turkestans Teil Russlands), der Nordkaukasus, der Ferne Osten, Bessarabien und Batumi an Russland annektiert. Dank Fürst Alexander Gortschakow stellte Russland seine Rechte im Schwarzen Meer wieder her und erreichte die Aufhebung des Verbots, seine Flotte dort zu behalten. Die Bedeutung der Annexion neuer Gebiete, insbesondere Zentralasiens, war einem Teil der russischen Gesellschaft unklar. Saltykov-Shchedrin kritisierte das Verhalten von Generälen und Beamten, die den Zentralasienkrieg zur persönlichen Bereicherung nutzten, und M. N. Pokrovsky wies auf die Sinnlosigkeit der Eroberung Zentralasiens für Russland hin. Diese Eroberungen führten zu großen menschlichen Verlusten und materiellen Kosten.
Im Jahr 1867 wurde Russisch-Amerika (Alaska) für 7,2 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten verkauft. Im Jahr 1875 wurde in St. Petersburg ein Abkommen geschlossen, wonach alle Kurilen im Austausch gegen Sachalin an Japan übergeben wurden. Sowohl Alaska als auch die Kurilen waren abgelegene Überseegebiete, die aus wirtschaftlicher Sicht unrentabel waren. Außerdem waren sie schwer zu verteidigen. Die Konzession für zwanzig Jahre sicherte die Neutralität der Vereinigten Staaten und des Kaiserreichs Japan gegenüber den russischen Aktionen im Fernen Osten und ermöglichte die Freisetzung der notwendigen Kräfte zur Sicherung bewohnbarerer Gebiete.
Im Jahr 1858 schloss Russland den Aigun-Vertrag mit China und im Jahr 1860 den Peking-Vertrag, nach dem es weite Gebiete Transbaikaliens, des Chabarowsk-Territoriums und eines bedeutenden Teils der Mandschurei, einschließlich Primorje (Ussuri-Territorium), erhielt.
Attentate und Tod Alexanders II.
Es kam zu mehreren Attentaten auf Alexander II. Am 16. April 1866 verübte der russische Revolutionär Karakosow sein erstes Attentat. Als Alexander II. vom Tor des Sommergartens zu seiner Kutsche ging, war ein Schuss zu hören. Die Kugel flog über den Kopf des Kaisers hinweg und der Schütze wurde von dem in der Nähe stehenden Bauern Osip Komissarov gestoßen, der dem Kaiser das Leben rettete.
Am 25. Mai 1867 verübte der polnische Emigrant Anton Beresowski in Paris ein Attentat. Die Kugel traf das Pferd. 14. April 1879 in St. Petersburg. Der russische Revolutionär Solovyov feuerte 5 Schüsse aus einem Revolver ab.
Am 1. Dezember 1879 gab es einen Versuch, einen Kaiserzug in der Nähe von Moskau in die Luft zu jagen. Der Kaiser wurde dadurch gerettet, dass in Charkow eine Dampflokomotive ausfiel, die eine halbe Stunde früher fuhr als die des Zaren. Der König wollte nicht auf die Reparatur der kaputten Lokomotive warten und der königliche Zug fuhr zuerst. Ohne diesen Umstand zu kennen, verpassten die Terroristen den ersten Zug und zündeten eine Mine unter dem vierten Waggon des zweiten.
Am 17. Februar 1880 verübte Chalturin im ersten Stock des Winterpalastes eine Explosion. Der Kaiser aß im dritten Stock zu Mittag; er wurde dadurch gerettet, dass er später als die festgelegte Zeit eintraf und 11 Wachen im zweiten Stock starben.
Am 13. März 1881 ereignete sich ein tödliches Attentat. Der Zarenzug bog von der Inzhenernaya-Straße auf den Damm in Richtung Theaterbrücke ab, Rysakov warf eine Bombe unter die Pferde der Kaiserkutsche. Durch die Explosion wurden die Wachen und einige Menschen in der Nähe verletzt, der Kaiser selbst blieb jedoch unverletzt. Die Person, die das Projektil geworfen hatte, wurde festgenommen.
Lebenskutscher Sergeev, Hauptmann Kulebyakin und Oberst Dvorzhitsky forderten den Kaiser auf, den Schauplatz des Attentats so schnell wie möglich zu verlassen, aber Alexander hatte das Gefühl, dass die militärische Würde von ihm verlangte, die verwundeten Tscherkessen, die ihn bewachten, anzusehen und ein paar Worte zu ihnen zu sagen . Danach näherte er sich dem inhaftierten Rysakov und fragte ihn nach etwas, ging dann zurück zum Ort der Explosion, und dann warf Grinevitsky, der am Kanalgitter stand und von den Wachen unbemerkt blieb, eine in eine Serviette gewickelte Bombe vor die Füße des Kaisers.
Die Druckwelle warf Alexander II. zu Boden, Blut strömte aus seinen zerschmetterten Beinen. Der gefallene Kaiser flüsterte: „Trage mich zum Palast ... dorthin ... um zu sterben ...“ Auf Befehl des Großfürsten Michail Nikolajewitsch, der aus dem Michailowski-Palast eingetroffen war, wurde der blutende Kaiser in den Winterpalast gebracht.
Der Kaiser wurde auf seinen Armen getragen und auf das Bett gelegt. Als der Lebensarzt Botkin vom Erben gefragt wurde, wie lange der Kaiser leben würde, antwortete er: „Von 10 bis 15 Minuten.“ Um 15:35 Uhr wurde die kaiserliche Standarte vom Fahnenmast des Winterpalastes gesenkt, um die Bevölkerung von St. Petersburg über den Tod von Kaiser Alexander II. zu informieren.
Kaiser Alexander II. auf seinem Sterbebett. Foto von S. Levitsky.