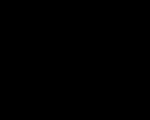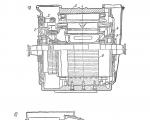Das Leben der alten Bauern. Bauernleben: Wohn- und Nebengebäude
Altes Blockhaus mit Schindeln gedeckt Mazanka, Stadtrand
Auch die Lebensweise der Bauern veränderte sich nur sehr langsam. Der Arbeitstag begann noch früh: im Sommer mit Sonnenaufgang und im Winter lange vor Sonnenaufgang. Grundlage des ländlichen Lebens war der bäuerliche Haushalt, der (bis auf wenige Ausnahmen) aus einer Großfamilie bestand, in der die Eltern mit verheirateten und unverheirateten Söhnen und unverheirateten Töchtern unter einem Dach lebten.
Je größer der Hof, desto einfacher war es für ihn, den kurzen Zeitraum von vier bis sechs Monaten zu bewältigen, der aufgrund der Beschaffenheit der Mittelzone für die Feldarbeit vorgesehen war. Ein solcher Hof beherbergte mehr Vieh und konnte mehr Land bewirtschaften. Der Zusammenhalt der Wirtschaft basierte auf gemeinsamer Arbeit unter der Führung des Familienoberhauptes.
Bauerngebäude bestanden aus einer kleinen und niedrigen Holzhütte (gemeinhin „Hütten“ genannt), einer Scheune, einem Viehstall, einem Keller, einer Tenne und einem Badehaus. Letzteres hatte nicht jeder. Badehäuser wurden oft abwechselnd mit den Nachbarn beheizt.
Die Hütten bestanden aus Baumstämmen, in Waldgebieten waren die Dächer mit Schindeln gedeckt, in den übrigen Gebieten häufiger mit Stroh, was häufig zu Bränden führte. An diesen Orten waren sie verheerend, da die Bauern keine Gärten oder Bäume um ihre Häuser hatten, wie in den südlichen Regionen der Provinz Tschernigow. Daher breitete sich das Feuer schnell von Gebäude zu Gebäude aus.
In den Bezirken der Region Brjansk, die damals zur Provinz Tschernigow gehörte, konnte man Lehmhütten finden – einen für Kleinrussland charakteristischen Haustyp. Sie hatten ein Rohr, aber keinen Boden. Die Wände eines solchen Hauses bestanden aus einem Holzrahmen (dünne Zweige) oder Lehmziegeln und waren außen und innen mit Lehm beschichtet und anschließend mit Kalk bedeckt.
Während des gesamten 19. Jahrhunderts fehlten in den meisten Bauernhäusern weiterhin Öfen mit Schornsteinen. Es lag nicht nur und nicht einmal so sehr an der Komplexität ihrer Herstellung.

S. Winogradow. In der Hütte.

A.G. Venetsianov. Scheunenboden
Viele Bauern waren davon überzeugt, dass eine „schwarze“ oder Hühnerhütte (ohne Schornstein) trockener sei als eine weiße (mit Schornstein). In der „schwarzen“ Hütte wurde oben ein Fenster eingeschnitten, um den Rauchabzug zu ermöglichen. Außerdem wurde beim Anzünden des Ofens eine Tür oder ein Fenster geöffnet. Der Zustrom frischer Luft klärte die Atmosphäre der beengten Behausung, in der sich nicht nur eine große Bauernfamilie, sondern oft auch ein Kalb oder Lämmer befanden, die nach der Geburt noch einige Zeit warm gehalten werden mussten. Allerdings waren die Wände solcher Hütten und die Kleidung der Menschen ständig mit Ruß bedeckt.
Die Innenausstattung der Hütte war nicht sehr vielfältig. Gegenüber der Tür stand in einer Ecke ein Herd, in der anderen eine Truhe oder Kiste, über der sich Regale mit Geschirr befanden. Aufgrund der hohen Kosten wurde der Ofen selten aus Ziegeln hergestellt. Häufiger wurde es aus Ton hergestellt, wobei ein Gewölbe auf Holzreifen entstand, die nach dem Trocknen verbrannt wurden. Lediglich auf der Dachfläche wurden mehrere Dutzend gebrannte Ziegelsteine zur Verlegung des Rohres verwendet.
In der östlichen Ecke gegenüber dem Ofen befinden sich Bilder und ein Tisch. Entlang der Wand wurde aus dem Ofen eine Plattform gebaut, die anstelle eines Bettes diente, und an den restlichen Wänden befanden sich Bänke. Der Boden bestand selten aus Brettern, sondern häufiger aus Lehm. Der Ofen, mit oder ohne Schornstein, war so gebaut, dass immer ein warmer Platz vorhanden war, an dem mehrere Personen Platz fanden. Dies war notwendig, um Kleidung zu trocknen und Menschen zu wärmen, die den ganzen Tag in der Kälte und im Matsch verbringen mussten.
Allerdings versammelten sich alle Familienmitglieder nur in der kältesten Winterzeit in der Hütte. Im Sommer übernachteten die Männer mit Pferden auf dem Feld, im Herbst, bis es zu starker Kälte kam, während des Dreschens weiter, auf der Tenne unter der Scheune.
Neben der Hütte gab es auf dem Bauernhof unbeheizte Käfige oder Scheunen. Hier wurden Stoffe, Kleidung und Wolle gelagert; selbstdrehende Räder sowie Lebensmittel und Brot. Vor dem Einsetzen der Winterkälte lebten hier verheiratete Familienmitglieder oder unverheiratete Töchter. Die Anzahl der Käfige hing vom Wohlstand und der Anwesenheit junger Familien ab. Viele Bauern lagerten trockenes Getreide und Kartoffeln in speziellen Erdgruben.


Ställe oder Ställe für Vieh wurden meist ohne hohen Materialaufwand gebaut: aus dünnen Baumstämmen und sogar in Form eines Zauns mit vielen Löchern. Entlang der Mauer wurde Viehfutter ausgelegt, das gleichzeitig als Einstreu diente. Schweine wurden selten in getrennten Räumen gehalten und liefen einfach im Hof umher; Hühner wurden im Flur, auf dem Dachboden und in Hütten gehalten. Wasservögel, Enten und Gänse wurden häufiger in den Dörfern und Dörfern gezüchtet, die in der Nähe von Seen und Flüssen lagen.
Bei der Ernährung begnügten sich die Bauern mit dem, was auf dem eigenen Hof produziert wurde. An Wochentagen wurde das Essen mit Schmalz oder Milch gewürzt, und an Feiertagen gab es Schinken oder Wurst, Huhn, Schwein oder Lamm. Zur Herstellung von Brot wurde dem Mehl Spreu zugesetzt. Im Frühling aßen viele Bauern Sauerampfer und anderes Gemüse, kochten sie in Rübenlake oder würzten sie mit Kwas. Aus Mehl wurde eine Suppe namens „Kulesh“ zubereitet. Damals backten nur wohlhabende Bauern Brot.
Der Beschreibung zufolge wurde Bauernkleidung auch noch zu Hause hergestellt. Für Männer besteht der Hauptteil aus einem Zipun (Kaftan) aus selbstgemachtem Stoff bis zu den Knien, einem Hemd aus selbstgemachtem Stoff, Filzkappen auf dem Kopf und im Winter aus Lammfellmützen mit Ohren und einem Stoffoberteil.
Damenbekleidung bestand aus dem gleichen Material, unterschied sich jedoch durch einen besonderen Schnitt. Wenn sie nach draußen gingen, zogen sie eine weite Stoffjacke (Schriftrolle) an, unter der im Winter ein Pelzmantel getragen wurde. Schriftrollen waren überwiegend weiß. Frauen trugen auch Poneva, also ein Stück farbigen Wollstoff mit einer Leinenschürze. Lang Pelzmäntel waren selten. An gewöhnlichen Tagen wurde der Kopf mit einem Segeltuchschal gebunden, an Feiertagen mit einem farbigen.
Es ist schwer vorstellbar, dass diese Fotos vor etwa 150 Jahren aufgenommen wurden. Und man kann sie endlos betrachten, denn Feinheiten können, wie man so schön sagt, nur im Detail betrachtet werden. Und es gibt noch viele weitere interessante Dinge zu beachten. Diese Fotos sind eine einzigartige Gelegenheit, in die Vergangenheit einzutauchen.
1. Anwohner

Die Bauern stellten im Russischen Reich Ende des 19. Jahrhunderts die Mehrheit der Bevölkerung. Wenn man darüber spricht, wie die Bauern im vorrevolutionären Russland lebten, kann man nicht übersehen, dass sich die Historiker in dieser wichtigen Frage noch immer nicht einig sind. Einige glauben, dass ausnahmslos alle „wie Käse in Butter“ fuhren, während andere von allgemeinem Analphabetismus und Armut sprechen.
2. Brennholz ernten

Der bekannte französische Ökonom Edmond Théry sagte: „...Wenn die großen europäischen Nationen zwischen 1912 und 1950 den gleichen Weg gehen wie zwischen 1910 und 1912, dann wird Russland bis zur Mitte dieses Jahrhunderts Europa dominieren.“ politisch, wirtschaftlich und finanziell.“
3. Häuser wohlhabender Bauern

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Bauern in zwei Hauptklassengemeinschaften aufgeteilt – Grundbesitzer und Staatsgemeinschaften. Die größte Kategorie der Bauernschaft bildeten die Gutsbesitzer. Der Grundbesitzer hatte die vollständige Kontrolle über das Leben eines einfachen Bauern. Sie wurden frei gekauft und verkauft, geschlagen und bestraft. Die Leibeigenschaft untergrub die Produktivkräfte der bäuerlichen Wirtschaft. Die Leibeigenen hatten kein Interesse daran, gute Arbeit zu leisten. Daher entwickelten sich im Land weder Industrie noch Landwirtschaft.
4. Bauernhof

Die russischen Bauern waren eine völlig getrennte Klasse von Grundbesitzern und Adligen. Die meisten Bauern waren tatsächlich Leibeigene – Menschen, die bis zur Reform von 1861 rechtlich ihren Herren gehörten. Als erste große liberale Reform in Russland befreite sie die Leibeigenen, erlaubte ihnen, zu heiraten, ohne die Erlaubnis ihrer Herren zu benötigen, und erlaubte ihnen, Eigentum und Eigentum zu besitzen.
5. Beschaffung von Brennholz durch Landbewohner

Das Leben der Bauern blieb jedoch weiterhin schwierig. Sie bestritten ihren Lebensunterhalt durch Arbeit auf dem Feld oder in ungelernten Berufen und verdienten weniger als den Durchschnittslohn.
6. Indigene Völker

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts stellten die Probleme des Landaufkaufs für etwa 35 % der Bauern immer noch eine schwere Belastung dar. Kredite vergab die Bank nur an Bauern, wenn sie Land von Grundbesitzern kauften. Gleichzeitig waren die Grundstückspreise der Bank doppelt so hoch wie der durchschnittliche Marktpreis.
7. Camping

Die Rücknahme von Grundstücken durch Bauern mit Hilfe der Staatskasse wurde dadurch erheblich erleichtert, dass die meisten Leibeigenen vor der Reform Hypotheken bei staatlichen Hypothekenbanken verpfändet hatten.
8. Russland, 1870er Jahre

Um zu verstehen, wie die russischen Bauern zu Beginn des letzten Jahrhunderts lebten, wenden wir uns den Klassikern zu. Lassen Sie uns die Aussage einer Person präsentieren, der man kaum Unzulänglichkeit oder Unehrlichkeit vorwerfen kann. So beschrieb der Klassiker der russischen Literatur Tolstoi seine Reise in russische Dörfer in verschiedenen Bezirken Ende des 19. Jahrhunderts:
9. Freundliche Familie

„Je weiter man in den Bogoroditsky-Bezirk vordringt und je näher man Efremovsky kommt, desto schlimmer wird die Situation... Auf den besten Böden wurde fast nichts geboren, nur Samen kamen zurück. Fast jeder hat Brot mit Quinoa. Der Quinoa ist hier unreif und grün. Der weiße Kern, der normalerweise darin zu finden ist, ist überhaupt nicht vorhanden und daher nicht essbar. Quinoa-Brot allein kann man nicht essen. Wenn Sie auf nüchternen Magen nur Brot essen, müssen Sie sich übergeben. Kwas aus Mehl und Quinoa macht die Leute verrückt.“
10. Bauern in Trachten

Im Allgemeinen wurde die Lebensweise und das tägliche Leben der Bauern durch den Entwicklungsstand der Wirtschaft und den Grad ihrer Ausbeutung bestimmt. Die meisten Forscher sind sich einig, dass das bäuerliche Leben im Mittelalter am Rande einer Hungersnot stand. Daher – Armut, das Vorhandensein nur der notwendigsten Dinge. Behausungen, Lebensmittel, Kleidung und Utensilien waren einfach und wurden meist durch eigene Arbeit geschaffen; wenig gekauft.
Das Dorf blieb die vorherrschende bäuerliche Siedlungsform. Selbst dort, wo Siedlungen und Gehöfte üblich waren, tendierten sie zu einer größeren Siedlung als Verwaltungs-, Religions- und Wirtschaftszentrum. Hier wurden Gemeinschafts- und Patrimonialangelegenheiten erledigt, es gab eine Kirche und oft einen Marktplatz, auf den die Quitrenten gebracht wurden. In den Dörfern lebten normalerweise nicht mehr als 200–400 Menschen. Ein Anwesen, ein Bauernhof, war ein komplexer Komplex, der ein Haus und andere Gebäude, einen Garten, einen Gemüsegarten und kleine Grundstücke umfasste. Gleichzeitig wurde die Arbeitstätigkeit eines Bauern, selbst eines Leibeigenen, in seinem Hof von niemandem reguliert.
Wirtschaftswachstum des 12.-13. Jahrhunderts. spiegelte sich auch im ländlichen Wohnungsbau wider. Überall werden die ehemaligen Unterstande und Halbunterstande durch oberirdische Häuser ersetzt. Es herrschten sogenannte Einkammerhäuser (ein Wohnzimmer mit Ofen und ein kalter Vorraum) vor. Aufgrund des Mangels an Bauholz in Westeuropa wurden die Wände der Häuser aus Holzrahmen gebaut, die mit Bruchsteinen und Lehm gefüllt waren. Die Fundamente stammen jedoch aus dem 12. Jahrhundert. waren bereits überall aus Stein. Sie bedeckten die Dächer der Häuser mit Stroh, Schilf und Schindeln. Nur reiche Bauern konnten sich Zweizimmerhäuser leisten, die komplett aus Stein gebaut waren. Der Holzmangel im Westen wurde nach den „großen Rodungen“ besonders akut. Aber auch für Brennholz wurde der Wald benötigt. In den Häusern gab es oft keine Fenster und kleine Öffnungen wurden bei kaltem Wetter mit Stroh verschlossen. Die Reichen hatten Öfen mit Schornsteinen, während der Rest sich mit der Rauchmethode zum Heizen zufrieden gab. Sie kochten Essen und wärmten sich am Feuer.
Dorfgebiete waren meist mit Zäunen umgeben, vor allem um das Vieh vor Raubtieren zu schützen. Es war nur den Feudalherren vorbehalten, stärkere Befestigungsanlagen zu errichten.
Über den sanitären Zustand mittelalterlicher Dörfer liegen nur wenige Daten vor. Knochenkämme sind die am häufigsten verwendeten persönlichen Hygieneartikel. Sie konnten sich mit kleinen, dünnen Messern mit stumpfen Enden rasieren. Geschirr mit angebranntem Essen wurde meist weggeworfen, denn Steingut wurde in fast jedem Dorf hergestellt und war ebenso zerbrechlich wie billig. Alle von Archäologen erforschten Siedlungen sind buchstäblich mit Trümmern übersät.
In der Ernährung der Bauern dominierten Gemüse (vor allem Hülsenfrüchte und Kohl), wilde Früchte und Wurzeln, gekochtes Getreide und Fisch. Die Schwierigkeiten beim Dreschen des Getreides, die geringe Anzahl von Mühlen und Brotöfen sowie Plattitüden über deren Verwendung bestimmten die Seltenheit von Brot und die Vorherrschaft von Brei und Eintöpfen in der Ernährung der Bauern. Den Kranken wurde Brot, insbesondere Weißbrot, gegeben. Fleisch wurde nur an Feiertagen gegessen. Die Ernährung wurde auch durch kirchliche Rituale, Fasten und Feiertage beeinflusst, an denen es üblich war, Fleisch zu essen. Jagd und Fischerei wurden durch feudale Verbote eingeschränkt. All dies machte die bäuerliche Speisekarte sehr eintönig und begrenzt.
Eine Bauernfamilie bestand in der Regel aus Eltern mit unverheirateten Kindern und zählte 4-5 Personen. Die Braut musste eine Mitgift mitbringen (normalerweise handelte es sich um bewegliches Eigentum: Kleidung, Bettwäsche, Haushaltsgegenstände oder Geld). Auch der Bräutigam machte ein Geschenk (abhängig von der Größe seines Besitzes bzw. der Mitgift der Braut). Aber normalerweise machte er dieses Geschenk als Ehemann, also am Morgen nach der Hochzeit (das sogenannte „Morgengeschenk“). Die Frau stand in der Regel unter dem Schutz ihres Mannes, der auch körperliche Züchtigung („nicht bis zum Blut“) anwenden konnte. Noch größer war seine Macht über Kinder. Vermögenstransaktionen wurden mit Zustimmung beider Ehegatten durchgeführt. Die Arbeit machte Mann und Frau im Dorf gleich. Beim Pflügen wurde der Pflug von einem erwachsenen Mann gehalten und geführt, während Jugendliche die Zugtiere trieben und den Pflug reinigten. Männer wurden auch mit der Pflege von Zugtieren betraut. Der Rest des Hauses wurde von Frauen betreut, obwohl das Gemeinschaftsvieh normalerweise von Männern gehütet wurde. Frauen waren häufiger an der Ernte und Männer häufiger am Mähen beteiligt. Männer und Frauen dreschten gemeinsam die Ernte. Nach den Miniaturen des 13.-14. Jahrhunderts zu urteilen, beteiligten sich Frauen auch an der Entwurzelung von Baumstümpfen während der Rodung.
Die Kommunikation der Dorfbewohner mit der Außenwelt war begrenzt. Das Leben war geschlossen und patriarchalisch. Alle Interessen der Bauern konzentrierten sich auf ihr Heimatdorf und waren durch Beziehungen zu ihren Nachbarn, ihren eigenen und benachbarten Herren, verbunden. Der feudale Brauch verbot den Bauern das Tragen von Waffen. Aus demselben Grund waren bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Bauern verboten. Auch das Verhalten der Bauern wurde durch die Dualität ihrer Stellung beeinflusst. Einerseits waren sie sowohl vom Feudalherrn – dem Eigentümer des Landes – als auch von den Gemeinschaftsvorschriften abhängig. Darüber hinaus dienten diese Vorschriften als eine Art Garantie für die Stabilität der bäuerlichen Betriebe. Andererseits besaßen die Bauern Grundstücke und betrieben Einzelhöfe. Und nach und nach geraten ihre Privatinteressen nicht nur in Konflikt mit den Interessen ihrer Herren, sondern auch mit der Autorität der Gemeinden.
Ein wichtiges Element im sozialen und spirituellen Leben der Bauernschaft waren die Kirche und der Pfarrer. Die örtliche Pfarrkirche war das soziale Zentrum im Dorf; verschiedene Bruderschaften wurden nicht nur für religiöse Zwecke, sondern auch für die Reparatur von Straßen, den Schutz von Feldern usw. gegründet. Vor der aktiven inneren Kolonisierung und der Stärkung der Beziehungen zu den städtischen Märkten im 11.-13. Jahrhundert. Der Pfarrer war der wichtigste Berater und Autorität unter den Bauern.
Einführung
Die Erholung des Mittelalters trug dazu bei, zu erkennen, dass die Natur ein Lebensraum und Lebensunterhalt für die Bauern war, sie bestimmte ihre Lebensweise und Berufe und unter ihrem Einfluss entwickelten sich die Kultur und Traditionen des russischen Volkes. Im bäuerlichen Umfeld entstanden russische Folklore, Märchen, Rätsel, Sprichwörter, Sprüche und Lieder, die verschiedene Aspekte des bäuerlichen Lebens widerspiegelten: Arbeit, Freizeit, Familie, Traditionen.
Bauernleben
Arbeit, Arbeitsethik. Kollektivismus und gegenseitige Hilfeleistung, gegenseitige Verantwortung, Ausgleichsprinzip. Rhythmen des bäuerlichen Lebens. Die Fülle an Feiertagen in der traditionellen Volkskultur. Eine Kombination aus Alltag und Urlaub. Alltag, Urlaubsleben. Patriarchalischer Charakter des bäuerlichen Lebens. Arten der Kreativität im bäuerlichen Leben, Positionen der Selbstverwirklichung und Selbstbedienung. Soziales Ideal. Volksfrömmigkeit, Axiologie der Bauernwelt. Rangfolge des Alltagslebens nach Bevölkerungs- und Besitzmerkmalen. Mit der Annahme des Christentums wurden besonders verehrte Tage des Kirchenkalenders zu offiziellen Feiertagen: Weihnachten, Ostern, Verkündigung, Dreifaltigkeit und andere sowie der siebte Tag der Woche – der Sonntag. Nach kirchlichen Regeln sollten Feiertage frommen Taten und religiösen Ritualen gewidmet sein. An Feiertagen zu arbeiten galt als Sünde. Allerdings arbeiteten die Armen auch an Feiertagen
Bauerngemeinschaft; Gemeinschaft und Familie; Leben „auf der Welt“
Im 17. Jahrhundert bestand eine Bauernfamilie meist aus nicht mehr als 10 Personen.
Das waren Eltern und Kinder. Das Familienoberhaupt galt als ältester Mann.
Nach kirchlichen Vorschriften war es Mädchen unter 12 Jahren, Jungen unter 15 Jahren und Blutsverwandten verboten, zu heiraten.
Die Ehe konnte höchstens dreimal geschlossen werden. Gleichzeitig galt aber auch eine zweite Ehe als große Sünde, für die kirchliche Strafen verhängt wurden.
Seit dem 17. Jahrhundert mussten Ehen von der Kirche gesegnet werden. Hochzeiten werden meist im Herbst und Winter gefeiert – wenn keine landwirtschaftlichen Arbeiten anfallen.
Ein neugeborenes Kind musste am achten Tag nach der Taufe im Namen des Heiligen dieses Tages in der Kirche getauft werden. Der Ritus der Taufe galt in der Kirche als grundlegender, lebenswichtiger Ritus. Die Ungetauften hatten keine Rechte, nicht einmal das Recht auf ein Begräbnis. Die Kirche verbot die Beerdigung eines ungetauften Kindes auf einem Friedhof. Der nächste Ritus – „Tonsur“ – wurde ein Jahr nach der Taufe durchgeführt. An diesem Tag schnitten der Pate oder die Patin dem Kind eine Haarsträhne ab und gaben ihm einen Rubel. Nach dem Haarschnitt feierten sie den Namenstag, also den Tag des Heiligen, zu dessen Ehren die Person benannt wurde (später wurde er als „Tag des Engels“ bekannt), und den Geburtstag. Der Namenstag des Zaren galt als offizieller Feiertag.
Bauernhof
Der Bauernhof umfasste normalerweise: eine mit Schindeln oder Stroh bedeckte, „schwarz“ beheizte Hütte; ein Käfig zur Aufbewahrung von Eigentum; Viehstall, Scheune. Im Winter hielten die Bauern (Ferkel, Kälber, Lämmer) in ihren Hütten. Geflügel (Hühner, Gänse, Enten). Durch das schwarze Feuer der Hütte waren die Innenwände der Häuser stark verraucht. Zur Beleuchtung diente eine Taschenlampe, die in die Ofenspalten eingeführt wurde.
Die Bauernhütte war ziemlich dürftig und bestand aus einfachen Tischen und Bänken, aber auch zum Schlafen, die an der Wand befestigt waren (sie dienten nicht nur zum Sitzen, sondern auch zum Schlafen). Im Winter schliefen die Bauern auf dem Herd.
Das Material für die Kleidung war selbstgesponnenes Segeltuch, Schaffelle (Schaffell) und bei der Jagd gefangene Tiere (normalerweise Wölfe und Bären). Bei den Schuhen handelte es sich überwiegend um Bastschuhe. Wohlhabende Bauern trugen Kolben (Kolben) – Schuhe aus einem oder zwei Lederstücken, die mit einem Riemen um den Knöchel gerafft wurden, und manchmal Stiefel.
Die Schicksale vieler Bauernfamilien waren einander ähnlich. Von Jahr zu Jahr lebten sie im selben Dorf und übten die gleichen Arbeiten und Pflichten aus. Die bescheidene Dorfkirche beeindruckte weder durch ihre Größe noch durch ihre Architektur, sondern machte das Dorf zum Mittelpunkt des gesamten Gebietes. Schon als Baby, ein paar Tage alt, fiel jeder Mensch bei der Taufe unter seine Gewölbe und besuchte ihn im Laufe seines Lebens viele Male. Nachdem sie in eine andere Welt gegangen waren, brachten sie ihn hierher, bevor sie ihn auf der Erde beerdigten. Die Kirche war fast das einzige öffentliche Gebäude in der Gegend. Der Priester war, wenn nicht der einzige, so doch einer der wenigen gebildeten Menschen. Egal wie die Gemeindemitglieder ihn behandelten, er war der offizielle geistliche Vater, zu dem das Gesetz Gottes jeden verpflichtete, zur Beichte zu kommen.
Drei Hauptereignisse im menschlichen Leben: Geburt, Heirat und Tod. So wurden die Aufzeichnungen in den Kirchenbüchern in drei Teile gegliedert. In dieser Zeit bekamen viele Familien fast jedes Jahr Kinder. Die Geburt eines Kindes wurde als Wille Gottes wahrgenommen, dem sich kaum jemand widersetzen konnte. Mehr Kinder bedeuten mehr Arbeitnehmer in der Familie und damit mehr Wohlstand. Aufgrund dessen wurde das Aussehen von Jungen bevorzugt. Du erziehst ein Mädchen, du erziehst sie, und sie geht zur Familie eines anderen. Aber das ist letztlich kein Problem: Bräute aus anderen Haushalten ersetzten die berufstätigen Hände der zur Seite abgegebenen Töchter. Deshalb war die Geburt eines Kindes schon immer ein Feiertag in der Familie und wurde deshalb von einem der wichtigsten christlichen Sakramente beleuchtet – der Taufe. Die Eltern trugen das Kind mit dem Paten und der Mutter zur Taufe. Der Priester las zusammen mit dem Paten ein Gebet, danach tauchte er das Baby in das Taufbecken und befestigte ein Kreuz. Als sie nach Hause zurückkehrten, veranstalteten sie eine Taufe – ein Abendessen, zu dem sie Verwandte versammelten. Kinder wurden normalerweise an ihrem Geburtstag oder innerhalb von drei Tagen getauft. Am häufigsten gab der Priester den Namen an und nutzte dabei den Kalender zu Ehren des Heiligen, an dessen Tag das Baby geboren wurde. Die Regelung der Namensnennung nach dem Kalender war jedoch nicht zwingend. Paten waren meist Bauern aus ihrer Pfarrei.
Bauern heirateten meist nur in ihrer eigenen Gemeinde. Während im 18. Jahrhundert Bauern im Alter von 13 bis 14 Jahren heirateten, betrug das gesetzliche Heiratsalter ab Mitte des 19. Jahrhunderts 18 Jahre für Männer und 16 Jahre für Frauen. Frühe Bauernehen wurden von Grundbesitzern gefördert, da dies zu einer Erhöhung der Zahl der Bauernseelen und damit des Einkommens der Grundbesitzer beitrug. Während der Leibeigenschaft wurden Bauernmädchen oft ohne ihre Zustimmung verheiratet. Nach der Abschaffung der Leibeigenschaft etablierte sich nach und nach der Brauch der Eheschließung mit Zustimmung der Braut. Auch gegen minderjährige Bräutigame wurden strenge Maßnahmen ergriffen. Wenn jemand nicht heiraten wollte, dann zwang Papa ihn mit Pfeilen. Bräutigame und Bräute, die zu lange blieben, wurden entehrt.
Unter der ukrainischen Bauernschaft galt nicht die Hochzeit, sondern die Hochzeit als gesetzliche Ehegarantie: Verheiratete Paare konnten zwei bis drei Wochen lang getrennt leben, während sie auf die Hochzeit warteten. Vor allem stand „Laib“ – so wurden in der Ukraine sowohl das wichtigste rituelle Hochzeitsbrot als auch das Ritual seiner Zubereitung genannt, das am häufigsten am Freitag stattfand. Am Samstagabend verabschiedete sich die Landjugend von ihren Jugendlichen. Auf der Mädchenparty wurde ein Hochzeitsbaum gebastelt – „Giltse“, „Viltse“, „Rizka“, „Troika“. Dieser dicht blühende Baum ist ein Symbol für die Jugend und Schönheit der Jugend und wurde zur Dekoration von Brot oder Kalach verwendet. Es stand während der gesamten Hochzeit auf dem Tisch. Der Sonntag nahte. Am Morgen kleideten die Brautjungfern die Braut für die Hochzeit: das beste Hemd, einen bestickten Rock, Namisto, einen wunderschönen Kranz mit Bändern. Frauen bewahrten ihr Hochzeitshemd bis zu ihrem Tod als Reliquie auf. Der Sohn nahm das Hochzeitshemd seiner Mutter mit, als er in den Krieg zog. Auch der Bräutigam kam in einem bestickten Hemd (die Braut musste es besticken). Das Brautpaar wollte kirchlich heiraten. Danach kamen sie in den Hof der Braut, wo sie mit Brot und Salz begrüßt und mit Vieh bestreut wurden, und die Braut lud die Gäste an den Tisch ein. Der Hochzeit ging ein Matchmaking voraus. Es gab einen Brauch: Menschen, die zur Partnervermittlung gingen, wurden mit Ruten ausgepeitscht oder mit Frauenkopfbedeckungen beworfen, um den Erfolg des Geschäfts sicherzustellen und das Mädchen schnell zu umwerben. Der Morgen des Hochzeitstages war interessant, als sich die Braut wusch. Sie ging nicht alleine ins Badehaus. Wenn sich die Braut richtig gewaschen und gedämpft hat, fängt der Heiler den Schweiß der Braut mit einem Taschentuch auf und drückt ihn in eine Flasche. Dieser Schweiß wurde dann in das Bier des Bräutigams gegossen, um das junge Paar mit unauflöslichen Banden zu verbinden.
Bauernhochzeiten fanden normalerweise im Herbst oder Winter statt, wenn die Hauptarbeit in der Landwirtschaft endete. Aufgrund des schwierigen bäuerlichen Lebens und des frühen Todes kam es häufig zu Wiederverheiratungen. Nach Epidemien stieg die Zahl der Wiederverheiratungen stark an.
Der Tod überholte einen Menschen zu jeder Jahreszeit, aber in den kalten Wintermonaten nahm die Arbeit merklich zu. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Toten auf dem Friedhof der Kirche beigesetzt. Aufgrund der Gefahr der Ansteckung mit Infektionskrankheiten wurde jedoch per Sondererlass angeordnet, dass Friedhöfe außerhalb besiedelter Gebiete angelegt werden müssen. Die Menschen bereiteten sich im Voraus auf den Tod vor. Vor ihrem Tod versuchten sie, einen Priester zur Beichte und Kommunion zu rufen. Nach dem Tod wurde der Verstorbene von Frauen gewaschen und in Totenkleidung gekleidet. Die Männer bauten einen Sarg zusammen und gruben ein Grab. Als die Leiche herausgeholt wurde, begann das Wehklagen der Trauernden. Von einer Autopsie oder einer Sterbeurkunde war keine Rede. Alle Formalitäten beschränkten sich auf einen Eintrag im Standesbuch, in dem der örtliche Pfarrer die Todesursache unter Angabe der Angehörigen des Verstorbenen angab. Der Sarg mit dem Verstorbenen wurde auf einer Trage in die Kirche gebracht. Der Kirchenwächter, der bereits über den Verstorbenen Bescheid wusste, läutete. 40 Tage nach der Beerdigung gab es eine Totenwache mit Mittagessen, zu der der Priester zum Gottesdienst gebracht wurde.

Im Bezirk Poltawa wurden fast keine Blockhütten oder Unterstande gebaut, daher sollte die Lehmhütte als Vorbild einer örtlichen Hütte angesehen werden. Es basierte auf mehreren im Boden vergrabenen Eichenpflügen. In die Pflüge wurden Stangen geschnitten und Stroh oder Weinreben oder Kirschzweige daran gebunden. Die entstandene Hütte wurde mit Lehm bedeckt, Risse entfernt und die Wände geebnet, und ein Jahr später wurde sie mit speziellem, weißem Lehm bedeckt.

Die Wirtin und ihre Töchter reparierten die Wände der Hütte nach jedem Regensturm und tünchten die Außenseite dreimal im Jahr: für Trinity, Veils und als die Hütte für den Winter mit Stroh gegen die Kälte ausgestattet wurde. Die Häuser waren teilweise durch einen Wassergraben mit üppigen Wolfsbäumen, Eschen oder weißen Akazien eingezäunt, teilweise durch einen Zaun (tyn) am Tor, meist einflügelig, bestehend aus mehreren Längsstangen. In der Nähe der Straße wurde ein Viehstall (Povitka) gebaut. Im Hof, normalerweise in der Nähe der Hütte, wurde eine gehackte quadratische Komorya mit 3-4 Kerben oder Brotkästen gebaut. Auch kein einziger Hof kam ohne einen Klon aus, der sich meist in einiger Entfernung von der Hütte hinter der Tenne (Tenne) erhob. Die Höhe der Eingangstüren zur Hütte betrug normalerweise 2 Arschin und 6 Werschok, und die Innentüren waren 2 Werschok höher. Die Breite der Türen war schon immer Standard – 5 Viertel 2 Zoll. Die Tür war mit einem Holzhaken verschlossen und mit etwas dunkler Farbe gestrichen. Manchmal waren an den Fenstern der Hütte rot oder grün gestrichene Fensterläden angebracht.

Die Außentür führte in einen dunklen Vorraum, in dem normalerweise ein Kleidungsstück, ein Geschirr, Utensilien und eine Korbkiste für Brot untergebracht waren. Es gab auch eine leichte Treppe, die zum Dachboden führte. Außerdem gab es einen geräumigen Abzug, der den Rauch des Ofens durch den Schornstein auf das Dach leitete. Gegenüber dem Eingang befand sich ein weiteres, warmes Abteil, eine „Chatyna“ – ein Schutz für alte Menschen vor Staub, Frauen und Kinder. Zu großen Hütten gehörte auch ein besonderer Vorraum (svetlitsa). Die äußerste Ecke der Tür war vollständig von einem Ofen eingenommen, der manchmal ein Viertel der kleinen Hütte ausmachte. Der Ofen wurde aus Rohstoffen hergestellt. Es war mit Keilen, Kreisen, Kreuzen und Blumen verziert, die in Blau oder gewöhnlichem Ocker bemalt waren. Der Ofen wurde vor den Feiertagen gleichzeitig mit der Hütte gesalbt. Zwischen dem Ofen und der sogenannten kalten Ecke wurden mehrere Bretter entlang der Wand verlegt, damit die Familie nachts schlafen konnte. Oben nagelten sie ein Regal für Damensachen fest: Stiche, Splitter, Spindeln und hängten eine Stange für Kleidung und Garn auf. Auch die Wiege wurde hier aufgehängt. Oberbekleidung, Kissen und Bettzeug wurden in einer kalten Ecke zurückgelassen. Daher galt diese Ecke als Familienecke. Die nächste Ecke (kut), die sich zwischen zwei Eckfenstern und einem Seitenfenster befindet, wurde Pokuttyam genannt. Es entsprach der roten Ecke der Großrussen. Hier wurden auf speziellen Tafeln Ikonen des Vaters und der Mutter, dann des ältesten Sohnes, des mittleren und des jüngsten Sohnes angebracht. Sie wurden mit Papier oder natürlichen Trockenblumen dekoriert. Manchmal wurden Flaschen mit Weihwasser in die Nähe der Bilder gestellt und dahinter Geld und Dokumente versteckt. Es gab auch einen Tisch oder ein Versteck (Truhe). An den Wänden in der Nähe des Tisches befanden sich auch Bänke (Bänke) und Bänke. In der Gegenrichtung befand sich am blinden Ende der Tür eine blinde Ecke. Es hatte nur wirtschaftliche Bedeutung. Auf dem Regal standen Geschirr, Löffel und Messer. Der schmale Raum zwischen den Türen und dem Ofen wurde „Kocheryschnik“ genannt, weil er mit Schürhaken und Schaufeln besetzt war.


Die übliche Nahrung der Bauern war Brot, das sie selbst backten, Borschtsch, der „gesund und gut für alle“ ist, und Brei, am häufigsten Hirse. Das Essen wurde morgens und den ganzen Tag zubereitet. Sie verwendeten es wie folgt: um 7-8 Uhr morgens - Frühstück bestehend aus Kohl, Kuchen, Kulish oder Lachs mit Schmalz. An einem Fastentag wurde Schmalz durch Öl ersetzt, das als Gewürz für Gurken, Kohl, Kartoffeln diente, oder durch Hanfsamenmilch, die zum Würzen von Ei-Kutya, gekochter Gerste, zerkleinerter Hirse oder Hanfsamen bei Buchweizenkuchen verwendet wurde.

Sie setzten sich ab 11 Uhr zum Mittagessen zusammen und auch später, wenn Dreschen oder andere Arbeiten es verzögerten. Das Mittagessen bestand aus Borschtsch mit Schmalz und Brei mit Butter, seltener mit Milch, und an Fastentagen aus Borschtsch mit Bohnen, Rüben, Butter und Brei, manchmal gekochten Bohnen und Erbsen, Knödel mit Kartoffeln, Kuchen mit Erbsen, gesalbt mit Honig.

Zum Abendessen begnügten wir uns mit Resten vom Mittagessen, bzw. Fischsuppe (Fischsuppe) und Knödeln. Hähnchen oder Hähnchenfleisch standen nur an wichtigen Feiertagen auf dem Speiseplan. Gegen Ende des Sommers, als die meisten Gemüse- und Obstsorten reif waren, besserte sich die Tabelle ein wenig. Anstelle von Brei kochten sie oft Kürbis, Erbsen, Bohnen und Mais. Für den Nachmittagssnack wurden dem Brot Gurken, Pflaumen, Melonen, Wassermelonen und Waldbirnen hinzugefügt. Ab dem 1. September, als die Tage kürzer wurden, wurde der Nachmittagstee gestrichen. Die Getränke, die sie tranken, waren hauptsächlich Kwas und Uzvar. Aus Alkohol - Wodka (Wodka).
Die Kleidung der Kleinrussen schützte sie zwar vor dem Klima, betonte, schattierte und steigerte jedoch gleichzeitig die Schönheit, insbesondere der Frauen. Bedenken hinsichtlich des Aussehens der einheimischen Frauen kamen in den folgenden Bräuchen zum Ausdruck: Am ersten Tag des hellen Feiertags wuschen sich Frauen mit Wasser, in das sie ein farbiges und gewöhnliches Ei legten, und rieben sich mit diesen Eiern die Wangen ein, um ihr Gesicht frisch zu halten . Damit die Wangen rosig wurden, wurden sie mit verschiedenen roten Dingen eingerieben: Gürtel, Plakhta, Roggenblütenstaub, Pfeffer und andere. Manchmal waren die Augenbrauen mit Ruß bedeckt. Dem Volksglauben zufolge konnte man sich nur morgens waschen. Nur an Samstagabenden und am Vorabend wichtiger Feiertage wuschen sich die Mädchen Kopf und Hals und wuschen sich wohl oder übel das Gesicht.


Sie wuschen ihre Haare mit Lauge, Rübenkwas oder heißem Wasser, in das sie einen Zweig der heiligen Weide und einige duftende Kräuter steckten. Der gewaschene Kopf wurde meist mit einem großen Hornkamm oder Kamm gekämmt. Beim Kämmen der Haare flochten die Mädchen ihre Haare entweder zu einem Zopf, in 3-6 Strähnen oder in zwei kleineren Zöpfen. Gelegentlich wurden Haarteile angefertigt, aber bei jeder Frisur war die Stirn des Mädchens offen. Als natürliche Dekoration für die Frisur dienten sowohl Wildblumen als auch aus dem eigenen Blumengarten gepflückte Blumen. In das Geflecht wurden auch mehrfarbige dünne Bänder eingewebt.

Der Hauptkopfschmuck einer Frau ist die Ochinka. Da es für junge Frauen unter 30 Jahren als Sünde galt, keine Ohrringe zu tragen, wurden den Mädchen ab dem zweiten Lebensjahr dünne, scharfe Drahtohrringe in die Ohren gestochen, die bis zur Wundheilung im Ohr blieben. Später trugen Mädchen Kupferohrringe zum Preis von 3-5 Kopeken, Mädchen trugen bereits Ohrringe aus polnischem und gewöhnlichem Silber, gelegentlich auch Gold zum Preis von 45 Kopeken bis 3 Rubel und 50 Kopeken. Die Mädchen hatten nur wenige Ohrringe: 1 - 2 Paar. Um den Hals des Mädchens trugen sie einen mehrfarbigen Namist, bis zu 25 Fäden, der mehr oder weniger tief auf der Brust saß. Auch um den Hals wurde ein Kreuz getragen. Die Kreuze waren aus Holz und kosteten 5 Kopeken; Glas, weiß und farbig, ab 1 Kopeke; Kupfer 3-5 Kopeken und Silber (manchmal emailliert). Auch Ringe gehörten zum Schmuck.

Das Hemd, der Hauptteil der Unterwäsche, wurde Hemd genannt. Zu jeder Jahreszeit trug sie eine „Kersetka“, ein kurzes Kleidungsstück, etwas größer als ein Arschin, schwarz, seltener farbig, aus Wolle oder Papier, das den gesamten Hals und die obere Brust freigab und die Taille eng umschloss. Im Sommer trugen Frauen hochhackige Schuhe (Schuhe) aus schwarzem Leder, die mit Nägeln oder Hufeisen beschlagen waren, und im Winter schwarze Stiefel. Die Haare der Jungen waren glatt geschnitten. Männer mittleren Alters schneiden ihre Haare in einer „gemusterten Stirnlocke, im Kreis“, also rund, gleichmäßig über den gesamten Kopf, wobei sie mehr auf der Stirn, über den Augenbrauen und hinten schneiden. Fast niemand hat sich den Bart rasiert, sondern nur getrimmt. Der Kopf des Bauern wurde durch eine Lammfellmütze, abgerundet zylindrisch oder oben leicht verengt, vor der Kälte geschützt. Der Hut war mit schwarzem, blauem oder rotem Kattun gefüttert, manchmal mit Schaffell. Die allgemein akzeptierte Farbe der Mütze war Schwarz, manchmal auch Grau. Im Sommer wurden auch oft Mützen getragen. Das Herrenhemd unterschied sich vom Damenhemd durch seine Kürze.

Pumphosen wurden immer zum Hemd getragen. Das Tragen von Hosen galt als Zeichen der Reife. Über dem Hemd trugen sie eine graue Woll- oder Papierweste, einreihig, mit schmalem Stehkragen, ohne Ausschnitt und mit zwei Taschen. Über der Weste trugen sie eine schwarze Stoff- oder graue Wolljacke, bis zu den Knien lang, einreihig, mit Haken befestigt, mit Taille. Chumarka war mit Watte gefüttert und diente als Oberbekleidung. Es wurde wie andere Oberbekleidung mit Gürteln gebunden. Herrenschuhe bestanden größtenteils nur aus Stiefeln (Chobots). Chobots wurden aus Yukhta, manchmal aus einem dünnen Gürtel und „Shkapyna“ (Pferdehaut) auf Holznadeln hergestellt. Die Sohlen der Stiefel bestanden aus dickem Gürtel, die Absätze waren mit Nägeln oder Hufeisen besetzt. Der Preis für Stiefel liegt zwischen 2 und 12 Rubel. Neben Stiefeln trugen sie auch Stiefel, wie Damenstiefel, und „Postols“ – lederne Bastschuhe oder gewöhnliche Bastschuhe aus Linden- oder Ulmenrinde.


Der Militärdienst blieb den Bauern nicht verborgen. Das waren die Sprüche über Rekruten und ihre Frauen. „Rekrutierung ist wie ins Grab zu gehen“, „In unserem Volost gibt es drei Übel: Uncoolheit, Steuern und Zemshchina“, „Fröhliches Leid ist das Leben eines Soldaten“, „Ich habe jung gekämpft, aber im Alter wurde ich nach Hause geschickt“ , „Ein Soldat ist ein elender Mann, schlimmer als ein Bastard“, „Der Soldat ist weder eine Witwe noch die Frau eines Mannes“, „Das ganze Dorf ist der Vater der Soldatensöhne.“ Die Dienstzeit eines Rekruten betrug 25 Jahre. Ohne dokumentarische Beweise über den Tod ihres Soldatenmannes konnte eine Frau kein zweites Mal heiraten. Gleichzeitig lebten die Soldatinnen weiterhin in den Familien ihrer Männer und waren völlig abhängig vom Familienoberhaupt. Die Reihenfolge der Rekrutenzuteilung wurde durch die volost-Versammlung der Hausbesitzer festgelegt, bei der eine Liste der Wehrpflichtigen erstellt wurde. Am 8. November 1868 wurde ein Manifest herausgegeben, das den Einsatz von 4 Rekruten pro 1.000 Seelen anordnete. Nach der Militärreform von 1874 wurde die Dienstzeit auf vier Jahre begrenzt. Zum Dienst verpflichtet waren nun alle Jugendlichen, die das 21. Lebensjahr vollendet hatten und aus gesundheitlichen Gründen dienstfähig waren. Das Gesetz sah jedoch Leistungen auf der Grundlage des Familienstands vor.


Die Vorstellungen unserer Vorfahren von Komfort und Hygiene sind für uns eher ungewöhnlich. Bis in die 1920er Jahre gab es keine Bäder. Sie wurden durch Öfen ersetzt, die viel geräumiger waren als moderne. Aus dem ausgebrannten Ofen wurde Asche geharkt. Der Boden war mit Stroh bedeckt, sie kletterten hinein und dampften mit einem Besen. Die Haare wurden außerhalb des Ofens gewaschen. Anstelle von Seife verwendeten sie Lauge – einen Sud aus Asche. Aus unserer Sicht lebten die Bauern in schrecklichem Dreck. Vor Ostern wurde eine allgemeine Reinigung des Hauses durchgeführt: Sie wuschen und reinigten nicht nur die Böden und Wände, sondern auch das gesamte Geschirr – verrußte Töpfe, Griffe, Schürhaken. Sie schlugen mit Heu oder Stroh gefüllte Matratzen aus, auf denen sie schliefen und von denen auch viel Staub war. Sie wuschen die Bettwäsche und die Sackleinen, mit denen sie sich anstelle von Decken bedeckten. In normalen Zeiten wurde eine solche Fürsorge nicht gezeigt. Es wäre gut, wenn die Hütte einen Holzboden hätte, der gewaschen werden könnte, aber einen Lehmboden, der nur gekehrt werden könnte. Es gab keine Menschen in Not. Der Rauch der Öfen, der schwarz rauchte, bedeckte die Wände mit Ruß. Im Winter waren die Hütten mit Staub von Bränden und anderen Spinnabfällen gefüllt. Im Winter litten alle unter der Kälte. Das Brennholz war nicht wie bisher für die zukünftige Verwendung vorbereitet. Normalerweise holen sie eine Wagenladung Totholz aus dem Wald, verbrennen es und holen dann die nächste Wagenladung. Sie wärmten sich an Öfen und auf Sofas. Niemand hatte Doppelrahmen, daher waren die Fenster mit einer dicken Eisschicht bedeckt. All diese Unannehmlichkeiten gehörten für die Bauern zum Alltag, und es war nicht daran zu denken, sie zu ändern.
Heilige – eine Liste der Heiligen der orthodoxen Kirche, zusammengestellt in der Reihenfolge der Monate und Tage des Jahres, in denen der Heilige geehrt wird. Heilige sind in liturgischen Büchern enthalten. Separat veröffentlichte Kalender werden Monatskalender genannt.
Die folgenden Materialien wurden beim Schreiben dieses Artikels verwendet:
Miloradovich V. Leben und Leben eines Lubno-Bauern // Zeitschrift „Kiev Antiquity“, 1902, Nr. 4, S. 110-135, Nr. 6, S. 392-434, Nr. 10, S. 62-91.
Alekseev V.P. Facettierte Eiche // Brjansk, 1994, S. 92-123.