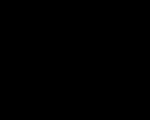Beispiele für tierische Nahrungsketten. Das Thema der Lektion ist „Nahrungsketten“
Wer isst was?
Komponieren Stromkreis Erzählen von den Helden des Liedes „Eine Heuschrecke saß im Gras“
Tiere, die pflanzliche Nahrung fressen, werden Pflanzenfresser genannt. Tiere, die Insekten fressen, werden Insektenfresser genannt. Größere Beutetiere werden von Raubtieren oder Raubtieren gejagt. Auch Insekten, die andere Insekten fressen, gelten als Raubtiere. Schließlich gibt es Allesfresser (sie fressen sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung).
In welche Gruppen lassen sich Tiere nach ihrer Ernährungsweise einteilen? Vervollständigen Sie das Diagramm.

Nahrungskette
Lebewesen sind in der Nahrungskette miteinander verbunden. Zum Beispiel: Espen wachsen im Wald. Hasen ernähren sich von ihrer Rinde. Ein Hase kann von einem Wolf gefangen und gefressen werden. Es stellt sich eine solche Nahrungskette heraus: Espe – Hase – Wolf.
Erstellen und schreiben Sie Nahrungsketten.
a) Spinne, Star, Fliege
Antwort: Fliege – Spinne – Star
b) Storch, Fliege, Frosch
Antwort: Fliege – Frosch – Storch
c) Maus, Korn, Eule
Antwort: Korn – Maus – Eule
d) Nacktschnecke, Pilz, Frosch
Antwort: Pilz – Nacktschnecke – Frosch
e) Habicht, Streifenhörnchen, Beule
Antwort: Beule – Streifenhörnchen – Falke
Lesen kurze Texteüber Tiere aus dem Buch „Mit Liebe zur Natur“. Identifizieren und notieren Sie die Art des Tierfutters.
Im Herbst beginnt der Dachs, sich auf den Winter vorzubereiten. Er isst und wird sehr dick. Als Nahrung dient ihm alles, was ihm begegnet: Käfer, Schnecken, Eidechsen, Frösche, Mäuse und manchmal sogar kleine Hasen. Er isst sowohl Waldbeeren als auch Früchte.
Antwort: Allesfresser Dachs
Im Winter fängt der Fuchs Mäuse unter dem Schnee, manchmal auch Rebhühner. Manchmal jagt sie Hasen. Aber Hasen laufen schneller als ein Fuchs und können vor ihm davonlaufen. Im Winter kommen Füchse in die Nähe menschlicher Siedlungen und greifen Geflügel an.
Antwort: fleischfressender Fuchs
Im Spätsommer und Herbst sammelt das Eichhörnchen Pilze. Sie sticht sie in Äste, um die Pilze zu trocknen. Und das Eichhörnchen stopft Nüsse und Eicheln in Mulden und Spalten. All dies wird ihr im Winterhunger nützlich sein.
Antwort: Pflanzenfressendes Eichhörnchen
Der Wolf ist ein gefährliches Tier. Im Sommer greift er verschiedene Tiere an. Es frisst auch Mäuse, Frösche und Eidechsen. Es zerstört Vogelnester am Boden, frisst Eier, Küken und Vögel.
Antwort: fleischfressender Wolf
Der Bär bricht morsche Baumstümpfe auf und sucht nach fetten Larven von Holzfällerkäfern und anderen holzfressenden Insekten. Er isst alles: Er fängt Frösche, Eidechsen, kurz gesagt, alles, was ihm begegnet. Grabt Blumenzwiebeln und Knollen von Pflanzen aus dem Boden. Auf den Beerenfeldern kann man oft einen Bären treffen, der gierig Beeren frisst. Manchmal greift ein hungriger Bär Elche oder Hirsche an.
Antwort: Allesfresser Bär
Verfassen und notieren Sie anhand der Texte aus der vorherigen Aufgabe mehrere Nahrungsketten.
1. Erdbeere - Nacktschnecke - Dachs
2. Baumrinde - Hase - Fuchs
3. Korn – Vogel – Wolf
4. Holz - Käferlarven - Holzfäller - Bär
5. junge Triebe von Bäumen - Hirsch - Bär
Erstelle aus den Bildern eine Nahrungskette.

Lebewesen benötigen zum Überleben Energie und Nährstoffe. Autotrophe wandeln die Strahlungsenergie der Sonne im Prozess der Photosynthese um und synthetisieren organische Substanzen aus Kohlendioxid und Wasser.
Heterotrophe Sie nutzen diese organischen Stoffe im Ernährungsprozess, zersetzen sie schließlich wieder zu Kohlendioxid und Wasser und die darin angesammelte Energie wird für verschiedene Lebensprozesse von Organismen aufgewendet. Dadurch wird die Lichtenergie der Sonne in chemische Energie umgewandelt organische Substanz und dann in mechanisch und thermisch.
Alle lebenden Organismen im Ökosystem lassen sich je nach Art der Ernährung in drei Funktionsgruppen einteilen – Produzenten, Konsumenten, Zersetzer.
1. Produzenten- Dies sind grüne autotrophe Pflanzen, die organische Substanzen aus anorganischen Substanzen produzieren und Sonnenenergie speichern können.
2. Verbraucher- Dies sind heterotrophe Tiere, die fertige organische Substanzen konsumieren. Verbraucher erster Ordnung können die organischen Stoffe von Pflanzen (Pflanzenfresser) nutzen. Heterotrophe Tiere, die sich tierisch ernähren, werden in Konsumenten der Ordnungen II, III usw. (Fleischfresser) unterteilt. Sie alle nutzen die Energie chemischer Bindungen, die von den Produzenten in organischen Substanzen gespeichert werden.
3. Reduzierstücke- Dies sind heterotrophe Mikroorganismen, Pilze, die organische Rückstände zerstören und mineralisieren. Zersetzer schließen sozusagen den Stoffkreislauf zu anorganischen Stoffen, um in einen neuen Kreislauf einzutreten.
Die Sonne liefert ständig Energie, und lebende Organismen geben diese schließlich in Form von Wärme ab. Im Prozess der lebenswichtigen Aktivität von Organismen findet ein ständiger Energie- und Stoffkreislauf statt, und jede Art nutzt nur einen Teil der in organischen Stoffen enthaltenen Energie. Infolgedessen gibt es Stromkreise - Nahrungsketten, Nahrungsketten, stellt eine Abfolge von Arten dar, die der ursprünglichen Nahrungssubstanz organische Stoffe und Energie entziehen, wobei jede vorherige Verbindung zur Nahrung für die nächste wird (Abb. 98).
Reis. 98. Allgemeines Schema die Nahrungskette
In jedem Glied wird der größte Teil der Energie in Form von Wärme verbraucht und geht verloren, was die Anzahl der Glieder in der Kette begrenzt. Aber die meisten Ketten beginnen mit einer Pflanze und enden mit einem Raubtier, und zwar dem größten. Zersetzer zerstören organisches Material auf allen Ebenen und sind das letzte Glied in der Nahrungskette.
Im Zusammenhang mit der Energieabnahme auf jeder Ebene kommt es zu einer Abnahme der Biomasse. Die trophische Kette hat normalerweise nicht mehr als fünf Ebenen und ist eine ökologische Pyramide mit einer breiten Basis an der Unterseite und einer Verjüngung nach oben (Abb. 99).

Reis. 99. Vereinfachtes Diagramm der ökologischen Pyramide der Biomasse (1) und der Zahlenpyramide (2)
Ökologische Pyramidenregel spiegelt das Muster wider, nach dem in jedem Ökosystem die Biomasse jedes nächsten Glieds zehnmal geringer ist als die des vorherigen.
Es gibt drei Arten von ökologischen Pyramiden:
Eine Pyramide, die die Anzahl der Individuen auf jeder Ebene der Nahrungskette zeigt – Zahlenpyramide;
Pyramide der Biomasse organischer Stoffe, die auf jeder Ebene synthetisiert wird - Massenpyramide(Biomasse);
- Energiepyramide, Zeigt die Menge des Energieflusses an. Normalerweise besteht die Nahrungskette aus 3-4 Gliedern:
Pflanze → Hase → Wolf;
Pflanze → Wühlmaus → Fuchs → Adler;
Pflanze → Raupe → Meise → Habicht;
Pflanze → Gopher → Viper → Adler.
Unter realen Bedingungen in Ökosystemen kreuzen sich jedoch verschiedene Nahrungsketten und bilden verzweigte Netzwerke. Fast alle Tiere, mit Ausnahme seltener spezialisierte Typen, verwenden verschiedene Quellen Essen. Wenn also ein Glied in der Kette ausfällt, kommt es zu keiner Störung im System. Je größer die Artenvielfalt und je reicher die Nahrungsnetze, desto stabiler ist die Biozönose.
In Biozönosen werden zwei Arten von Nahrungsnetzen unterschieden: Weide und Detrital.
1. IN Nahrungsnetz auf der Weide Der Energiefluss verläuft von Pflanzen zu pflanzenfressenden Tieren und dann zu Verbrauchern höherer Ordnung. Das Essnetzwerk. Unabhängig von der Größe der Biozönose und des Lebensraums grasen pflanzenfressende Tiere (Land-, Wasser-, Bodentiere), fressen grüne Pflanzen und übertragen Energie auf die nächsten Ebenen (Abb. 100).

Reis. 100. Weidenahrungsnetzwerk in der terrestrischen Biozönose
2. Wenn der Energiefluss mit abgestorbenen Pflanzen- und Tierresten beginnt, gelangen die Exkremente in die Primärenergie Detritivoren - Zersetzer, Teilweise zersetzendes organisches Material, so nennt man ein solches Nahrungsnetz schädlich, oder Netzwerk des Verfalls(Abb. 101). Zu den primären Detritophagen zählen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) und Kleintiere (Würmer, Insektenlarven).

Reis. 101. Detritus-Nahrungskette
Beide Arten der trophischen Kette kommen in terrestrischen Biogeozänosen vor. In aquatischen Lebensgemeinschaften überwiegt die Weidekette. In beiden Fällen wird die Energie vollständig ausgenutzt.
Nahrungsketten bilden die Grundlage für Beziehungen in der Tierwelt, aber Nahrungsbeziehungen sind nicht die einzige Art von Beziehung zwischen Organismen. Einige Arten können an der Verbreitung, Fortpflanzung und Verbreitung anderer Arten beteiligt sein und geeignete Bedingungen für ihre Existenz schaffen. All die zahlreichen und vielfältigen Verbindungen zwischen lebenden Organismen und der Umwelt gewährleisten die Existenz der Arten in einem stabilen, sich selbst regulierenden Ökosystem.
| |
§ 71. Ökologische Systeme§ 73. Eigenschaften und Struktur von Biozönosen
Frage 28. Nahrungskette. Arten von Nahrungsketten.
NAHRUNGSKETTE(trophische Kette, Nahrungskette), die Beziehung von Organismen durch die Beziehung Nahrung – Verbraucher (einige dienen anderen als Nahrung). In diesem Fall geht es um die Umwandlung von Materie und Energie Produzenten(Primärproduzenten) durch Verbraucher(Verbraucher) zu Zersetzer(Umwandlung toter organischer Stoffe in anorganische Stoffe, die von den Produzenten verdaut werden können). Es gibt zwei Arten von Nahrungsketten: Weide und Detrital. Die Weidekette beginnt mit grünen Pflanzen, geht über grasende pflanzenfressende Tiere (Konsumenten 1. Ordnung) und dann zu Raubtieren, die diese Tiere jagen (abhängig von der Stelle in der Kette - Konsumenten 2. und nachfolgender Ordnung). Die Detritalkette beginnt mit Detritus (einem Produkt des organischen Zerfalls), geht über die Mikroorganismen, die sich davon ernähren, und dann zu den Detritusfressern (Tiere und Mikroorganismen, die am Zersetzungsprozess absterbender organischer Substanz beteiligt sind).
Ein Beispiel für eine Weidekette ist ihr Mehrkanalmodell in der afrikanischen Savanne. Primärproduzenten sind Gräser und Bäume, Konsumenten 1. Ordnung sind pflanzenfressende Insekten und Pflanzenfresser (Huftiere, Elefanten, Nashörner etc.), 2. Ordnung sind Raubinsekten, 3. Ordnung sind fleischfressende Reptilien (Schlangen etc.), 4. Ordnung sind räuberische Säugetiere und Greifvögel. Im Gegenzug zerstören Detritivfresser (Skarabäuskäfer, Hyänen, Schakale, Geier usw.) auf jeder Stufe der Weidekette die Kadaver toter Tiere und die Reste der Nahrung der Raubtiere. Die Zahl der in der Nahrungskette enthaltenen Individuen nimmt in jedem ihrer Glieder stetig ab (Regel der ökologischen Pyramide), d. h. die Zahl der Opfer übersteigt jedes Mal die Zahl ihrer Konsumenten deutlich. Nahrungsketten sind nicht voneinander isoliert, sondern miteinander verflochten und bilden Nahrungsnetze.
Frage 29. Wofür werden ökologische Pyramiden verwendet? Nennen Sie sie.
ökologische Pyramide- grafische Bilder der Beziehung zwischen Produzenten und Verbrauchern aller Ebenen (Pflanzenfresser, Raubtiere; Arten, die sich von anderen Raubtieren ernähren) im Ökosystem.
Der amerikanische Zoologe Charles Elton schlug 1927 vor, diese Zusammenhänge schematisch darzustellen.
In einer schematischen Darstellung ist jede Ebene als Rechteck dargestellt, deren Länge bzw. Fläche den Zahlenwerten des Nahrungskettenglieds (Eltons Pyramide), deren Masse bzw. Energie entspricht. In einer bestimmten Reihenfolge angeordnete Rechtecke ergeben Pyramiden unterschiedlicher Form.
Die Basis der Pyramide ist die erste trophische Ebene – die Ebene der Produzenten, die nachfolgenden Etagen der Pyramide werden von den nächsten Ebenen der Nahrungskette – Konsumenten verschiedener Ordnungen – gebildet. Die Höhe aller Blöcke in der Pyramide ist gleich und die Länge ist proportional zur Anzahl, Biomasse oder Energie auf der entsprechenden Ebene.
Ökologische Pyramiden werden anhand der Indikatoren unterschieden, auf deren Grundlage die Pyramide gebaut wird. Gleichzeitig gilt für alle Pyramiden die Grundregel, dass es in jedem Ökosystem mehr Pflanzen als Tiere, Pflanzenfresser als Fleischfresser, Insekten als Vögel gibt.
Basierend auf der Regel der ökologischen Pyramide ist es möglich, die Mengenverhältnisse verschiedener Pflanzen- und Tierarten in natürlichen und künstlich geschaffenen Ökosystemen zu bestimmen bzw. zu berechnen. Beispielsweise benötigt 1 kg der Masse eines Meerestiers (Robbe, Delfin) 10 kg gefressenen Fisch, und diese 10 kg benötigen bereits 100 kg ihrer Nahrung – wirbellose Wassertiere, die wiederum 1000 kg davon fressen müssen Algen und Bakterien bilden eine solche Masse. In diesem Fall wird die ökologische Pyramide stabil sein.
Wie Sie wissen, gibt es jedoch von jeder Regel Ausnahmen, die in jeder Art von ökologischen Pyramiden berücksichtigt werden.
Die ersten ökologischen Anlagen in Form von Pyramiden wurden in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet. Charles Elton. Sie basierten auf Feldbeobachtungen einer Reihe von Tieren unterschiedlicher Größenklassen. Elton bezog darin keine Primärproduzenten ein und machte keinen Unterschied zwischen Detritophagen und Zersetzern. Er stellte jedoch fest, dass Raubtiere normalerweise größer sind als ihre Beute, und erkannte, dass ein solches Verhältnis nur für bestimmte Tiergrößenklassen äußerst spezifisch ist. In den 1940er Jahren wandte der amerikanische Ökologe Raymond Lindeman Eltons Idee auf trophische Ebenen an und abstrahierte von den spezifischen Organismen, aus denen sie bestehen. Wenn es jedoch einfach ist, Tiere in Größenklassen einzuteilen, ist es viel schwieriger zu bestimmen, zu welcher trophischen Ebene sie gehören. Dies kann jedenfalls nur sehr vereinfacht und verallgemeinert erfolgen. Nährstoffverhältnisse und die Effizienz der Energieübertragung in der biotischen Komponente eines Ökosystems werden traditionell als Stufenpyramiden dargestellt. Dies bietet eine klare Grundlage für den Vergleich: 1) verschiedener Ökosysteme; 2) saisonale Zustände desselben Ökosystems; 3) verschiedene PhasenÖkosystemveränderungen. Es gibt drei Arten von Pyramiden: 1) Zahlenpyramiden, die auf der Zählung der Organismen jeder trophischen Ebene basieren; 2) Biomassepyramiden, die die Gesamtmasse (normalerweise trocken) der Organismen auf jeder trophischen Ebene nutzen; 3) Energiepyramiden unter Berücksichtigung der Energieintensität der Organismen jeder trophischen Ebene.
Arten von ökologischen Pyramiden
Zahlenpyramiden- Auf jeder Ebene wird die Anzahl der einzelnen Organismen verschoben
Die Zahlenpyramide spiegelt ein klares Muster wider, das Elton entdeckt hat: Die Anzahl der Individuen, die eine aufeinanderfolgende Reihe von Verbindungen vom Produzenten zum Verbraucher bilden, nimmt stetig ab (Abb. 3).
Um beispielsweise einen Wolf zu füttern, braucht man mindestens ein paar Hasen, die er jagen kann; Um diese Hasen zu füttern, braucht man eine ziemlich große Anzahl verschiedener Pflanzen. In diesem Fall sieht die Pyramide wie ein Dreieck mit einer breiten, nach oben verjüngten Basis aus.
Allerdings ist diese Form einer Zahlenpyramide nicht für alle Ökosysteme typisch. Manchmal können sie umgekehrt oder umgekehrt sein. Dies gilt für die Nahrungsketten im Wald, wenn Bäume als Produzenten und Insekten als Hauptkonsumenten fungieren. In diesem Fall ist die Ebene der Primärverbraucher zahlenmäßig reicher als die Ebene der Produzenten (eine große Anzahl von Insekten ernährt sich von einem Baum), daher sind die Zahlenpyramiden am wenigsten aussagekräftig und am wenigsten aussagekräftig, d.h. Die Anzahl der Organismen derselben trophischen Ebene hängt weitgehend von ihrer Größe ab.
Biomassepyramiden- charakterisiert die gesamte Trocken- oder Nassmasse von Organismen auf einem bestimmten trophischen Niveau, zum Beispiel in Masseneinheiten pro Flächeneinheit – g/m 2, kg/ha, t/km 2 oder pro Volumen – g/m 3 (Abb . 4)
Normalerweise ist in terrestrischen Biozönosen die Gesamtmasse der Produzenten größer als jedes nachfolgende Glied. Die Gesamtmasse der Verbraucher erster Ordnung ist wiederum größer als die der Verbraucher zweiter Ordnung und so weiter.
In diesem Fall (wenn sich die Organismen nicht zu stark in der Größe unterscheiden) sieht die Pyramide auch wie ein Dreieck mit breiter, nach oben hin spitz zulaufender Basis aus. Es gibt jedoch erhebliche Ausnahmen von dieser Regel. In den Meeren beispielsweise ist die Biomasse des pflanzenfressenden Zooplanktons deutlich (manchmal 2-3-mal) größer als die Biomasse des Phytoplanktons, das hauptsächlich durch einzellige Algen repräsentiert wird. Dies liegt daran, dass Algen vom Zooplankton sehr schnell zerfressen werden, die sehr hohe Teilungsrate ihrer Zellen sie jedoch vor dem vollständigen Verzehr schützt.
Im Allgemeinen zeichnen sich terrestrische Biogeozänosen, in denen die Produzenten groß sind und relativ lange leben, durch relativ stabile Pyramiden mit breiter Basis aus. In aquatischen Ökosystemen, in denen die Produzenten klein sind und kurze Lebenszyklen haben, kann die Biomassepyramide umgekehrt oder umgekehrt (nach unten gerichtet) sein. So übersteigt in Seen und Meeren die Pflanzenmasse nur während der Blütezeit (Frühling) die Masse der Verbraucher, im restlichen Jahr kann sich die Situation umkehren.
Zahlen- und Biomassepyramiden spiegeln die Statik des Systems wider, d. h. sie charakterisieren die Anzahl bzw. Biomasse der Organismen in einem bestimmten Zeitraum. Sie liefern keine vollständigen Informationen über die trophische Struktur des Ökosystems, ermöglichen jedoch die Lösung einer Reihe praktischer Probleme, insbesondere im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Stabilität von Ökosystemen.
Die Zahlenpyramide ermöglicht es beispielsweise, den zulässigen Wert des Fischfangs oder des Schießens von Tieren während der Jagdzeit zu berechnen, ohne dass dies Auswirkungen auf deren normale Fortpflanzung hat.
Energiepyramiden- zeigt die Größe des Energieflusses oder der Produktivität auf aufeinanderfolgenden Ebenen (Abb. 5).
Im Gegensatz zu den Zahlen- und Biomassepyramiden, die die Statik des Systems (die Anzahl der Organismen zu einem bestimmten Zeitpunkt) widerspiegeln, spiegelt die Energiepyramide das Bild der Durchgangsgeschwindigkeit einer Nahrungsmasse (Energiemenge) wider ) durch jede trophische Ebene der Nahrungskette liefert das umfassendste Bild der funktionalen Organisation von Gemeinschaften.
Die Form dieser Pyramide wird nicht durch Änderungen in der Größe und Intensität des Stoffwechsels einzelner Personen beeinflusst, und wenn alle Energiequellen berücksichtigt werden, wird die Pyramide immer ein typisches Aussehen mit einer breiten Basis und einer sich verjüngenden Spitze haben. Beim Bau einer Energiepyramide wird an der Basis oft ein Rechteck angefügt, das den Zufluss der Sonnenenergie anzeigt.
Im Jahr 1942 formulierte der amerikanische Ökologe R. Lindeman das Gesetz der Energiepyramide (das 10-Prozent-Gesetz), nach dem im Durchschnitt etwa 10 % der von der vorherigen Ebene der ökologischen Pyramide aufgenommenen Energie von einer abgegeben werden trophische Ebene durch Nahrungsketten zu einer anderen trophischen Ebene. Der Rest der Energie geht in Form von Wärmestrahlung, Bewegung etc. verloren. Durch Stoffwechselprozesse verlieren Organismen etwa 90 % der gesamten Energie, die für die Aufrechterhaltung ihrer lebenswichtigen Aktivität in jedem Glied der Nahrungskette aufgewendet wird.
Wenn ein Hase 10 kg Pflanzenmaterial frisst, könnte sich sein Eigengewicht um 1 kg erhöhen. Ein Fuchs oder Wolf, der 1 kg Hase frisst, erhöht seine Masse nur um 100 g. Bei Gehölzen ist dieser Anteil viel geringer, da Holz von Organismen schlecht aufgenommen wird. Bei Gräsern und Algen liegt dieser Wert deutlich höher, da sie über kein schwer verdauliches Gewebe verfügen. Die allgemeine Regelmäßigkeit des Prozesses der Energieübertragung bleibt jedoch bestehen: Durch die oberen trophischen Ebenen fließt viel weniger Energie als durch die unteren.
Die wichtigste Voraussetzung für die Existenz eines Ökosystems ist die Aufrechterhaltung des Stoffkreislaufs und der Energieumwandlung. Es wird dank bereitgestellt trophisch (Nahrung) Beziehungen zwischen Arten, die verschiedenen funktionellen Gruppen angehören. Auf der Grundlage dieser Bindungen werden organische Substanzen, die von Produzenten aus mineralischen Substanzen unter Absorption von Sonnenenergie synthetisiert werden, auf Verbraucher übertragen und unterliegen chemischen Umwandlungen. Durch die lebenswichtige Aktivität überwiegend zersetzender Stoffe entstehen Atome des wichtigsten Biogens chemische ElementeÜbergang von organischen zu anorganischen Stoffen (CO 2, NH 3, H 2 S, H 2 O). Dann werden anorganische Stoffe von den Produzenten genutzt, um daraus neue organische Stoffe herzustellen. Und sie werden mit Hilfe der Produzenten wieder in den Kreislauf eingebunden. Würden diese Stoffe nicht wiederholt eingesetzt, wäre Leben auf der Erde unmöglich. Schließlich sind die von den Produzenten aufgenommenen Stoffreserven nicht unbegrenzt. Um einen vollwertigen Stoffkreislauf in einem Ökosystem zu realisieren, müssen alle drei funktionellen Gruppen von Organismen vorhanden sein. Und zwischen ihnen muss eine ständige Interaktion in Form von trophischen Verbindungen mit der Bildung trophischer (Nahrungs-)Ketten oder Nahrungsketten stattfinden.
Eine Nahrungskette (Nahrungskette) ist eine Abfolge von Organismen, in der Materie und Energie schrittweise von einer Quelle (vorheriger Link) zu einem Verbraucher (nächster Link) übertragen werden.
In diesem Fall kann ein Organismus einen anderen fressen, seine toten Überreste oder Abfallprodukte fressen. Abhängig von der Art der Ausgangsstoff- und Energiequelle werden Nahrungsketten in zwei Arten unterteilt: Weide (Weideketten) und Detrital (Zersetzungsketten).
Weideketten (Weideketten)- Lebensmittelketten, die bei den Produzenten beginnen und Verbraucher verschiedener Ordnungen einbeziehen. IN Gesamtansicht Die Weidekette lässt sich anhand des folgenden Diagramms darstellen:
Produzenten -> Verbraucher 1. Ordnung -> Verbraucher 2. Ordnung -> Verbraucher 3. Ordnung
Zum Beispiel: 1) Wiesennahrungskette: Wiesenklee – Schmetterling – Frosch – Schlange; 2) die Nahrungskette des Stausees: Chlamydomonas – Daphnien – Gründling – Zander. Die Pfeile im Diagramm zeigen die Richtung der Stoff- und Energieübertragung in der Nahrungskette.
Jeder Organismus in der Nahrungskette gehört einer bestimmten trophischen Ebene an.
Trophische Ebene – eine Reihe von Organismen, die je nach Ernährungsweise und Art der Nahrung ein bestimmtes Glied in der Nahrungskette bilden.
Trophäenstufen werden normalerweise nummeriert. Die erste trophische Ebene besteht aus autotrophen Organismen – Pflanzen (Produzenten), auf der zweiten trophischen Ebene gibt es pflanzenfressende Tiere (Konsumenten erster Ordnung), auf der dritten und den folgenden Ebenen – Fleischfresser (Konsumenten zweiter, dritter usw.) . Aufträge).
In der Natur ernähren sich fast alle Organismen nicht von einer, sondern von mehreren Arten von Nahrungsmitteln. Daher kann sich jeder Organismus je nach Art der Nahrung auf unterschiedlichen trophischen Ebenen in derselben Nahrungskette befinden. Zum Beispiel nimmt ein Falke, der Mäuse frisst, die dritte trophische Ebene ein und der Schlangenfresser die vierte. Darüber hinaus kann derselbe Organismus ein Glied in verschiedenen Nahrungsketten sein und diese miteinander verbinden. So kann ein Falke eine Eidechse, einen Hasen oder eine Schlange fressen, die Teil unterschiedlicher Nahrungsketten sind.
In der Natur kommen Weideketten in reiner Form nicht vor. Sie sind durch gemeinsame Nahrungsverbindungen und Formen miteinander verbunden Nahrungsnetz, oder Stromnetz. Seine Präsenz im Ökosystem trägt zum Überleben von Organismen bei, denen eine bestimmte Art von Nahrung fehlt, da sie andere Nahrung nutzen können. Und je größer die Artenvielfalt der Individuen im Ökosystem ist, desto mehr Nahrungsketten gibt es im Nahrungsnetz und desto stabiler ist das Ökosystem. Der Verlust eines Glieds in der Nahrungskette wird nicht das gesamte Ökosystem stören, da Nahrungsquellen aus anderen Nahrungsketten genutzt werden können.
Detritusketten (Zersetzungsketten)- Nahrungsketten, die mit Detritus beginnen, Detritusfresser und -zersetzer umfassen und mit Mineralien enden. In Detritalketten werden Substanz und Energie des Detritus zwischen Detritophagen und Zersetzern durch die Produkte ihrer lebenswichtigen Aktivität übertragen.
Zum Beispiel: ein toter Vogel – Fliegenlarven – Schimmelpilze – Bakterien – Mineralien. Wenn Detritus keine mechanische Zerstörung erfordert, wird er sofort zu Humus mit anschließender Mineralisierung.
Dank der Detritalketten ist der Stoffkreislauf in der Natur geschlossen. Abgestorbene organische Substanzen in den Detritalketten werden in Mineralien umgewandelt, die in die Umwelt gelangen und von dort von Pflanzen (Produzenten) aufgenommen werden.
Weideketten befinden sich überwiegend in den oberirdischen Schichten und Zersetzungsketten in den unterirdischen Schichten von Ökosystemen. Die Beziehung zwischen Weideketten und Detritalketten wird durch Detritus hergestellt, der in den Boden gelangt. Detritalketten sind mit Weideketten durch mineralische Substanzen verbunden, die von den Produzenten aus dem Boden extrahiert werden. Durch die Vernetzung von Weide- und Detritalketten entsteht im Ökosystem ein komplexes Nahrungsnetz, das die Konstanz der Prozesse der Stoff- und Energieumwandlung gewährleistet.
Ökologische Pyramiden
Der Prozess der Umwandlung von Materie und Energie in Weideketten weist bestimmte Gesetzmäßigkeiten auf. Auf jeder trophischen Ebene der Weidekette wird nicht die gesamte gefressene Biomasse zur Bildung der Biomasse der Verbraucher dieser Ebene verwendet. Ein erheblicher Teil davon wird für lebenswichtige Prozesse von Organismen aufgewendet: Bewegung, Fortpflanzung, Aufrechterhaltung der Körpertemperatur usw. Darüber hinaus wird ein Teil des Futters nicht verdaut und gelangt in die Nahrung Umfeld. Mit anderen Worten: Der Großteil der darin enthaltenen Materie und Energie geht beim Übergang von einer trophischen Ebene zur anderen verloren. Der Prozentsatz der Verdaulichkeit variiert stark und hängt von der Zusammensetzung des Lebensmittels ab biologische Merkmale Organismen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass auf jeder trophischen Ebene der Nahrungskette durchschnittlich etwa 90 % der Energie verloren gehen und nur 10 % auf die nächste Ebene gelangen. Der amerikanische Ökologe R. Lindeman formulierte dieses Muster 1942 als 10 %-Regel. Mit dieser Regel können Sie die Energiemenge auf jeder trophischen Ebene der Nahrungskette berechnen, sofern ihr Anteil auf einer dieser Ebenen bekannt ist. Mit einer gewissen Annahme wird diese Regel auch verwendet, um den Übergang der Biomasse zwischen trophischen Ebenen zu bestimmen.
Wenn auf jeder trophischen Ebene der Nahrungskette die Anzahl der Individuen oder ihre Biomasse oder die darin enthaltene Energiemenge bestimmt wird, wird deutlich, dass diese Werte abnehmen, je weiter wir uns dem Ende der Nahrungskette nähern. Dieses Muster wurde erstmals 1927 vom englischen Ökologen C. Elton aufgestellt. Er nannte es Ökologische Pyramidenregel und angeboten, grafisch auszudrücken. Wenn eines der oben genannten Merkmale der trophischen Ebenen als Rechtecke mit demselben Maßstab dargestellt und übereinander platziert wird, erhalten wir ökologische Pyramide.
Es sind drei Arten ökologischer Pyramiden bekannt. Zahlenpyramide spiegelt die Anzahl der Individuen in jedem Glied der Nahrungskette wider. Im Ökosystem ist jedoch die zweite trophische Ebene ( Verbraucher 1. Ordnung) kann zahlenmäßig reicher sein als die erste trophische Ebene ( Produzenten). In diesem Fall erhält man eine umgekehrte Zahlenpyramide. Dies ist auf die Beteiligung von Individuen an solchen Pyramiden zurückzuführen, deren Größe nicht gleich groß ist. Ein Beispiel ist eine Zahlenpyramide, bestehend aus Laubbaum, blattfressende Insekten, kleine Insektenfresser und große Greifvögel. Biomassepyramide spiegelt die Menge an organischer Substanz wider, die sich auf jeder trophischen Ebene der Nahrungskette ansammelt. Die Pyramide der Biomasse in terrestrischen Ökosystemen ist richtig. Und in der Biomassepyramide für aquatische Ökosysteme ist die Biomasse der zweiten trophischen Ebene in der Regel größer als die Biomasse der ersten, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt wird. Aber seit Wasserproduzenten (Phytoplankton) haben schnelle Geschwindigkeit Bildung von Produkten, dann wird ihre Biomasse für die Saison am Ende immer noch größer sein als die Biomasse von Verbrauchern erster Ordnung. Und das bedeutet, dass die Regel der ökologischen Pyramide auch in aquatischen Ökosystemen eingehalten wird. Energiepyramide spiegelt Muster des Energieverbrauchs auf verschiedenen trophischen Ebenen wider.
Dadurch wird der von Pflanzen in den Nahrungsketten der Weide angesammelte Stoff- und Energievorrat schnell verbraucht (zerfressen), sodass diese Ketten nicht lang sein können. Sie umfassen normalerweise drei bis fünf trophische Ebenen.
Im Ökosystem sind Produzenten, Konsumenten und Zersetzer durch trophische Beziehungen verbunden und bilden Nahrungsketten: Weide und Detrital. In Weideketten gelten die 10 %-Regel und die ökologische Pyramidenregel. Es können drei Arten ökologischer Pyramiden gebaut werden: Zahlen, Biomasse und Energie.
Die Energie der Sonne spielt eine große Rolle bei der Fortpflanzung des Lebens. Die Menge dieser Energie ist sehr hoch (ca. 55 kcal pro 1 cm2 und Jahr). Von dieser Menge binden Produzenten – grüne Pflanzen – durch Photosynthese nicht mehr als 1-2 % der Energie, Wüsten und Ozeane – Hundertstel Prozent.
Die Anzahl der Glieder in der Nahrungskette kann unterschiedlich sein, normalerweise sind es jedoch 3-4 (selten 5). Tatsache ist, dass dem letzten Glied der Nahrungskette so wenig Energie zugeführt wird, dass diese nicht ausreichen wird, wenn die Zahl der Organismen zunimmt.
Reis. 1. Nahrungsketten im terrestrischen Ökosystem
Die Gesamtheit der Organismen, die durch eine Art von Nahrung vereint sind und eine bestimmte Position in der Nahrungskette einnehmen, wird als bezeichnet trophische Ebene. Organismen, die ihre Energie von der Sonne über die gleiche Anzahl von Schritten erhalten, gehören zur gleichen trophischen Ebene.
Die einfachste Nahrungskette (oder Nahrungskette) kann aus Phytoplankton bestehen, gefolgt von größeren pflanzenfressenden planktonischen Krebstieren (Zooplankton), und die Kette endet mit einem Wal (oder kleinen Raubtieren), der diese Krebstiere aus dem Wasser filtert.
Die Natur ist komplex. Alle seine Elemente, lebende und unbelebte, sind ein Ganzes, ein Komplex interagierender und miteinander verbundener Phänomene und aneinander angepasster Wesen. Dies sind Glieder derselben Kette. Und wenn mindestens ein solches Glied aus der Gesamtkette entfernt wird, können die Ergebnisse unerwartet sein.
Das Unterbrechen von Nahrungsketten kann besonders negative Auswirkungen auf Wälder haben, seien es Waldbiozönosen der gemäßigten Zone oder artenreiche Biozönosen des Tropenwaldes. Viele Arten von Bäumen, Sträuchern oder krautigen Pflanzen nutzen die Dienste eines bestimmten Bestäubers – Bienen, Wespen, Schmetterlinge oder Kolibris, die im Verbreitungsgebiet dieser Pflanzenart leben. Sobald der letzte blühende Baum oder die letzte krautige Pflanze stirbt, ist der Bestäuber gezwungen, diesen Lebensraum zu verlassen. Dadurch sterben Phytophagen (Pflanzenfresser), die sich von diesen Pflanzen oder Früchten des Baumes ernähren. Raubtiere, die Phytophagen jagen, bleiben ohne Nahrung, und dann werden sich die Veränderungen nach und nach auf den Rest der Nahrungskette auswirken. Dadurch wirken sie sich auch auf den Menschen aus, da er seinen eigenen spezifischen Platz in der Nahrungskette einnimmt.
Nahrungsketten können in zwei Haupttypen unterteilt werden: Beweidung und Detrital. Es werden Lebensmittelpreise genannt, die mit autotrophen photosynthetischen Organismen beginnen Weide, oder Essketten. An der Spitze der Weidekette stehen Grünpflanzen. Phytophagen finden sich meist auf der zweiten Ebene der Weidekette; Tiere, die Pflanzen fressen. Ein Beispiel für eine Nahrungskette auf der Weide ist die Beziehung zwischen Organismen auf einer Auenwiese. Eine solche Kette beginnt mit einer Wiesenblütenpflanze. Der nächste Link ist ein Schmetterling, der sich vom Nektar einer Blume ernährt. Dann kommt der Bewohner feuchter Lebensräume – der Frosch. Seine schützende Färbung ermöglicht es ihm, auf das Opfer zu lauern, rettet es jedoch nicht vor einem anderen Raubtier – der Ringelnatter. Nachdem der Reiher die Schlange gefangen hat, schließt er die Nahrungskette in der Auenwiese.
Beginnt die Nahrungskette mit abgestorbenen Pflanzenresten, Leichen und tierischen Exkrementen – Detritus nennt man das Detritus, oder Zersetzungskette. Der Begriff „Detritus“ bezeichnet ein Zerfallsprodukt. Es ist der Geologie entlehnt, wo die Produkte der Gesteinszerstörung als Detritus bezeichnet werden. In der Ökologie ist Detritus die organische Substanz, die am Zersetzungsprozess beteiligt ist. Solche Ketten sind charakteristisch für die Gemeinschaften am Boden tiefer Seen und Ozeane, wo sich viele Organismen von Ablagerungen ernähren, die von toten Organismen aus den oberen beleuchteten Schichten des Stausees gebildet werden.
In Waldbiozönosen beginnt die Detritalkette mit der Zersetzung abgestorbener organischer Substanz durch Saprophagentiere. Wirbellose Bodentiere (Arthropoden, Würmer) und Mikroorganismen sind am aktivsten am Abbau organischer Stoffe beteiligt. Es gibt auch große Saprophagen – Insekten, die das Substrat für Organismen vorbereiten, die Mineralisierungsprozesse durchführen (für Bakterien und Pilze).
Im Gegensatz zur Weidekette nimmt die Größe der Organismen bei der Bewegung entlang der Detritalkette nicht zu, sondern im Gegenteil ab. So können Totengräberinsekten auf der zweiten Ebene stehen. Aber am meisten typische Vertreter Detritalketten sind Pilze und Mikroorganismen, die sich von toten Stoffen ernähren und den Prozess der bioorganischen Zersetzung in den Zustand einfachster mineralischer und organischer Substanzen abschließen, die dann in gelöster Form von den Wurzeln grüner Pflanzen an der Spitze der Weidekette verzehrt werden. damit beginnen neuer Kreis Bewegung der Materie.
In einigen Ökosystemen überwiegen Weideketten, in anderen Detritalketten. Beispielsweise wird ein Wald als ein von Schuttketten dominiertes Ökosystem betrachtet. Im Ökosystem der verrottenden Baumstümpfe gibt es überhaupt keine Weidekette. Gleichzeitig werden beispielsweise in den Ökosystemen der Meeresoberfläche fast alle Erzeuger des Phytoplanktons von Tieren verzehrt und ihre Leichen sinken zu Boden, d.h. Verlassen Sie das veröffentlichte Ökosystem. In diesen Ökosystemen dominieren Beweidung bzw. Weide-Nahrungsketten.
Allgemeine Regel bezüglich irgendwelcher die Nahrungskette, besagt: Auf jeder trophischen Ebene der Gemeinschaft wird der größte Teil der mit der Nahrung aufgenommenen Energie für die Erhaltung des Lebens aufgewendet, vernichtet und kann von anderen Organismen nicht mehr genutzt werden. Daher wird die auf jeder trophischen Ebene verzehrte Nahrung nicht vollständig assimiliert. Ein erheblicher Teil davon wird für den Stoffwechsel aufgewendet. Beim Übergang zu jedem weiteren Glied in der Nahrungskette gesamt Die nutzbare Energie, die auf die nächsthöhere trophische Ebene übertragen wird, wird reduziert.