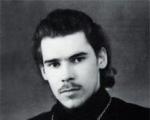Analyse von Katerinas Monolog-Aktion 5 Phänomen 2. Die tiefe Bedeutung von Katerinas Monologen, der Hauptfigur des Stücks A
Im Werk von A. N. Ostrovsky „The Thunderstorm“ ist die Szene mit dem Schlüssel eine der Hauptszenen des Dramas. Diese Szene lüftet für uns den Vorhang des Geheimnisses über die Handlungen und die Psychologie einer Person. Das Drama „Gewitter“ ist trotz anderer Konzepte im 21. Jahrhundert auch heute noch aktuell, vieles ist uns seitdem erhalten geblieben und Seelengefühle blieb gleich.
Die Situation im Werk erscheint erkennbar, aber zugleich faszinierend.
Im Leben erleben wir oft Situationen, in denen die Beziehung eines Menschen scheitert, weil sich jemand in eine andere Person verliebt hat. Aus psychologischer Sicht ist ein Monolog mit Tonart einer der besten, da sich darin das gesamte weibliche Wesen offenbart.
Im Monolog spricht Katerina mit sich selbst darüber, was sie tun soll. Zuerst sagt sie, ich solle den Schlüssel wegwerfen. Nachdem sie noch ein bisschen gestritten hat, sagt sie das Gegenteil: „Ja, vielleicht wird so ein Fall in meinem ganzen Leben nie passieren ... Werfen Sie den Schlüssel weg! Nein, um nichts in der Welt!“ Hier liegt ein Selbstwiderspruch vor. Zu Beginn des Monologs ging Katerina vernünftig mit dieser Situation um, doch dann begannen Gefühle, sie zu kontrollieren.
Katerina heiratete nicht aus freien Stücken, sie wählte ihren Ehemann nicht, sie wählten sie, und Tikhon heiratete nicht aus Liebe. Aber damals war es unmöglich, die Regeln zu brechen, da ihre Ehe im Himmel geschlossen wurde. Das gilt auch heute noch. Täglich heiraten und scheiden viele Menschen, erst im 21. Jahrhundert hat die Familie ihre Bedeutung verloren. Die Leute begannen, es ruhiger angehen zu lassen. Katerina quält sich, macht sich Sorgen, denn damals galten Familie und Ehe sehr wichtig Wenn die Eltern verheiratet sind, sollten Sie bis zum Grab bei dieser Person sein. Katerina ist besorgt und weiß nicht, was sie tun soll, weil sie versteht, dass sie für Tichon verantwortlich ist, aber Gefühle sind stärker als Vernunft, also geht die Heldin trotzdem zum Treffen.
Ein Mensch lebt und handelt nach inneren Gesetzen, inneren Impulsen, auch wenn ihm klar ist, dass diese Handlung falsch ist und tragisch ausgehen kann.
Es gibt viele Bemerkungen im Monolog, sie scheinen die Grenzen von Katerinas verschiedenen Zuständen darzustellen. Einer ihrer Zustände in diesem Monolog ist Angst, Zweifel, Selbstrechtfertigung und am Ende das Vertrauen in die eigene Richtigkeit.
Dieser Monolog kann als Höhepunkt in der Entwicklung der Linie angesehen werden interner Konflikt Katerina, der Konflikt zwischen vernünftigen Vorstellungen vom Leben und den Geboten des Herzens, den Anforderungen der Gefühle. Jedes Mädchen möchte lieben und geliebt werden. Katerina wird in diesem Monolog als denkende und tief empfindende Person dargestellt.
Die Szene von Katerinas Sündenbekenntnis findet am Ende des 4. Aktes statt. Ihr kompositorische Rolle- der Höhepunkt von Katerinas Konflikt mit Kabanikha und einer der Höhepunkte der Entwicklung eines inneren Konflikts in Katerinas Seele, wenn der Wunsch nach einem lebendigen und freien Gefühl mit religiösen Ängsten vor Strafe für Sünden und der moralischen Pflicht der Heldin kämpft.
Die Verschärfung von Konflikten wird durch eine Reihe vorangegangener Umstände verursacht und vorbereitet:
· in der 3. Erscheinung warnt die sensible und schlagfertige Warwara Boris, dass Katerina sehr leidet und gestehen kann, Boris aber nur um sich selbst Angst hatte;
Es ist kein Zufall, dass am Ende ihres Gesprächs die ersten Donnerschläge zu hören sind, ein Gewitter beginnt;
Vorbeigehen Nebenfiguren Mit ihren Bemerkungen über die Unvermeidlichkeit der Bestrafung und dass „dieses Gewitter nicht umsonst vorübergehen wird“ verstärken sie die Angst vor einem Gewitter und bereiten Unruhen vor, sagen sie voraus; Auch Katerina sieht dieses Unglück voraus;
· Kuligins „blasphemischen“ Reden über Elektrizität und dass „Gewitter Gnade ist“ stehen im Gegensatz zu diesen Bemerkungen, und das verschärft das Geschehen zusätzlich;
Schließlich sind die direkt an Katerina gerichteten Worte einer halb verrückten Dame zu hören, und auch das Gewitter verstärkt sich.
Katerina ruft voller Angst und Scham aus: „Ich bin eine Sünderin vor Gott und vor dir!“ Der Grund für seine Anerkennung liegt nicht nur in religiöser Angst, sondern auch in moralischen Qualen, Gewissensqualen und Schuldgefühlen. Tatsächlich wird sie im fünften Akt, im Moment des Abschieds vom Leben, religiöse Ängste überwinden, das moralische Gefühl wird triumphieren („Wer liebt, der wird beten“) und für sie wird nicht mehr die Angst vor dem Entscheidenden sein Strafe, sondern die Angst, die Freiheit wieder zu verlieren („und sie werden fangen und nach Hause zurückkehren …“).
Das in den Monologen des ersten Akts skizzierte Motiv des Vogels, der Flucht, erreicht seinen Höhepunkt und entwickelt den Konflikt von Puschkins „Gefangener“: Gefangenschaft ist für ein freies Wesen unmöglich.
Der Tod von Katerina ist für sie die einzige Möglichkeit, ihre Freiheit wiederzugewinnen.
Die Reaktion anderer Helden auf Katerinas Geständnis ist interessant und wichtig:
· Barbara versucht als wahre Freundin, Ärger zu verhindern, Katerina zu beruhigen und sie zu beschützen („Sie lügt…“);
Tikhon leidet weniger unter Verrat als vielmehr unter der Tatsache, dass dies unter seiner Mutter passiert ist: Er will keine Umwälzungen, er braucht diese Wahrheit nicht, und noch mehr in ihrer öffentlichen Version, die das übliche Prinzip „mit Scheiße bedeckt“ zerstört ”; außerdem ist er selbst nicht ohne Sünde;
Für Kabanova kommt der Moment des Triumphs ihrer Regeln („Ich sagte ...“);
Wo ist Boris? Im entscheidenden Moment zog er sich feige zurück.
Das Erkennen selbst erfolgt, wenn für die Heldin alles zusammenkommt: Gewissensbisse, Angst vor einem Gewitter als Strafe für Sünden, Vorhersagen von Passanten und ihre eigenen Vorahnungen, Kabanikhs Reden über Schönheit und Strudel, Boris' Verrat und schließlich das Gewitter selbst.
Katerina bekennt ihre Sünde öffentlich, in der Kirche, wie es in der Kirche üblich ist Orthodoxe Welt, das ihre Nähe zum Volk bestätigt, zeigt die wahrhaft russische Seele der Heldin.
[email protected] In der Kategorie ist die Frage am 16.09.2017 um 02:40 Uhr geöffnet
TEXT
KATERINA (allein, den Schlüssel in der Hand). Was macht Sie? Was denkt sie? Ah, verrückt, wirklich, verrückt! Hier ist der Tod! Da ist sie! Wirf ihn weg, wirf ihn weit weg, wirf ihn in den Fluss, damit sie nie gefunden werden. Er verbrennt seine Hände wie Kohle. (Denkt nach.) So stirbt unsere Schwester. In Gefangenschaft hat jemand Spaß! Es fallen mir nur wenige Dinge ein. Der Fall kam heraus, der andere ist froh: so kopfüber und eilig. Und wie ist das möglich, ohne etwas nachzudenken, ohne etwas zu beurteilen! Wie lange dauert es, in Schwierigkeiten zu geraten! Und da weinst du dein ganzes Leben lang, leidest; Die Knechtschaft wird noch bitterer erscheinen. (Schweigen.) Aber Knechtschaft ist bitter, oh, wie bitter! Wer weint nicht vor ihr! Und vor allem wir Frauen. Hier bin ich jetzt! Ich lebe – ich arbeite, ich sehe keine Lücke für mich! Ja, und ich werde es nicht sehen, wissen Sie! Was als nächstes kommt, ist schlimmer. Und jetzt liegt diese Sünde auf mir. (Denkt nach.) Wenn meine Schwiegermutter nicht gewesen wäre! .. Sie hat mich zerquetscht ... sie hat mir das Haus überdrüssig gemacht; Die Wände sind widerlich. (Schaut nachdenklich auf den Schlüssel.) Wegwerfen? Natürlich musst du aufhören. Und wie kam er in meine Hände? Zur Versuchung, zu meinem Untergang. (Hört zu.) Ah, jemand kommt. Also sank mein Herz. (Versteckt den Schlüssel in seiner Tasche.) Nein! .. Niemand! Dass ich solche Angst hatte! Und sie hat den Schlüssel versteckt ... Nun, wissen Sie, da sollte er sein! Offenbar will es das Schicksal selbst! Aber was für eine Sünde ist das, wenn ich ihn einmal ansehe, zumindest aus der Ferne! Ja, auch wenn ich rede, ist es kein Problem! Aber was ist mit meinem Mann! .. Er selbst wollte es nicht. Ja, vielleicht wird ein solcher Fall in meinem Leben nicht ans Licht kommen. Dann weinen Sie vor sich hin: Es gab einen Fall, aber ich wusste nicht, wie ich ihn verwenden sollte. Warum sage ich, dass ich mich selbst betrüge? Ich muss sterben, um ihn zu sehen. Wem tue ich etwas vor! .. Wirf den Schlüssel! Nein, für nichts! Er gehört jetzt mir... Was auch immer wolle, ich werde Boris sehen! Oh, wenn nur die Nacht früher kommen würde!..
Die Hauptquellen von Katerinas Sprache sind die Volkssprache, die mündliche Volksdichtung und die kirchliche Literatur.
Die tiefe Verbindung ihrer Sprache mit der Volkssprache spiegelt sich in Wortschatz, Bildhaftigkeit und Syntax wider.
Ihre Rede ist voll von verbalen Ausdrücken, Redewendungen der Volkssprache: „Damit ich weder meinen Vater noch meine Mutter sehe“; „hatte keine Seele“; „Beruhige meine Seele“; „Wie lange dauert es, in Schwierigkeiten zu geraten“; „Sünde sein“ im Sinne von Unglück. Aber diese und ähnliche Phraseologieeinheiten werden allgemein verstanden, allgemein verwendet und sind klar. Nur ausnahmsweise finden sich in ihrer Rede morphologisch falsche Formationen: „Du kennst meinen Charakter nicht“; „Dann nach diesem Gespräch.“
Die Bildhaftigkeit ihrer Sprache manifestiert sich in der Fülle verbaler und visueller Mittel, insbesondere Vergleiche. In ihrer Rede gibt es also mehr als zwanzig Vergleiche und in allen anderen auch Schauspieler Die Stücke zusammengenommen liegen etwas über diesem Betrag. Gleichzeitig sind ihre Vergleiche weit verbreitet, Volkscharakter: „Es ist, als würde mich eine Taube gurren“, „Es ist, als ob eine Taube gurrt“, „Es ist, als wäre ein Berg von meinen Schultern gefallen“, „Es verbrennt meine Hände wie Kohle“.
Katerinas Rede enthält oft Wörter und Phrasen, Motive und Anklänge an Volkspoesie.
Katerina wendet sich an Varvara und sagt: „ Warum machen Leute nicht wie Vögel fliegen? ..“ - usw.
In ihrer Sehnsucht nach Boris sagt Katerina im vorletzten Monolog: „Warum sollte ich jetzt leben, nun ja, warum?“ Ich brauche nichts, nichts ist nett zu mir und das Licht Gottes ist nicht nett!
Hier gibt es Phraseologiewendungen mit volksumgangssprachlichem und volksliedartigem Charakter. So zum Beispiel in der Montage Volkslieder, herausgegeben von Sobolevsky, lesen wir:
Auf keinen Fall ist es unmöglich, ohne einen lieben Freund zu leben ...
Ich werde mich erinnern, ich werde mich an das freundliche, nicht nette Mädchen erinnern weißes Licht,
Nicht schön, kein schönes weißes Licht ... Ich gehe vom Berg in den dunklen Wald ...
Rede Phraseologisches Gewitter Ostrowski
Bei einem Date mit Boris ruft Katerina aus: „Warum bist du gekommen, mein Zerstörer?“ Bei einer volkstümlichen Hochzeitszeremonie begrüßt die Braut den Bräutigam mit den Worten: „Hier kommt mein Zerstörer.“
Im letzten Monolog sagt Katerina: „Im Grab ist es besser ... Unter dem Baum ist ein Grab ... wie gut ... Die Sonne wärmt sie, benetzt sie mit Regen ... im Frühling wächst Gras.“ darauf, so weich ... Vögel werden zum Baum fliegen, sie werden singen, sie werden Kinder hervorbringen, Blumen werden blühen: gelbe, rote, blaue ... ".
Hier stammt alles aus der Volksdichtung: Diminutiv-Suffix-Vokabular, Wendungen, Bilder.
Für diesen Teil des Monologs in der mündlichen Poesie gibt es auch zahlreiche direkte Textilkorrespondenzen. Zum Beispiel:
... Sie werden mit einem Eichenbrett abgedeckt
Ja, sie werden ins Grab gesenkt
Und mit feuchter Erde bedeckt.
Mein Grab überwuchern
Du bist Ameisengras,
Noch mehr scharlachrote Blumen!
Neben der Volkssprache und der Gestaltung der Volksdichtung in der Sprache Katerinas hatte, wie bereits erwähnt, die kirchliche Literatur einen großen Einfluss.
„Unser Haus“, sagt sie, „war voller Wanderer und Pilger. Und wir kommen aus der Kirche, setzen uns zur Arbeit ... und die Wanderer werden anfangen zu erzählen, wo sie waren, was sie gesehen haben, verschiedene Leben, oder sie singen Gedichte “(gest. 1, yavl. 7).
Katerina verfügt über einen relativ reichen Wortschatz, spricht frei und stützt sich dabei auf verschiedene und psychologisch sehr tiefgreifende Vergleiche. Ihre Rede ist fließend. Solche Wörter und Sätze sind ihr also nicht fremd literarische Sprache wie: ein Traum, natürlich Gedanken, als ob das alles in einer Sekunde passierte, etwas so Ungewöhnliches in mir.
Im ersten Monolog spricht Katerina über ihre Träume: „Was für Träume ich hatte, Varenka, was für Träume! Oder goldene Tempel oder irgendwelche außergewöhnlichen Gärten, und jeder singt mit unsichtbaren Stimmen, und es riecht nach Zypressen, Bergen und Bäumen, als ob es nicht dasselbe wäre wie sonst, sondern so, wie es auf den Bildern geschrieben steht.
Diese Träume sind sowohl inhaltlich als auch in der verbalen Ausdrucksform zweifellos von spirituellen Versen inspiriert.
Katerinas Rede ist nicht nur lexikalisch-phraseologisch, sondern auch syntaktisch originell. Es besteht hauptsächlich aus einfachen und zusammengesetzten Sätzen mit Prädikaten am Ende des Satzes: „So wird die Zeit bis zum Mittagessen vergehen.“ Hier schliefen die alten Frauen ein und legten sich hin, und ich ging im Garten spazieren … Es war so gut“ (gest. 1, yavl. 7).
Am häufigsten verbindet Katerina, wie es für die Syntax der Volkssprache typisch ist, Sätze durch Konjunktionen a und ja. „Und wir werden aus der Kirche kommen ... und die Wanderer werden anfangen zu erzählen ... Sonst ist es, als würde ich fliegen ... Und was für Träume ich hatte.“
Katerinas schwebende Rede nimmt manchmal den Charakter einer Volksklage an: „Oh, mein Unglück, Unglück! (weint) Wohin kann ich, armes Ding, gehen? An wen kann ich mich klammern?"
Katerinas Rede ist zutiefst emotional, lyrisch aufrichtig und poetisch. Um ihrer Rede emotionale und poetische Ausdruckskraft zu verleihen, werden auch Diminutivsuffixe verwendet, die der Volkssprache so innewohnen (Schlüssel, Wasser, Kinder, Grab, Regen, Gras) und verstärkende Partikel („Wie hat er Mitleid mit mir gehabt? Welche Worte haben es getan?“) sagt er?“ ) und Interjektionen („Oh, wie sehr ich ihn vermisse!“).
Die lyrische Aufrichtigkeit und Poesie von Katerinas Rede wird durch Beinamen verliehen, die nach definierten Wörtern stehen (goldene Tempel, ungewöhnliche Gärten, mit bösen Gedanken) und Wiederholungen, die für die mündliche Poesie des Volkes so charakteristisch sind.
Ostrovsky offenbart in Katerinas Rede nicht nur ihre leidenschaftliche, zärtlich poetische Natur, sondern auch ihre Willenskraft. Willensstarke Stärke und Entschlossenheit von Katerina werden ausgelöst syntaktische Konstruktionen stark durchsetzungsfähig oder negativ.