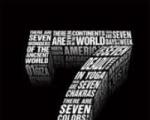Der Aufsatz „Der Dialog zwischen Tschitschikow und Iwan Antonowitsch in der Zivilkammer ist ein Thema der Bürokratie.“ Vergleich von Chichikovs Rede im Werk N
N. Sadur. „Bruder Tschitschikow“. Schauspielhaus Omsk.
Regisseur Sergei Steblyuk, Künstler Igor Kapitanov
„Bruder Chichikov“ des Omsker Dramas erwies sich vom Anfang bis (fast) bis zum Ende als aufregend interessant, spektakulär hell und spannend. Diese großformatige Performance verfügt in jeder Hinsicht über eine klare und leicht wahrnehmbare räumlich-zeitliche Komposition, eine einfache und verständliche Ereignislogik. Ich stelle übrigens fest, dass „Bruder Chichikov“ für mich das zweite Treffen mit der Regie von S. Steblyuk ist, und ich traf sie in der großartigen Aufführung des Jekaterinburger Theaters „Volchonka“ „Ein Monat im Dorf“. Aber dort wurde die psychologisch subtile und warme Welt von Turgenjews Stück auf engstem Raum verkörpert, den man eher bedingt als Bühne bezeichnen kann – direkt vor drei Dutzend Zuschauern. In Omsk arbeitete Steblyuk in einem ganz anderen Maßstab: gießen und zahlreiche Zuschauer folgten dem klaren und präzisen Denken des Regisseurs, ebenso wie dem Bühnenbild von Igor Kapitanov, modern in seinem ausdrucksstarken Minimalismus (mehrere „Objekte“, die sich gegenseitig ersetzten: eine Kronleuchterblume, die wächst und sich vor unseren Augen öffnet, eine Britzka, die an Kabeln hängt und schwankt , eine mehrfarbige Zwischendecke, die manchmal wie ein Zelt über den Figuren thront, manchmal herabsteigt und sie bedeckt). Die musikalische Untermalung der Aufführung ist ebenso genau (Marina Shmotova). Mit anderen Worten: Wir haben es mit künstlerisch begründeter, wirklich professioneller Technik zu tun.
Aber dieses hier guter Sinn Rationale und für den Betrachter verständliche Technologie erzeugt, wie es in der echten Kunst sein sollte, mehrdimensionale bildliche Bedeutungen, die nicht einer einzeiligen Interpretation zugänglich sind, nicht auf flache rationale Formeln reduziert werden können und buchstäblich nach Kant „einen Grund dafür“ ergeben viel denken." Und nicht weniger wichtig: Diese Technologie erzeugt und strahlt eine komplexe, wirbelnde, emotionale Atmosphäre aus, die jeden Punkt des künstlerischen Raums und der künstlerischen Zeit ausfüllt, pulsierende und aufregende, faszinierende und aufregende spirituelle und emotionale Spannung – den „Nerv“ der Aufführung. Es ist ebenso schwierig, über diesen Fokus und das Geheimnis der Kunst von „Bruder Chichikov“ zu sprechen und zu schreiben wie über einen bestimmten Geruch und Geschmack, ein Phantom des Bewusstseins oder eine direkt erlebte „Substanz der Existenz“.
…Kalte Nacht im virtuellen Italien. Tschitschikow erstarrt vor dem leicht geöffneten Vorhang und versucht vergeblich, sich in Zeitungen zu wickeln. Die Farbe der Szene bei Nacht, leicht beleuchtet durch Mondlichtreflexionen, ist die Farbe des Mysteriums. Sie befindet sich nicht nur in einer besonderen Beleuchtung, sondern auch in zwei Bewegungen, die gegeneinander klopfen, um nicht zu frieren, aber trotzdem die weiblichen Beine in Stiefeln einfrieren. In dieser Nacht mit ihrer eindringlichen Kälte und Chichikovs Unbehagen und in diesen schönen, anmutig eiskalten Beinen, die ungeduldige Weiblichkeit und Charme ausstrahlen und – dessen sind wir uns bereits sicher – die für uns bisher unsichtbare Schönheit und Bedeutung ihres Besitzers versprechen, - In all dem zaubert die Kunst bereits, es lebt bereits eine aufregende Vorahnung von Handlung, Intrige, Abenteuer *.
* Auf der Bühne steht zu dieser Zeit ein weiterer junger Mann namens „Someone“ – offenbar der Dämon des Helden, der anschließend für lange Zeit als unnötig verschwindet, da unter anderem die dämonischen Funktionen vom Fremden übernommen werden .

V. Meisinger (Chichikov), M. Kroitor (Fremder).
Foto von A. Kudryavtsev
Dann folgt Chichikovs Treffen mit dem Fremden, ihr Versuch, Pavel Ivanovich und seinen unbeholfenen Widerstand zu „verführen“, und ihre seltsame Absprache. Auch in all dem steckt viel beunruhigende Ungewissheit, faszinierende Zurückhaltung, seltsam anziehende Geheimnisse. Die erste Szene zeigt Tschitschikow (Vladimir Meisinger) und die schöne Fremde (Marina Kroitor), die Gitarre und Geige spielt Schlüsselwert für die gesamte Aufführung. Und das nicht nur, weil darin die Idee (in modernen Begriffen - das Projekt) der „toten Seelen“ geboren wird. Von nun an wird der Fremde immer neben Chichikov sein und ihr Duett-Dialog wird zum lyrischen Zentrum der Aufführung. Die innere Welt des Helden kleiner Mann mit großen Ambitionen, hin- und hergerissen zwischen Gott und dem Mammon, zwischen Gewissen und dem Durst nach Wohlstand und Reichtum, zwischen Liebe-Mitleid für das Mutterland und Verachtung dafür und schließlich zwischen den Lebenden und den Toten – wird uns in offenbart dies bis zur Erschöpfung unvermeidlich und zugleich für ihn notwendiger und gewünschter Dialog. Gleichzeitig erlangt Tschitschikow in der Aufführung eine physiognomische und verhaltensbezogene Konkretheit betritt einen Mann im Fleisch in ein anderes verwandelt - die "epische" Hypostase der Aufführung, wird unser Führer in die Welt der toten und lebendigen Gogol-Typen werden. Der Fremde, der für alle außer Tschitschikow unsichtbar ist, wird für uns seine seltsame Vision und ein Rätsel bleiben: Wir, das Publikum, werden bis zum Schluss von der Frage gequält, wer sie ist. Und wir können keine definitive Antwort finden. Denn in der wundervollen Performance von Marina Kroitor Stranger ist diese Phantomfrau real und fantastisch zugleich, sie ist sowohl die Traumliebe des Helden, das Bild des „Ewig Weiblichen“ als auch die „ausreißerische Seele“ – die Verkörperung davon tragische weibliche Einsamkeit und Unruhe und eine Vampirfrau, die nach Tschitschikows Blut dürstet, aber sie ist auch das Alter Ego des Helden, eine fantastische nächtliche Materialisierung seines „Unbewussten“, seiner gierigen irdischen Wünsche und seines Gewissens, Provokateurin und Verführerin und urteile in einem Menschen, seine Stärke und Schwäche, sein Adel und seine Gemeinheit, sein innerstes Geheimnis ein Spiegel, manchmal liebevoll, manchmal hassend und verachtend für den, der sich darin widerspiegelt.
In den Dialogen zwischen Tschitschikow und dem Fremden, dem Geliebten und Schmerzhaften Gogol-Thema Mutterland, Russland und Russisches Leben, zusammen mit dem Helden gesehen, wird sich in unseren Seelen und Gedanken niederlassen (sitzen), verschmolzen und verlötet mit einer bitteren, aber allem eine besondere Bedeutung (und scheinbar ewigen) gebenden Frage: Wer, Rus, hat sie so bespritzt? ? Und mit seinem (und unserem) Gefühl, dass Rus während der gesamten Aufführung durchging: „kühl, kühl durch und durch.“
Die erste Szene mit dem Fremden ist daher die wahre semantische Quelle von Steblyuks Auftritt. Es enthält aber auch seinen künstlerisch-sprachlichen, stilistischen „Genotyp“ – die Matrix der Art und Weise des Autors, die Welt auf der Bühne zu sehen, zu bauen, sie und mit ihr zu spielen. In dieser Welt verwandeln sich das Ernste und das Tragische auf natürliche Weise in urkomisch Komisches, Karnevalshaftes, Farce und umgekehrt, das Plausible und das Fantastische (sogar Phantasmagorische) gehen ineinander über, Psychologismus und Lyrik werden frei mit bizarrer Übertreibung und Groteske kombiniert. In der allerersten Szene nach Neznakomkins hysterischem Beichtstuhl „Ich habe es satt zu singen“ und Chichikovs – als Reaktion darauf – Versuchen, sich als „italienischer Gondoliere“ auszugeben, ziehen die Charaktere gemeinsam das gewagte russische „Marusya, eins-zwei“ in die Länge -drei ...“, die hinter einem leicht hochgezogenen Vorhang durch Tänze des italienischen Karnevals ersetzt wird. Chichikovs ersten Enthüllungen wiederum geht ein völlig groteskes Detail voraus: Ein Fremder zieht Seile mit Dessous aus Pavlushas Busen, was Chichikovs aufrichtiges: „Ich versuche es für meine zukünftige Frau und meine Kinder“ offensichtlich komisch reduziert.
Steblyuks gesamte Performance ist mit solch spielerischen Konjugationen und „Ambivalenzen“ ästhetisch polarer Prinzipien „gefüttert“: Sie befinden sich in Einzelbildern (fast alle, angefangen bei Tschitschikow selbst), in paarweise agierenden Ensembles und in der Lösung kollektiver (Gruppen-)Szenen. Neben den ganz spezifischen, ein Gesicht und einen Namen habenden Bauern (an die man sich auch wegen ihrer großartigen schauspielerischen Leistung erinnert – „an die Spitze“ dieser Gruppe würde ich das hervorragende Werk von Vladimir Devyatkov stellen – Träume von Rom und der Hochzeit des rothaarigen Selifan, Chichikovs Sancho Panza) leben in dem Stück, das den Helden unerbittlich verfolgt, gesichtslose, nicht unterscheidbar identische „tote Menschen“ – Geistermenschen, Menschensymbole des von Chichikov angeeigneten Königreichs der toten Seelen, einleitend eine Note von mystischer Horror und wiederum höllische Kälte in die Atmosphäre der Aufführung. Im Finale arrangieren sie einen einheitlichen Sabbat im zerrissenen und verdunkelten Bewusstsein des liebsten Pawel Iwanowitsch – einen Sabbat, der den endgültigen Sieg der Toten über die Lebenden und den Zusammenbruch, den Zerfall der Persönlichkeit und die freiwillige Unterwerfung unter den Fetisch der Bereicherung markiert .
Doch zunächst wird uns Tschitschikow in Begleitung des Fremden und der „Toten“ die Phantasmagorie des russischen Provinzlebens offenbaren, deren konkrete historische Merkmale für die Autoren konventionell und im Allgemeinen von geringem Interesse sind, aber es ist so ihre grotesk verrückte Irrealität, die wirklich wesentlich und real ist.
Das ist die Parade der Omsker Truppe. Hier kann man von kleinen Rollen nicht sagen: „zweiter Plan“. Kifa Mokievich Yuri Muzychenko, Plyushkinskaya Mavra Elizaveta Romanenko, feminin-sanfter und „philosophischer“ Gouverneur Moisei Vasiliadi mit Stickereien und einem Stuhl auf dem Rücksitz und die Tochter des Gouverneurs – die lebhafte Ulinka Anna Khodyun, fechtscharf wie immer, urkomische „drei Russen“. Bauern“ Vladimir Avramenko, Nikolai Mikhalevsky und Vladimir Puzyrnikov – sie alle stehen nur für ein paar kurze Momente auf der Bühne, aber jedes Bild ist innerlich und äußerlich völlig vollständig, hell und saftig. Jedes ist ein vollwertiges und an sich wertvolles „Stück“ des allgemeinen karnevalsgrotesken Elements der Aufführung, in jedem von ihnen das Generalthema der paradoxen russischen Symbiose von Lebenden und Toten, Reichtum und Armut, Realität und Fantasie zittert auf seine Art.
Und natürlich die virtuosen Solisten der „Hausherren“, die der „gespenstischen“ Gogol-Realität Vollblut und die unveränderliche Überzeugungskraft irdischer Lebensexistenz verleihen und in ihr ebenso organisch und zugleich die Realität der Realität suchen und entlarven unglaublich, mehr als seltsam, „unmöglich“. Die Fantasie des Regisseurs und der mit ihm beteiligten Schauspieler ist kulturell: Er kennt und erinnert sich an die ursprüngliche Quelle und Tradition; durchdringend: hinter dem scheinbar anhaltenden Spott des Tons - eine ernste, enge und, wie bei Gogol selbst, liebevoll mitfühlende Haltung gegenüber der Figur, intensive Reflexion über ihn.
Und doch haben wir unsere alten Bekannten, die Gogol-Grundbesitzer, noch nie so gesehen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die weitgehend unerwarteten Kostüme von Fagilya Selskaya und die Plastizität von Nikolai Reutov, die der Entscheidung des Generaldirektors entsprechen. Und hier sind sie, allen aus der Schulzeit bekannt und noch nie zuvor gesehen: Manilov, Sobakevich, Plyushkin, Nozdrev, Korobochka.
Oleg Teploukhovs Manilov ist ein kleiner rothaariger Clown, der Jacques Paganel wahnsinnig ähnlich ist, enthusiastisch und traurig, schüchtern und zitternd, in einem weißen Umhang, mit bemalten Wangen, mit Schleppen unter einem Panamahut (später wird Manilov ihn zusammen mit Schleppen abnehmen). ) und ein absurder Regenschirm. Er drückt seine subtilen spirituellen Themen mit Tanz aus (und Yulia Pelevinas begeisterte Frau ist nur eine Ballerina-Puppe in Tutu, Rüschenhose und Turban). Soschtschenkos – erinnerst du dich? - es hieß: "Er ist kein Intellektueller, sondern mit Brille", Manilov ist genau das Gegenteil - er ist auch ein Intellektueller mit Brille. Genauer gesagt natürlich eine Parodie auf ihn. Teploukhov fügt der klassischen, zuckersüßen Höflichkeit und Liebe von Manilov unerwartet innere Einsamkeit, Verlorenheit, tiefe, lebenslange Angst hinzu, Verträumtheit fügt Teploukhov unerwartet hinzu (über tote Seelen – im Flüsterton, eine Liebeserklärung an Tschitschikow – mit einem Regenschirm auf dem Boden). ). Und - demütiger Gehorsam bis zum Tod in Manilovka. Süße, dünne tote Seele.
Sobakevich Sergei Volkov ist jung, groß und selbstbewusst scharfsinnig. Glänzende Stiefel, schwarze Hosen und ein Hemd mit weißem Muster, eine Mütze – auf seine Art (und unerwartet) elegant. Kein traditioneller korrodierter Bär, sondern ein gepflegter, erfolgreicher Offizier im Ruhestand. Darüber hinaus ein glühender antiwestlicher Patriot. Zwar ist Sobakevich im Gegensatz zu anderen Grundbesitzern immer noch eher ein Rahmen, eine Kontur, die Wolkow noch ausfüllen muss. Spezielles Leben- Überlege dir eine „Geschichte“ deines Helden.
Plyushkin wird von Evgeny Smirnov gespielt. Und wie immer bei diesem herausragenden Schauspieler keine einzige „Anpassung“, nicht die kleinste Naht oder Flicken. So wie Smirnows Plyushkin die Welt mit größter Sorgfalt und Freude durch ein farbiges Stück Glas untersucht und sich, nachdem er fast alles verloren hat, mit Appetit an die Details seines früheren Lebens erinnert („Ich habe eine Pflaume gegessen ...“ – das muss man hören ), nimmt liebevoll etwas auf, was sonst noch übrig ist – so genießt der Schauspieler selbst mit Appetit, Vergnügen und Liebe jeden Moment, jeden Schritt und jede Geste, jede Reaktion und jedes Wort seines unglücklichen Helden. Wie dieser Plyushkin, der wie eine Frau aussieht, in Fetzen und Windungen, Gefallen an jeder Flasche oder jedem Glas findet, das auseinanderfällt, wie er jedes Loch in einem alten undichten Eimer schätzt und wie er seine arme Welt durch und durch bewundert ein Glas: „Die Welt spielt so ...“! Und siehe da, die einzige umgekehrte Metamorphose für „Bruder Tschitschikow“ findet statt: Armut wird Reichtum, Tote werden lebendig. Und wir wiederum bewundern den Schauspieler und wollen nicht, dass seine Rolle endet. Meisterwerk, ein Wort!
Nozdrev Valeria Alekseeva ist eine verrückte zaporozhische Kosakin (und entsprechend gekleidet), betrunken vom ewigen Kriegsspiel. „Chapaev“ mit gezogenem Säbel: Drehen Sie sich versehentlich unter seinem Arm - er wird hacken und schießen, zögern Sie nicht. Und die Reden sind angemessen, verrückt. Und plötzlich, in diesem wahnhaften Strom militärischer Befehle und Berichte, eine unerwartete und beängstigende Wahrheit: „Rus‘ zitterte, Bruder Tschitschikow.“ Und danach scheint es absurd, aber aus irgendeinem Grund auch wahr: „In Russland ist niemand mehr übrig, schreit wenigstens.“ Und für einen Moment wird es traurig und unheimlich. Dies ist aus Nozdrevs leerem Lehrbuch ...
Und „unter dem Vorhang“ – eine unerwartete Schachtel Valeria Prokop im Spitzennachthemd und Filzstiefeln. Mit Verspieltheit, Koketterie, einer offenen Anspielung auf die Untoten und der auf das „Opfer“ wartenden Sexualität. Und gleichzeitig, wie erwartet, schüchtern, misstrauisch, abergläubisch. Gogol-artig, detailliert, diesseitig, aber auch in etwas anderes verwickelt, auf der anderen Seite ... Hier, auf Korobochkas Bett, klingelt eine seltsam-geheimnisvolle Glocke. Oder kommt es nur mir und Chichikov so vor?
In der Zwischenzeit wird alles um uns herum irgendwie seltsam. Und die Musik auch. Und Puschkins „Demons“-Sound. Und Chichikovs Traum oder sein Delirium beginnt – mit einem Wort: Teufelei. Das Stück läuft Bis zum Finale dauert es, muss ich sagen, unverhältnismäßig lange – zum ersten und einzigen Mal sackt es ab, bricht und ermüdet die zuvor schlanke künstlerische Konstruktion.
Und was ist übrigens mit Tschitschikow? Es ist Zeit, über ihn zu sprechen. Meiner Meinung nach hat Vladimir Meisinger diese schwierige (nicht nur geistig, sondern auch körperlich – der gesamte Auftritt auf der Bühne), facettenreiche Rolle hervorragend gemeistert. Chichikov ist zunächst einmal sogar äußerlich neu und frisch: Der Betrachter vergisst schnell den „Klassiker“, Mkhatov Chichikov – einen Beamten mittleren Alters mit Bauch und Koteletten. In Omsk ist er jung, romantisch und gutaussehend wie Meisinger, und Meisinger ist wie nie zuvor energisch, leicht, ungestüm, selbstbewusst. Zweitens hatte der uns bekannte theatralische Tschitschikow kein Innenleben. Meisinger spielt natürlich Chichikov – einen Reisenden, Gast und Gesprächspartner, Intrigant und Jäger tote Seelen, spielt gleichzeitig und spielt tatsächlich stark eine andere und viel komplexere „Aufführung innerhalb einer Aufführung“: die Geschichte von Tschitschikow, das Schicksal seines Bewusstseins, zerrissen von Widersprüchen, ruhelos im kalten Schrecken des Lebens und in der Schrecken einer tragischen Entscheidung. Und wenn in der ersten, wie bereits erwähnt, epischen Darbietung von Meisinger-Chichikov zunächst ein korrekter und intelligenter Spiegel anderer ist, dann ist er in der zweiten, lyrischen Darbietung sowohl der Weg als auch der fast mystische Sprung nach vorne es und die wahnsinnige Kälte und der Schrecken des russischen Lebens und vor allem „eine Million Qualen“ und die Tragödie einer falschen Wahl, ein schmerzhafter und erfolgloser Versuch, das Unvereinbare zu verbinden und moralische Selbstrechtfertigung und innere Harmonie zu finden.
... Eines Abends saßen wir in Omsk mit Oleg Semenovich Loevsky zusammen und stöberten in unserer Erinnerung, welches Stück wir für die Aufführung in einem Omsker Theater über das, was jetzt mit Russland und dem russischen Volk geschieht, empfehlen könnten. Sie haben es natürlich nicht gefunden, denn leider hat noch niemand solche Stücke geschrieben. Doch schon zu Hause, in Jekaterinburg, wurde mir plötzlich klar, dass es Sergei Steblyuk und dem Omsker Drama im Gegensatz zu Loevsky und mir gelungen war, ein solches Stück zu finden.
Dialog zwischen Chichikov und Ivan Antonovich in der Zivilkammer: das Thema Bürokratie.
(Basierend auf dem Gedicht von N.V. Gogol „Dead Souls“)
Chichikovs Dialog mit Iwan Antonowitsch in der Zivilkammer wird im siebten Kapitel von Nikolai Wassiljewitsch Gogols Gedicht „Tote Seelen“ beschrieben.
Nachdem Chichikov eine Geschäftsreise zu den umliegenden Grundbesitzern erfolgreich abgeschlossen hat, macht er sich in bester Stimmung an die Erstellung der Kaufunterlagen. Nachdem er zur Zivilkammer gegangen war, um Kaufmannsfestungen zu errichten – so hießen die Dokumente, die den Kauf der Bauern bestätigten – traf sich Tschitschikow zunächst mit Manilow. Gemeinsam und gegenseitig unterstützend gehen sie auf die Station.
Dort ist Tschitschikow, wie sich herausstellte, mit der ihm vertrauten Bürokratie konfrontiert, deren Zweck darin besteht, vom Besucher für jede ihm zustehende Dienstleistung eine Art Geldbestechung, also eine Bestechung, zu erpressen. Nach langen Verhören erfährt Tschitschikow, dass ein gewisser Iwan Antonowitsch in Angelegenheiten „in den Festungen“ verwickelt ist.
„Chichikov und Manilov gingen zu Ivan Antonovich. Iwan Antonowitsch hatte bereits ein Auge zurückgedreht und von der Seite auf sie geblickt, aber im selben Moment stürzte er sich noch aufmerksamer ins Schreiben.
Erlauben Sie mir, nachzufragen, - sagte Tschitschikow mit einer Verbeugung, - gibt es hier einen Festungstisch?
Iwan Antonowitsch schien nichts gehört zu haben und war völlig in die Zeitungen vertieft, ohne etwas zu antworten. Plötzlich war klar, dass er bereits ein besonnener Mann war und nicht wie ein junger Schwätzer und Helikopter-Tänzer. Iwan Antonowitsch schien weit über vierzig Jahre alt zu sein; sein Haar war schwarz und dicht; die ganze Mitte seines Gesichts ragte nach vorne und ging in seine Nase hinein – mit einem Wort, es war dieses Gesicht, das in der Herberge Krugschnauze genannt wird.
Darf ich fragen, gibt es hier eine Festungsexpedition? sagte Tschitschikow.
„Hier“, sagte Iwan Antonowitsch, drehte seine Krugschnauze und nahm einen Zug, um erneut zu schreiben.
Und hier ist mein Geschäft: Ich habe Bauern von verschiedenen Eigentümern des örtlichen Bezirks gekauft, um die Schlussfolgerung zu ziehen: Es gibt einen Kaufvertrag, es muss noch erledigt werden.
Gibt es Verkäufer?
Einige sind hier, andere sind Vollmachten.
Haben Sie eine Anfrage erhalten?
Er brachte auch eine Anfrage. Ich würde gerne... ich muss mich beeilen... warum also nicht zum Beispiel die Arbeit noch heute erledigen?
Ja heute! Heute ist es unmöglich, - sagte Iwan Antonowitsch. - Wir müssen noch mehr nachfragen, gibt es noch weitere Verbote ...“
Tschitschikow spürt, dass der bürokratische Aufwand zunimmt, und hofft, die Angelegenheit zu beschleunigen und unnötige Kosten zu vermeiden, indem er auf eine gute Bekanntschaft mit dem Vorsitzenden der Kammer verweist: „... Iwan Grigorjewitsch, Vorsitzender, ist ein großer Freund von mir ...“
„- Nun, Ivan Grigorjewitsch ist nicht allein; es gibt noch andere, - sagte Iwan Antonowitsch streng.
Tschitschikow verstand die Panne, die Iwan Antonowitsch gelöst hatte, und sagte:
Andere werden auch nicht beleidigt sein, ich selbst habe gedient, ich kenne die Sache ...
Gehen Sie zu Iwan Grigorjewitsch, - sagte Iwan Antonowitsch mit etwas sanfterer Stimme, - lassen Sie ihn einen Befehl erteilen, wem er soll, aber die Sache wird uns nicht durchstehen.
Tschitschikow holte ein Blatt Papier aus der Tasche und legte es Iwan Antonowitsch vor, was er überhaupt nicht bemerkte, und bedeckte es sofort mit einem Buch. Tschitschikow wollte ihn gerade darauf aufmerksam machen, aber Iwan Antonowitsch deutete mit einer Kopfbewegung an, dass es nicht nötig sei, es zu zeigen.
Hier führt er Sie in die Gegenwart! - sagte Iwan Antonowitsch und nickte mit dem Kopf, und einer der Priester, die direkt dort waren, brachte Themis mit solchem Eifer Opfer, dass beide Ärmel an den Ellbogen platzten und das Futter lange herauskletterte, wofür er ein Kollegiat erhielt Der damalige Standesbeamte bediente unsere Freunde, wie einst Virgil Dante, und führte sie in den Anwesenheitsraum, wo es nur breite Stühle gab und in ihnen, vor dem Tisch, hinter einem Spiegel und zwei dicken Büchern, der Vorsitzende saß allein, wie die Sonne. An diesem Ort verspürte der neue Vergil eine solche Ehrfurcht, dass er es nicht wagte, seinen Fuß dorthin zu setzen, und sich umdrehte und seinen Rücken zeigte, abgenutzt wie eine Matte, an der irgendwo eine Hühnerfeder klebte.
Im Büro des Vorsitzenden befindet sich auch Sobakewitsch, von dem Iwan Grigorjewitsch bereits über die Ankunft Tschitschikows informiert wurde. „Der Vorsitzende nahm Tschitschikow in die Arme“, und alles lief wie am Schnürchen. Der Vorsitzende gratuliert ihm zum Kauf und verspricht, alles an einem Tag abzuschließen. Der Kauf von Festungen erfolgt für Tschitschikow sehr schnell und mit minimalem Aufwand. „Selbst der Vorsitzende ordnete an, ihm nur die Hälfte des Zollgeldes abzunehmen, und der Rest wurde, wie nicht bekannt ist, auf das Konto eines anderen Antragstellers überwiesen.“
Die Kenntnis der Büroabläufe half Tschitschikow also, seine Angelegenheiten ohne großen Aufwand zu regeln.
Nachdem Chichikov die Grundbesitzer in der Stadt getroffen hatte, erhielt er von jedem von ihnen eine Einladung, das Anwesen zu besichtigen. Die Galerie der Besitzer von „Dead Souls“ wird von Manilov eröffnet. Der Autor gibt gleich zu Beginn des Kapitels eine Beschreibung dieses Charakters. Sein Auftritt machte zunächst einen sehr angenehmen Eindruck, dann Verwirrung und in der dritten Minute „... sagen Sie:“ Der Teufel weiß, was es ist! und geh weg…“ Süße und Sentimentalität, die im Porträt von Manilov hervorgehoben werden, sind die Essenz seines müßigen Lebensstils. Er denkt ständig über etwas nach
Und er träumt, hält sich für einen gebildeten Menschen (in dem Regiment, in dem er gedient hat, galt er als der gebildetste), möchte „irgendeiner Wissenschaft folgen“, obwohl auf seinem Tisch „immer eine Art Buch liegt, mit Lesezeichen versehen.“ vierzehnte Seite, die er nun seit zwei Jahren ununterbrochen liest.“ Manilov schafft fantastische Projekte, eines lächerlicher als das andere, von denen er keine Ahnung hat wahres Leben. Manilov ist ein fruchtloser Träumer. Er träumt von der zärtlichsten Freundschaft mit Tschitschikow, nachdem er erfahren hat, dass „der Souverän ... ihnen Generäle gewähren würde“, er träumt von einem Pavillon mit Säulen und der Aufschrift: „Tempel der einsamen Besinnung“ ... Manilows ganzes Leben ist durch eine Illusion ersetzt. Sogar seine Rede entspricht der Figur: gespickt mit sentimentalen Ausdrücken wie „Maifeiertag“, „Namenstag des Herzens“. Um die Wirtschaft habe er sich nicht gekümmert, „er ist nie aufs Feld gegangen, die Wirtschaft ging irgendwie von alleine.“ Gogol beschreibt die Situation im Haus und bemerkt auch diese Faulheit und Unvollständigkeit in allem: In den Zimmern standen neben guten, teuren Möbeln mit Matten bedeckte Sessel. Der Gutsbesitzer merkt offenbar nicht, wie sein Gut verfällt, seine Gedanken sind weit weg, in schönen, aus der Sicht der Realität absolut unmöglichen Träumen.
Bei Manilov angekommen, trifft Chichikov seine Frau und seine Kinder. Chichikov versteht mit seiner charakteristischen Einsicht sofort das Wesen des Gutsbesitzers und weiß, wie man sich ihm gegenüber verhält. Er wird so süß und liebenswürdig wie Manilov. Lange flehen sie sich an, vorwärts zu gehen und „endlich traten beide Freunde seitlich durch die Tür und drückten sich ein wenig.“
Der gutherzige Manilov mag alles: sowohl die Stadt als auch ihre Bewohner. Pawel Iwanowitsch unterstützt ihn gerne dabei, und sie streuen Höflichkeiten aus, reden über den Gouverneur, den Polizeichef, und „auf diese Weise gingen sie durch fast alle Beamten der Stadt, die sich alle als die würdigsten Leute herausstellten.“ ." Im weiteren Gespräch vergessen beide Gesprächspartner nicht, sich gegenseitig ständig Komplimente zu machen.
Die Bekanntschaft mit Manilovs Kindern überraschte Chichikov ein wenig mit der Extravaganz ihrer Namen, was jedoch noch einmal die verträumte Natur des von der Realität losgelösten Gutsbesitzers bestätigte. Nach dem Abendessen ziehen sich beide Gesprächspartner ins Büro zurück, um sich endlich mit dem Thema zu befassen, für das Tschitschikow in die Provinz gekommen ist. Manilov ist sehr verwirrt, nachdem er Chichikovs Bitte gehört hat.
"- Wie? Entschuldigung ... ich bin etwas schwerhörig, ich habe ein seltsames Wort gehört ...
„Ich nehme an, die Toten zu erwerben, die jedoch gemäß der Revision als lebendig eingestuft wurden“, sagte Tschitschikow.
Manilov ist nicht nur etwas taub, sondern auch zurückgeblieben umgebendes Leben. Sonst wäre er nicht von der „seltsamen“ Kombination zweier Konzepte überrascht gewesen: der Seele und der Toten.
Der Autor verwischt bewusst die Grenzen zwischen Lebenden und Toten, und dieser Gegensatz erhält eine metaphorische Bedeutung. Chichikovs Unternehmen erscheint uns als eine Art Kreuzzug. Es ist, als würde er die Schatten der Toten in verschiedenen Kreisen der Hölle sammeln, um sie zu einem echten, lebendigen Leben zu erwecken. Manilow interessiert sich dafür, ob er mit dem Land die Seelen Tschitschikows kaufen will. „Nein, zum Schluss“, antwortet Tschitschikow. Es ist davon auszugehen, dass Gogol hier den Rückzug aus der Hölle meint. Der Gutsbesitzer, der nicht einmal weiß, wie viele Bauern er getötet hat, macht sich Sorgen, „ob diese Verhandlungen nicht den zivilen Dekreten und weiteren Formen Russlands entsprechen werden“. Wenn es um tote Seelen geht, wird Manilow mit einem zu klugen Minister verglichen. Hier dringt Gogols Ironie sozusagen ungewollt in einen verbotenen Bereich ein. Wenn man Manilov mit einem Minister vergleicht, bedeutet dies, dass dieser sich nicht so sehr von diesem Gutsbesitzer unterscheidet, und „Manilovismus“ ist ein typisches Phänomen. Manilow wird schließlich durch Tschitschikows erbärmliche Tirade über seine Verehrung des Gesetzes beruhigt: „Das Gesetz – ich bin stumm vor dem Gesetz.“ Es stellte sich heraus, dass Manilow, der nichts verstand, diese Worte ausreichte, um sie den Bauern zu geben.
Gogol begann mit der Arbeit an dem Gedicht „Tote Seelen“ und setzte sich zum Ziel, „mindestens eine Seite aller Rus zu zeigen“. Das Gedicht basiert auf einer Handlung über die Abenteuer von Chichikov, einem Beamten, der „tote Seelen“ aufkauft. Eine solche Komposition ermöglichte es dem Autor, über verschiedene Landbesitzer und ihre Dörfer zu sprechen, die Chichikov besucht, um seinen Deal abzuschließen. Laut Gogol folgen uns Helden, „einer vulgärer als der andere“. Wir lernen jeden der Grundbesitzer nur während der Zeit (in der Regel nicht länger als einen Tag) kennen, die Tschitschikow mit ihm verbringt. Aber Gogol wählt eine solche Darstellungsweise, die auf einer Kombination typischer Merkmale mit individuellen Merkmalen basiert und es Ihnen ermöglicht, sich nicht nur ein Bild von einer der Figuren zu machen, sondern auch von der gesamten Schicht russischer Grundbesitzer, die in diesem Helden verkörpert ist.
Chichikov spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Ein Abenteurer-Betrüger kann sich, um sein Ziel – den Kauf „toter Seelen“ – zu erreichen, nicht auf einen oberflächlichen Blick auf die Menschen beschränken: Er muss alle Feinheiten des psychologischen Erscheinungsbildes des Gutsbesitzers kennen, mit dem er ein sehr gutes Geschäft abschließen soll seltsamer Deal. Schließlich kann der Grundbesitzer nur dann seine Zustimmung geben, wenn es Tschitschikow gelingt, ihn durch Drücken der notwendigen Hebel zu überzeugen. In jedem Fall werden sie unterschiedlich sein, weil die Menschen, mit denen Chichikov zu tun hat, unterschiedlich sind. Und in jedem Kapitel verändert sich Chichikov selbst etwas und versucht, dem jeweiligen Gutsbesitzer irgendwie zu ähneln: in seinem Verhalten, seiner Rede und seinen geäußerten Ideen. Dies ist ein sicherer Weg, einen Menschen für sich zu gewinnen und ihn nicht nur dazu zu bringen, ein seltsames, sondern tatsächlich ein kriminelles Geschäft einzugehen, was bedeutet, ein Komplize bei einem Verbrechen zu werden. Deshalb versucht Tschitschikow so sehr, seine wahren Motive zu verbergen, indem er jedem der Grundbesitzer eine Erklärung für die Gründe für sein Interesse angibt. tote Seelen„Was diese Person am besten verstehen kann.“
Somit ist Chichikov in dem Gedicht nicht nur ein Betrüger, seine Rolle ist wichtiger: Der Autor braucht ihn als mächtiges Werkzeug, um andere Charaktere zu testen, ihr Wesen vor neugierigen Blicken zu zeigen und ihre Hauptmerkmale zu enthüllen. Genau das sehen wir in Kapitel 2, das Tschitschikows Besuch im Dorf Manilow gewidmet ist. Das Bild aller Grundstückseigentümer basiert auf demselben Mikrogrundstück. Sein „Frühling“ sind die Taten von Chichikov, dem Käufer „toter Seelen“. Unverzichtbare Teilnehmer in jedem der fünf dieser Mikroplots sind zwei Charaktere: Tschitschikow und der Gutsbesitzer, zu dem er kommt dieser Fall es sind Tschitschikow und Manilow.
In jedem der fünf Kapitel, die den Gutsbesitzern gewidmet sind, baut der Autor die Geschichte als sukzessiven Episodenwechsel auf: Eintritt in das Anwesen, Treffen, Erfrischung, Chichikovs Angebot, ihm „tote Seelen“ zu verkaufen, Abreise. Dabei handelt es sich nicht um gewöhnliche Handlungsepisoden: Es sind nicht die Ereignisse selbst, die für den Autor von Interesse sind, sondern die Möglichkeit, jene objektive Welt rund um die Vermieter zu zeigen, in der die Persönlichkeit jedes einzelnen von ihnen am besten zum Ausdruck kommt; nicht nur Auskunft über den Inhalt des Gesprächs zwischen Tschitschikow und dem Gutsbesitzer zu geben, sondern auch in der Art der Kommunikation jeder der Figuren zu zeigen, was sowohl typische als auch individuelle Züge trägt.
Die Szene des Verkaufs und Kaufs „toter Seelen“, die ich analysieren werde, nimmt in den Kapiteln über jeden der Grundbesitzer einen zentralen Platz ein. Vor ihr kann sich der Leser zusammen mit Chichikov bereits eine gewisse Vorstellung von dem Gutsbesitzer machen, mit dem der Betrüger spricht. Auf der Grundlage dieses Eindrucks baut Chichikov ein Gespräch über „tote Seelen“ auf. Und deshalb hängt sein Erfolg ganz davon ab, wie richtig und vollständig er und damit die Leser es geschafft haben, dies zu verstehen menschlicher Typ mit seinen individuellen Eigenschaften.
Was können wir über Manilov erfahren, bevor Chichikov zum Wichtigsten für ihn übergeht – einem Gespräch über „tote Seelen“?
Das Kapitel über Manilov beginnt mit einer Beschreibung seines Nachlasses. Die Landschaft ist in Grau-Blau-Tönen gestaltet und alles, selbst ein grauer Tag, an dem Tschitschikow Manilow besucht, bereitet uns auf ein Treffen mit einer sehr langweiligen – „grauen“ – Person vor: „Das Dorf Manilow könnte einige anlocken.“ Gogol schreibt über Manilov selbst wie folgt: „Er war ein mittelmäßiger Mann, weder dies noch das; weder in der Stadt Bogdan noch im Dorf Selifan. Wird hier verwendet ganze Zeile Phraseologische Einheiten, als wären sie aneinandergereiht, die uns zusammengenommen den Schluss zulassen, wie leer die sind Innere Manilov, ohne, wie der Autor sagt, irgendeine Art innere „Begeisterung“.
Davon zeugt auch das Porträt des Gutsbesitzers. Manilov scheint zunächst der angenehmste Mensch zu sein: freundlich, gastfreundlich und mäßig desinteressiert. „Er lächelte verführerisch, war blond, mit blaue Augen". Aber der Autor bemerkt nicht umsonst, dass Manilovs „Angenehmheit“ „zu sehr auf Zucker übertragen wurde; In seinem Benehmen und Auftreten lag etwas, das ihn mit seinem Standort und seiner Bekanntschaft sympathisch machte. Solche Süße schlüpft in ihn hinein Familienbeziehungen mit Frau und Kindern. Nicht umsonst beginnt der sensible Chichikov sofort, nachdem er Manilovs Welle gehört hat, seine hübsche Frau und seine ganz gewöhnlichen Kinder zu bewundern, deren „teilweise griechische“ Namen deutlich den Anspruch seines Vaters und seinen ständigen Wunsch verraten, „für den Betrachter zu arbeiten“. “.
Dasselbe gilt auch für alles andere. So wird Manilows Anspruch auf Eleganz und Aufklärung und sein völliges Scheitern durch die Details der Inneneinrichtung seines Zimmers deutlich. Hier gibt es wunderschöne Möbel – und daneben stehen zwei unfertige, mit Matten überzogene Stühle; ein toller Kerzenständer – und daneben „einige nur ein kupferfarbener Invalide, lahm, auf der Seite zusammengerollt und mit Fett bedeckt.“ Alle Leser von Dead Souls erinnern sich natürlich auch an das Buch in Manilovs Büro, „auf der vierzehnten Seite vermerkt, das er zwei Jahre lang gelesen hatte“.
Auch Manilovs berühmte Höflichkeit entpuppt sich als bloße leere Form ohne Inhalt: Denn diese Eigenschaft, die die Kommunikation der Menschen erleichtern und angenehm machen soll, entwickelt sich bei Manilov in ihr Gegenteil. Was ist die Szene, in der Chichikov gezwungen ist, mehrere Minuten vor der Tür zum Wohnzimmer zu stehen, da er versucht, den Besitzer höflich zu übertrumpfen und ihm den Vortritt zu lassen, und infolgedessen beide „die Tür betreten“ haben? seitwärts und drückten sich gegenseitig ein wenig.“ So wird im konkreten Fall die Bemerkung des Autors verwirklicht, dass man über Manilow im ersten Moment nur sagen kann: „Was für ein angenehmer und eine nette Person!“, dann „du sagst nichts, aber beim dritten sagst du: „Der Teufel weiß, was es ist!“ - und weggehen Wenn du nicht wegziehst, wirst du tödliche Langeweile verspüren.“
Aber Manilov selbst hält sich für einen kultivierten, gebildeten und wohlerzogenen Menschen. So sieht er nicht nur Chichikov, der offensichtlich mit aller Kraft versucht, den Geschmack des Besitzers zu befriedigen, sondern auch alle Menschen um ihn herum. Dies geht sehr deutlich aus dem Gespräch mit Tschitschikow über Stadtbeamte hervor. Beide wetteiferten darum, sie zu loben, nannten alle schöne, „nette“, „gütigste“ Menschen, ohne sich darum zu kümmern, ob das der Wahrheit entspricht. Für Tschitschikow ist dies ein schlauer Schachzug, der dazu beiträgt, Manilow für sich zu gewinnen (im Kapitel über Sobakewitsch wird er denselben Beamten sehr wenig schmeichelhafte Eigenschaften verleihen und damit dem Geschmack des Besitzers nachgeben). Manilov stellt im Allgemeinen die Beziehungen zwischen Menschen im Geiste idyllischer Pastoralen dar. Schließlich ist das Leben in seiner Wahrnehmung eine vollständige, perfekte Harmonie. Darauf will Tschitschikow „ausspielen“, um seinen seltsamen Deal mit Manilow abzuschließen.
Aber es gibt noch andere Trumpfkarten in seinem Deck, mit denen Sie den gutherzigen Grundbesitzer leicht „schlagen“ können. Manilov lebt nicht nur in einer Scheinwelt: Schon der Prozess des Fantasierens bereitet ihm wahre Freude. Daher seine Liebe zu schöner Satz und im Allgemeinen auf jede Art von Pose – genau wie in der Szene des Verkaufs und Kaufs von „toten Seelen“ gezeigt, reagiert er auf Chichikovs Vorschlag. Aber das Wichtigste ist, dass Manilov außer leeren Träumen einfach nichts tun kann – schließlich kann man nicht davon ausgehen, dass das Ausschlagen von Rohren und das Aufreihen von Aschehaufen in „schönen Reihen“ eine würdige Beschäftigung für einen ist aufgeklärter Grundbesitzer. Er ist ein sentimentaler Träumer, völlig handlungsunfähig. Kein Wunder, dass sein Nachname zu einem geläufigen Wort geworden ist, das das entsprechende Konzept ausdrückt – „Manilovismus“.
Müßiggang und Müßiggang gingen in das Fleisch und Blut dieses Helden ein und wurden zu einem integralen Bestandteil seiner Natur. Sentimental idyllische Weltvorstellungen, Träume, in die er die meiste Zeit versunken ist, führen dazu, dass seine Wirtschaft ohne große Beteiligung seinerseits „irgendwie von selbst“ läuft und allmählich auseinanderfällt. Alles auf dem Anwesen wird von einem betrügerischen Angestellten verwaltet, und der Besitzer weiß nicht einmal, wie viele Bauern seit der letzten Volkszählung gestorben sind. Um diese Frage von Tschitschikow zu beantworten, muss sich der Gutsbesitzer an den Sachbearbeiter wenden, doch es stellt sich heraus, dass es viele Tote gibt, aber „niemand hat sie gezählt“. Und erst auf dringenden Wunsch Tschitschikows erhält der Sachbearbeiter den Auftrag, sie noch einmal zu lesen und ein „detailliertes Register“ zu erstellen.
Doch der weitere Verlauf des angenehmen Gesprächs versetzt Manilow in völliges Erstaunen. Auf eine völlig logische Frage, warum ein Außenstehender sich so für die Angelegenheiten seines Anwesens interessiert, erhält Manilow eine schockierende Antwort: Tschitschikow ist bereit, Bauern zu kaufen, aber „nicht gerade Bauern“, sondern tote! Es muss zugegeben werden, dass ein solcher Vorschlag nicht nur eine so unpraktische Person wie Manilova, sondern auch jede andere Person entmutigen kann. Nachdem Chichikov seine Aufregung verkraftet hat, stellt er jedoch sofort klar:
„Ich nehme an, die Toten zu erwerben, die jedoch gemäß der Revision als lebendig aufgeführt würden.“
Diese Klarstellung lässt bereits einiges erahnen. Sobakevich zum Beispiel brauchte überhaupt keine Erklärung – er begriff sofort den Kern der illegalen Transaktion. Aber für Manilov, der selbst in den üblichen Angelegenheiten eines Gutsbesitzers nichts versteht, bedeutet das nichts, und sein Erstaunen geht über alle Grenzen hinaus:
„Manilov ließ den Chibouk mit seiner Pfeife sofort auf den Boden fallen, und als er den Mund öffnete, blieb er mehrere Minuten lang mit offenem Mund stehen.“
Chichikov macht eine Pause und beginnt die Offensive. Seine Rechnung ist richtig: Da der Betrüger bereits genau weiß, mit wem er es zu tun hat, weiß er, dass Manilow niemanden glauben lassen wird, dass er als aufgeklärter, gebildeter Gutsbesitzer nicht in der Lage ist, den Kern des Gesprächs zu erfassen. Überzeugt davon, dass er nicht verrückt, aber immer noch derselbe „hervorragend gebildete“ Mensch ist, wie er Tschitschikow verehrt, will der Hausbesitzer „nicht mit dem Gesicht nach unten fallen“, wie es heißt. Aber was kann man zu solch einem wirklich verrückten Vorschlag sagen?
„Manilov war völlig ratlos. Er hatte das Gefühl, dass er etwas tun musste, eine Frage stellen musste, und welche Frage – weiß der Teufel. Am Ende bleibe er „in seinem Repertoire“: „Werden diese Verhandlungen nicht im Widerspruch zu zivilen Dekreten und weiteren Ansichten über Russland stehen?“ fragt er und zeigt ein demonstratives Interesse an Staatsangelegenheiten. Allerdings muss man sagen, dass er im Allgemeinen der einzige Grundbesitzer ist, der in einem Gespräch mit Tschitschikow über „tote Seelen“ an das Gesetz und die Interessen des Landes erinnert. Allerdings nehmen diese Argumente in seinem Mund einen absurden Charakter an, zumal, als er Tschitschikows Antwort hörte: „Oh! Entschuldigung, überhaupt nicht“, beruhigt sich Manilov völlig.
Doch Chichikovs listige Berechnung, die auf einem subtilen Verständnis der inneren Impulse des Handelns des Gesprächspartners beruhte, übertraf sogar alle Erwartungen. Manilov, der glaubt, dass die einzige Form menschlicher Verbindung sensible, zärtliche Freundschaft und herzliche Zuneigung ist, kann sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, seinem neuen Freund Tschitschikow gegenüber Großzügigkeit und Desinteresse zu zeigen. Er ist bereit, es nicht zu verkaufen, sondern ihm ein so ungewöhnliches, aber aus irgendeinem Grund notwendiges „Objekt“ einem Freund zu schenken.
Eine solche Wendung der Ereignisse kam selbst für Tschitschikow unerwartet, und zum ersten Mal während der gesamten Szene enthüllte er ein wenig sein wahres Gesicht:
„So besonnen und vernünftig er auch war, er machte fast sogar einen Sprung nach dem Vorbild einer Ziege, was bekanntlich nur in den stärksten Freudenausbrüchen geschieht.“
Sogar Manilov bemerkte diesen Impuls und „sah ihn einigermaßen verwirrt an“. Aber Tschitschikow, der sich sofort besinnt, nimmt wieder alles selbst in die Hand: Er muss nur seine Dankbarkeit und Dankbarkeit richtig ausdrücken, und der Gastgeber ist bereits „völlig verwirrt, errötet“ und versichert wiederum: „Ich würde es gerne beweisen.“ etwas herzliche Anziehung, Anziehungskraft der Seele. Doch hier bricht eine dissonante Note in eine lange Reihe von Höflichkeiten ein: Es stellt sich heraus, dass für ihn „tote Seelen in gewisser Weise vollkommener Müll sind“.
Nicht umsonst legt Gogol, ein Mann mit tiefem und aufrichtigem Glauben, Manilow diesen blasphemischen Satz in den Mund. Tatsächlich sehen wir in der Person Manilows eine Parodie auf einen aufgeklärten russischen Gutsbesitzer, in dessen Kopf die Phänomene der Kultur und universeller Werte vulgarisiert sind. Ein Teil seiner äußeren Attraktivität im Vergleich zu anderen Grundbesitzern ist nur ein Schein, eine Fata Morgana. In seinem Herzen ist er genauso tot wie sie.
„Das ist kein großer Blödsinn“, erwidert Tschitschikow lebhaft, dem es überhaupt nicht peinlich ist, dass er aus dem Tod von Menschen, menschlichem Unglück und Leid Profit schlagen wird. Darüber hinaus ist er bereits bereit, seine Nöte und Leiden zu beschreiben, die er angeblich ertragen musste, weil er „die Wahrheit bewahrte, sein Gewissen rein war, einer hilflosen Witwe und einem elenden Waisenkind zur Seite stand!“ Nun, hier war Chichikov eindeutig ins Schleudern geraten, fast wie Manilov. Der Leser erfährt nur, was er wirklich erlebt hat „Verfolgung“ und wie er anderen geholfen hat letztes Kapitel, aber es ist für ihn, den Organisator dieses unmoralischen Betrugs, eindeutig nicht angemessen, über das Gewissen zu sprechen.
Aber das alles stört Manilov überhaupt nicht. Nachdem er Chichikov verabschiedet hat, geht er wieder seinem geliebten und einzigen „Geschäft“ nach: Er denkt über das „Wohlbefinden eines freundlichen Lebens“ nach und darüber, wie „es schön wäre, mit einem Freund am Ufer eines Flusses zu leben“. Träume führen ihn immer weiter von der Realität weg, in der ein Betrüger frei durch Russland streift, der die Leichtgläubigkeit und Promiskuität der Menschen, den Mangel an Lust und Fähigkeit, die Angelegenheiten von Menschen wie Manilov zu regeln, ausnutzt und bereit ist, zu täuschen nicht nur sie, sondern auch die Staatskasse „betrügen“.
Die ganze Szene sieht sehr komisch aus, aber es ist „Lachen unter Tränen“. Kein Wunder, dass Gogol Manilow mit einem zu klugen Minister vergleicht:
„... Nachdem Manilow eine Kopfbewegung gemacht hatte, schaute er Chichikov sehr bedeutsam ins Gesicht und zeigte in allen Gesichtszügen und auf seinen zusammengepressten Lippen einen so tiefen Ausdruck, den man vielleicht nicht sah menschliches Gesicht, außer vielleicht bei einem allzu klugen Minister, und selbst dann im Moment des rätselhaftesten Falles.
Hier dringt die Ironie des Autors in die verbotene Sphäre ein – die höchsten Ebenen der Macht. Dies könnte nur bedeuten, dass ein anderer Minister – die Personifizierung der höchsten Staatsmacht – sich nicht so sehr von Manilov unterscheidet und dass „Manilovismus“ eine typische Eigenschaft dieser Welt ist. Es ist schrecklich, wenn es unter der Herrschaft nachlässiger Grundbesitzer ruiniert wird Landwirtschaft, die Grundlage der russischen Wirtschaft des 19. Jahrhunderts, kann von solch unehrlichen, unmoralischen Geschäftsleuten erobert werden neue Ära, als der „Schurken-Erwerber“ Tschitschikow. Aber es ist noch schlimmer, wenn es mit Duldung der Behörden geschieht, denen es nur darum geht äußere Form, über seinen Ruf, alle Macht im Land wird an Leute wie Tschitschikow übergehen. Und Gogol richtet diese gewaltige Warnung nicht nur an seine Zeitgenossen, sondern auch an uns, die Menschen des 21. Jahrhunderts. Seien wir aufmerksam auf das Wort des Schriftstellers und versuchen wir, ohne in Manilovismus zu verfallen, es rechtzeitig zu bemerken und unsere heutigen Tschitschikows aus den Angelegenheiten zu entfernen.
Chichikovs Tricks im Dialog mit Grundbesitzern
© V. V. FROLOV
Gedicht N.V. Gogols „Tote Seelen“ ist äußerst interessant im Hinblick auf die Methoden, mit denen der listige Geschäftsmann Tschitschikow in Dialogen mit Gutsbesitzern über den Kauf toter Seelen sein Ziel erreicht.
Der Zweck eines Geschäftsdialogs (wir beziehen uns auf Chichikovs Gespräche) besteht darin, eine gewinnbringende Lösung des Problems zu erreichen. Von besonderer Bedeutung ist die Kenntnis der Eigenschaften des Gesprächspartners, der Argumentationskunst und der Besitz von Sprachmitteln. In einem solchen Dialog werden spezielle Techniken eingesetzt, um das Ziel zu erreichen. Die Rhetorik definiert sie als „eristische Tricks“, „eristische Argumentation“, da sich der Anwendungsbereich dieser Techniken zunächst auf die Streitsituation beschränkte. In der Antike wurde „Eristik“ (aus dem Griechischen. epsiksh – argumentieren) als Kunst bezeichnet
die Fähigkeit zu argumentieren und dabei alle Methoden anzuwenden, die nur darauf abzielen, den Feind zu besiegen.“ In der Logik gehören dazu Sophismen, in der sprachlichen Pragmatik – Sprachwerkzeuge Einflüsse in der indirekten Kommunikation, Sprachmanipulationen.
Eine Analyse verschiedener Klassifikationen solcher Techniken lässt den Schluss zu, dass sie komplexer Natur sind und in direktem Zusammenhang mit dem Aspekt der Wirkung stehen – logisch, psychologisch oder sprachlich. Der Sophismus, ein logischer Fehler, basiert also auf der Verletzung logischer Gesetze; in der „eristischen Argumentation werden alle Arten von Argumenten verwendet: logische (zur Realität, zur Vernunft) und psychologische (zur Autorität, zur Persönlichkeit)“, die die Gefühle des Gesprächspartners beeinflussen; Im Mittelpunkt der Sprachmanipulationen steht die Nutzung der Möglichkeiten der Sprache zum Zwecke der verdeckten Beeinflussung.
So beziehen wir Sophismen, logische und psychologische Argumente, sprachliche Mittel, Stilfiguren, Intonations- und Stimmmerkmale in den Begriff „Trick“ ein. Der Redner setzt sie bewusst ein, um seine Ziele zu erreichen.
Chichikovs Dialoge mit den Grundbesitzern sind durch und durch von solchen eristischen Absichten durchdrungen. Wir haben versucht, die Arten der verwendeten Tricks konsistent zu beschreiben Protagonist„Tote Seelen“, um den Gesprächspartner zu überzeugen.
Im Dialog mit Manilov versucht er sorgfältig, das Thema seines Interesses zu benennen, indem er dem Begriff „Leben“ Mehrdeutigkeit verleiht: „nicht wirklich lebendig, aber lebendig in Bezug auf die Rechtsform“. Zweifel werden ausgeräumt, indem man sich auf das Gesetz bezieht („Wir werden schreiben, dass sie am Leben sind, wie es in der Revisionsgeschichte wirklich ist“) und auf ein Gewinnargument („Das Finanzministerium wird sogar Vorteile erhalten, weil es Anwaltskosten erhält“). . Unterstützt wird das Argument durch einen Hinweis auf mysteriöse persönliche Umstände, die die Stimmung des Gesprächspartners wecken sollen: „Ich bin es gewohnt, in nichts vom Zivilrecht abzuweichen, obwohl ich dafür im Dienst gelitten habe.“ Manilov ist von Chichikovs selbstbewusstem Ton überzeugt:
„Ich gehe davon aus, dass es gut wird.
Aber wenn es gut ist, ist das eine andere Sache: Ich bin dagegen“, sagte Manilov und beruhigte sich völlig.
Auch der Dialog mit Plyushkin gestaltet sich unprätentiös, aber betont höflich. Vorsicht, die Verwendung eines vage persönlichen Satzes („Mir wurde es jedoch gesagt“), der darauf abzielt, Interesse zu verschleiern. Vorgetäuschtes Mitgefühl und Überraschung, eine Reihe höflicher Fragen helfen dem Helden, die notwendigen Informationen vom Gesprächspartner zu erfahren: „Erzähl es mir! Und hast du viel erschöpft?“ rief Chichikov mit Beteiligung aus „; „Und lassen Sie mich wissen: Wie viel kostet die Zahl?“; „Erlauben Sie mir, noch eine Frage zu stellen …“; „Chichikov bemerkte diese unanständige Gleichgültigkeit gegenüber der Trauer eines anderen, er seufzte sofort und sagte, dass es ihm leid täte.“ Berührt davon erlaubt sich Plyushkin, mit dem Gefühl seiner eigenen Geizigkeit zu spielen: „Beileid in.“
Man kann nicht in die Tasche greifen.“ Tschitschikow „versuchte zu erklären, dass er bereit sei, dies nicht mit leeren Worten, sondern mit Taten zu beweisen, und brachte sofort seine Bereitschaft zum Ausdruck, die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern zu übernehmen.“
In einem Dialog mit Nozdryov helfen weder Selbstvertrauen und Leichtigkeit zu Beginn des Gesprächs („Haben Sie, Tee, viele tote Bauern? Übertragen Sie sie mir“), noch eine Lüge, um das wahre Ziel zu verbergen – Gewichtszunahme Gesellschaft, Ehe, noch ein Versuch, Geld zu verzinsen:
„- ... Wenn du nicht spenden willst, dann verkaufe es.
Verkaufen! Warum, ich kenne dich, du Schurke, willst du nicht teuer dafür bezahlen?
Äh, du bist auch gut! ... warum hast du Diamanten oder was?“
Der Beiname wird in einem ironischen Kontext mit der Absicht verwendet, das Thema Verhandlungen abzuwerten.
Nozdryov überzeugt weder durch den Versuch, sich mit Gier zu beschämen („Erbarme dich, Bruder, was für einen jüdischen Drang hast du!“), noch durch einen Appell an die Pflicht („Du solltest sie mir einfach geben“), indem er die Modalität verwendet der Verpflichtung.
Unwirksam ist der Appell an den gesunden Menschenverstand, tote Seelen als „Unsinn“, „allerlei Unsinn“ zu bezeichnen. Der Dialog, Nozdryovs neuestes Vergnügen, endet mit einer Flut von Beleidigungen.
Korobochkas sinnlose Fragen („Wofür brauchst du sie?“, „Warum sind sie tot“) zwingen Tschitschikow dazu, das Vorteilsargument und das Versprechen auf Hilfe als Trick zu nutzen: „Ich gebe dir Geld dafür.“<.>Ich erspare Ihnen den Ärger und die Bezahlung.<.>und außerdem gebe ich dir fünfzehn Rubel.“ Die Wiederholung des Verbs „Dame“ und der Vereinigung „Ja“ verstärken die Wirkung.
Um das Thema abzuwerten, wurde ein pragmatisches Argument für den Nutzen herangezogen: „Was dürfen sie kosten?“, „Was nützen sie, es nützt nichts“; bewertende Definition: „weil es Staub ist“; ein Appell an den gesunden Menschenverstand anhand von Fakten, Konkretisierung: „Berücksichtigen Sie nur, dass Sie den Gutachter nicht mehr beschmieren müssen“; „Ja, du urteilst nur gut: Schließlich bist du ruiniert“; ein Appell an das Schamgefühl: „Stram, stram, Mutter! Wer wird sie kaufen? Nun, welchen Nutzen kann er daraus machen?“; „Die Toten sind auf dem Bauernhof! Ek, wo haben sie das her! Ist es möglich, Spatzen nachts in Ihrem Garten zu erschrecken, oder was?“ Die Argumentation wird durch Wiederholung („schließlich ist es Staub“, „es ist nur Staub“) und bildliche Antithese gestärkt: „Man nimmt jedes wertlose, letzte Ding, zum Beispiel auch einen einfachen Lappen, und es gibt einen Preis für einen Lappen.“ ...aber das ist für nichts notwendig" ; „Denn jetzt bezahle ich dafür; ich, nicht du<.>Ich übernehme die volle Verantwortung.“
Chichikov versucht, Korobochkas Zweifel mit der Klarheit des Begriffs „Geld“ zu überwinden, indem er eine Analogie zum Prozess der Honigproduktion anwendet. „Ich gebe dir Geld: fünfzehn Rubel in Banknoten. Das ist schließlich Geld. Du wirst sie nicht auf der Straße finden. Nun, gib es zu, für wie viel hast du Honig verkauft?“<.>
Auf der anderen Seite (verstärkende Semantik. - VF) ist das also Schatz. Sie haben es vielleicht ein Jahr lang sorgfältig eingesammelt, sind hingegangen, haben die Bienen getötet und sie den ganzen Winter über im Keller gefüttert; und tote Seelen sind nicht von dieser Welt. Dort bekam man zwölf Rubel für Arbeit, für Fleiß, und hier bekommt man für nichts, für nichts, und nicht zwölf, sondern fünfzehn, und nicht Silber, sondern allesamt blaue Banknoten. „Die Analogie wird durch die Semantik von Vereinigungen, Partikeln, Eine Reihe homogener Konstruktionen Der Held schafft es, Korobochka nur durch eine Lüge zu überzeugen, die ihm zufällig über Regierungsverträge in den Sinn kam.
Der Dialog mit So-bakevich ist außergewöhnlich reich an Tricks und verkörpert einen Geschäftsmanntyp, der Chichikov an List in nichts nachsteht. Der Held beginnt „ganz aus der Ferne“, um die Aufmerksamkeit abzulenken, den Gesprächspartner mit Hilfe von Schmeicheleien und Lob zu gewinnen: „Er berührte den russischen Staat im Allgemeinen und sprach mit großem Lob über seinen Raum.“<.>Seelen, die ihre Karriere abgeschlossen haben, werden den Lebenden gleichgestellt, so dass es bei aller Fairness dieser Maßnahme für viele Eigentümer etwas schmerzhaft sein kann<...>und da er persönlichen Respekt vor ihm empfand, wäre er sogar bereit, diese wirklich schwere Aufgabe teilweise zu übernehmen.
Chichikov definiert das Gesprächsthema sorgfältig: „Er nannte die Seelen in keiner Weise tot, sondern nur nicht existent.“ Sobakevich folgt Chichikovs Gedanken, „in der Erkenntnis, dass der Käufer hier einen gewissen Nutzen haben muss“: „Brauchen Sie tote Seelen? Wenn Sie möchten, bin ich bereit zu verkaufen.“
Chichikov versucht, die Frage des Preises zu umgehen („Das ist so ein Artikel, dass der Preis sogar seltsam ist“; „Wir müssen vergessen haben, woraus der Artikel besteht“) und bietet eine minimale Gebühr an. Sobakewitschs emotionaler Einwand wird durch die Antithese untermauert: „Oh, wo haben sie das her? Schließlich verkaufe ich keine Bastschuhe!“ Chichikov verwirrt ihn mit einem Argument zur Realität: „Aber sie sind auch keine Menschen.“
Um den Preis zu erhöhen, „belebt“ Sobakevich die toten Seelen wieder, indem er die These ersetzt und sie durch einen bildlichen Vergleich und Phraseologieeinheiten untermauert: „Sie glauben also, Sie werden einen solchen Narren finden, der Ihnen eine Revisionseele für zwei Kopeken verkaufen würde.“ ?“ (Gedanken lesen, Einspruch im Voraus. -V.F); „Ein anderer Betrüger wird dich täuschen, er wird dir Müll verkaufen, keine Seelen, aber ich habe wie eine kräftige Nuss, alles steht zur Auswahl: kein Handwerker, sondern ein anderer gesunder Mann.“
Tschitschikow versucht, zum Kern des Themas zurückzukehren: „Das ist schließlich alles.“ tote Menschen <.>Schließlich waren die Seelen längst gestorben, es gab nur einen Klang, der für die Sinne nicht greifbar war. Stützen Sie den Zaun mit einer Leiche, sagt das Sprichwort. „Um die Ausdruckskraft zu erhöhen, verwendet er ein Sprichwort und wiederholt Partikel verstärkender Semantik.“
Sobakevichs neues Argument basiert auf Antithesen, enthält rhetorische Fragen und Ausrufe: „Ja, natürlich, tot. Doch welche dieser Menschen gelten jetzt als lebend? Was für Menschen? Fliegen, keine Menschen!“
Chichikov argumentiert mit einem Argument gegen die Realität und verwendet den Begriff „Traum“: „Ja, sie existieren noch, aber das ist ein Traum.“ Als Antwort verbreitet Sobakevich die ersetzte These mit Beispielen und Übertreibungen und gibt dem Konzept die Bedeutung, die er braucht: „Nein, kein Traum! ... eine Kraft, die ein Pferd nicht hat ... das würde ich gerne wissen.“ wo man anderswo solch einen Traum finden würde! Bewertende Suffixe und detaillierter Vergleich verstärken die Wirkung.
Chichikov verwendet „das Argument schmieren“ und appelliert an das Vorhandensein von Bildung: „Sie scheinen ein ziemlich kluger Mensch zu sein, Sie haben Informationen über Bildung“, er versucht, das Objekt durch eine bewertende Nominierung abzuwerten: „Schließlich ist das Objekt.“ nur fufu. Was ist es wert? Wer braucht es?“
Sobakevich ist mit den Regeln der Logik vertraut und wendet das Ad-hom-inem-Argument auf eine Person an: („Ja, Sie kaufen, also brauchen Sie es“). Chichikovs Versuch, sich auf „Familie und familiäre Umstände“ zu beziehen, blockiert er mit der Aussage: „Ich muss nicht wissen, was für eine Beziehung Sie haben; ich mische mich nicht in Familienangelegenheiten ein. Sie brauchten Seelen, ich verkaufe Sie.“ , und du wirst es bereuen, dass du es nicht gekauft hast. , Verlust für dich selbst, deshe
Zur weiteren Lektüre des Artikels müssen Sie den Volltext erwerben. Artikel werden im Format gesendet PDF an die bei der Zahlung angegebene E-Mail-Adresse. Lieferzeit ist weniger als 10 Minuten. Kosten pro Artikel 150 Rubel.
Ähnliche wissenschaftliche Arbeiten zum Thema „Linguistik“
- THEMATISCHES INDEX DER ARTIKEL, DIE 2008 IM JOURNAL „RUSSKAYA SPEECH“ VERÖFFENTLICHT WURDEN
- „DIE PIK-KÖNIGIN“ IN GOGOLS „DEAD SOULS“
Krivonos V. Sh. - 2011