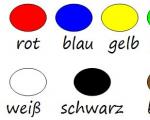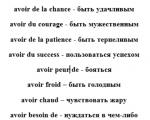Kreativität lv Beethoven
Beethoven
Beethovens Kindheit war kürzer als die seiner Altersgenossen. Nicht nur, weil ihn schon früh weltliche Sorgen belasteten. In seiner Natur nicht
eine erstaunliche Nachdenklichkeit zeigte sich früh in den Jahren. Ludwig betrachtete lange Zeit gerne die Natur.
Im Alter von zehn Jahren ist er berühmt in seinem Heimatort Bonnet als begabter Organist und Cembalist. Unter Musikliebhabern ist seine erstaunliche Gabe berühmt.
Improvisation. Zusammen mit erwachsenen Musikern spielt Ludwig Geige in der Bonner Hofkapelle. Er unterscheidet sich nicht im Alter stark
Wille, die Fähigkeit, sich ein Ziel zu setzen und es zu erreichen. Als ihm sein exzentrischer Vater den Schulbesuch verbot, entschied sich Ludwig entschieden für seine eigene Arbeit
deine Ausbildung abschließen. Daher zog es den jungen Beethoven nach Wien, der Stadt der Großen Musikalische Traditionen, das Reich der Musik.
Mozart lebt in Wien. Von ihm erbte Ludwig in der Musik das Drama der plötzlichen Übergänge von Trauer zu glücklicher, heiterer Fröhlichkeit.
Beim Hören von Ludwigs Improvisationen spürte Mozart in diesem brillanten jungen Mann die Zukunft der Musik. In Wien geht Beethoven gierig seiner nach
musikalische Ausbildung, Maestro Haydn gibt ihm Unterricht musikalische Komposition. In seinem Können erreicht er Vollkommenheit. Die ersten drei
Trotz unterschiedlicher Auffassungen widmet Beethoven Haydn Klaviersonaten. Beethoven nannte seine achte Klaviersonate „Groß
erbärmlich“, die den Kampf verschiedener Gefühle widerspiegelt. Im ersten Satz brodelt die Musik wie ein wütender Strom. Der zweite Teil ist melodiös, er ist ruhig
Meditation. Beethoven schrieb zweiunddreißig Klaviersonaten. In ihnen sind Melodien zu hören, die aus deutschen und slawischen Volksliedern gewachsen sind
Tanzen.
Im April 1800, zum ersten Mal offenes Konzert Ludwig van Beethoven führt die Erste Sinfonie am Wiener Theater auf. Wahre Musiker
Loben Sie ihn für sein Können, seine Neuheit und seinen Ideenreichtum. Sonaten-Fantasie, genannt "Mond", widmet er seiner Schülerin Giulietta Guicciardi. Jedoch
Auf dem Höhepunkt seines Ruhms verlor Beethoven schnell sein Gehör. Beethoven durchlebt eine tiefe seelische Krise, es kommt ihm vor, als wäre lebend taub ein Musiker
unmöglich. Nachdem er jedoch mit der Kraft seines Geistes tiefe Verzweiflung überwunden hat, schreibt der Komponist die Dritte Sinfonie „Heroisch“. Dann weltweit geschrieben
berühmte „Kreutzer-Sonate“, Oper „Fidelio“, „Appassionata“.
Aufgrund seiner Taubheit tritt Beethoven nicht mehr als Pianist und Dirigent in Konzerten auf. Aber Taubheit hindert ihn nicht daran, Musik zu machen. Sein Innenohr
beschädigt, In seiner Vorstellung stellt er sich die Musik klar vor. Die letzte, Neunte Symphonie ist Beethovens musikalisches Testament. Das ist das Lied der Freiheit
ein feuriger Aufruf an die Nachwelt
SYMPHONIE KREATIVITÄT
9 Sinfonien, 11 Ouvertüren.
1. WERT. Eine neue Auswahl an Themen und Bildern. Beethoven ist der größte Symphoniker. Das Erscheinen jeder Symphonie markierte für B. die Geburt einer ganzen Welt und war eine Verallgemeinerung einer ganzen Phase kreativer Suche.
· „Nach Beethoven müssen symphonische Pläne aufgegeben werden“ (R. Schumann). „Es ist unmöglich, nach Beethoven etwas Neues und Bedeutendes auf dem Gebiet der Symphonie zu tun“ (R. Wagner).
Sinfonische Kreativität zeichnet sich aus neuer Kreis Themen und Bilder, geboren aus dem neuen Inhalt der Kunst, der Persönlichkeit Beethovens. Veranstaltungen Französische Revolution hatte einen starken Einfluss auf die Bildung von B.s Weltanschauung, er entwickelte republikanische (antimonarchistische) Ideale, an die er zeitlebens glaubte. Die Natur der Kreativität von B. ist gewissermaßen geformt Zeitgeist. Es hat eine dramatische Verschiebung stattgefunden öffentliche Meinung zum Zweck der Kunst: ein Massenpublikum ansprechen; beispielloses Ausmaß an Ideen.
· An vorderster Front in der Arbeit von B. vorgebracht heroisch-episches Bürgerthema, die das leidenschaftliche Drama der Epoche, ihre Umbrüche und Katastrophen brach. Der Mensch selbst gewinnt das Recht dazu Freiheit Und Freude. Bilder des Kampfes, der Kollision und der Erlangung des Glücks.
Werke: Ouvertüren „Egmont“, „Coriolanus“, „Leonore Nr. 3“, Sinfonien Dritte (1802–1804), Fünfte (1804–1808), Neunte (1815–1823).
In diesen Werken wird ein neues heroisches Thema mit individuellen Merkmalen verkörpert. B. pflegte seine symphonischen Konzepte lange.
Kontinuität:
MIT J. Haydn: Sonaten-Symphonie-Zyklus - die Grundlage der Architektur der Symphonie. Die Symphonien Nr. 1-2 (1800-1802) verkörpern die Kontinuität der Prinzipien des Klassizismus, aber hier erklingt schon viel Blech.
MIT Mozart Prinzipien der Operndramaturgie.
· Mensch und Natur – Sinfonie Nr. 6 (1808).
Romantische Einflüsse - Symphonie Nr. 7 - Tanz, 1812.
(Galatskaja, S.83-86)
2. MERKMALE DES DRAMAS.
· Symphonie - Drama(Drama der Ideen). Die Idee ist tragisch, heroisch. Die Idee bestimmt die Entwicklung und Bewegung der Kräfte weiter unterschiedliche Bühnen Dramaturgie. Es basiert auf Konflikt Persönlichkeit mit Realität, Schicksal, Schicksal. neuer Typ Dramaturgie - Konflikt. Zusammenspiel von Bildern - unüberbrückbare Kräfte prallen aufeinander.
· Eine neue Art von Symphonie – heroisch und wirkungsvoll.
· Tonal-thematische Verbindungen zwischen den Teilen des Ganzen und innerhalb der Teile.
SYMPHONIE Nr. 5 in c-Moll
(1805-1808)
1. WERT.
· Fünfte Symphonie- die Idee einer heroisch schmerzhaften Überwindung eines Hindernisses. Nie zuvor hat die Musik eine solche Intensität des Kampfes erreicht und noch nie so scharfe Zusammenstöße zwischen ihnen dargestellt fatale Unausweichlichkeit und den Mut, sich dagegen zu wehren Wille. Die Sinfonie verkörpert einen von Hauptideen Beethovens Schaffen Heldentum des Kampfes und des Sieges. Die Linie der dramatischen Entwicklung kann hier durch die Worte dargestellt werden:
"Von der Dunkelheit zum Licht, durch den Kampf zum Sieg."
· Keynote-Eröffnung (SCHICKSAL THEMA). Leitmotiv ist ein Opernbegriff. Ein Thema oder eine musikalische Phrase, die einen Charakter oder eine Situation beschreibt und erklingt, wenn sie erwähnt werden oder auf der Bühne erscheinen. Ein Leitmotiv ist ein sich wiederholendes Merkmal eines Phänomens, einer Idee oder eines Bildes. Mit Hilfe des "Schicksalsthemas" (Schicksalsklopfen) klopften die Gefangenen eines der NS-Gefängnisse.
2. STUFEN DES DRAMAS. DRAMATURGIE.
|
Teil |
Ton/Form |
dramatische Rolle |
|
Ich trenne mich |
AllegroconbrioC-Molle. Sonateallegro. |
"Wrestling-Arena" Dramatischer Konflikt zwischen den Kräften des Bösen, des Schicksals und des Menschen. |
|
II. Teil |
Andantemit moto. DoppeltVariationen |
Übergang in die Sphäre der bürgerlichen Lyrik. Das Sammeln der Kräfte, die innere Wiedergeburt der Persönlichkeit. |
|
III. Teil |
Scherzo C-Molle, allegro Komplizierte 3-teilige Form |
Ein neuer Ansatz zum Gipfel, der Kampf um seine Eroberung. |
|
IV. Teil |
Das endgültigeC-dur .Sonate allegro |
Heroische Auflösung des Dramas. Prüfungen und Kämpfe führen zu Volksjubel und Triumph. |
|
die Rolle des Leitmotivs in der Dramaturgie der Symphonie |
|
|
Das Leitmotiv des Schicksals ist ein Symbol des Bösen, das auf tragische Weise als Hindernis in das Leben eines Menschen eindringt, dessen Überwindung enorme Anstrengungen erfordert. Der scharf hämmernde Rhythmus ("Knock of Fate") wird Leitrhythmus und durchläuft verschiedene Wandlungen durch alle Teile der Sinfonie. |
|
|
Ich trenne mich |
Das Schicksalsthema steht im Vordergrund. Alles endet mit einem triumphalen Leitmotiv. |
|
II. Teil |
In der ersten Variation über Thema A klingt der Leitrhythmus alarmierend – eine Erinnerung an frühere Ereignisse. |
|
III. Teil |
Das Leitmotiv des Themas dringt plötzlich mit dramatischer Wucht ein ( ThemaB). Fatal ominöser Anfang betont durch die Klangfarben von Blechbläsern (Hörnern) und ziselierter Akkordbegleitung zur "aushöhlenden" Melodie. Diese Version des Themas klingt noch autoritativer und kategorischer. Wenn es wiederholt wird, klingt dieses Thema wild und unnachgiebig. In der Reprise des Teils verliert das „Schicksalsthema“ seine Kategorisierung, ein Zustand der Ungewissheit und Ungewissheit tritt auf – eine Rückkehr in die Vergangenheit ist unmöglich. Übergang zum Finale- kontinuierlich im Bass, wie ein fernes Grollen, ertönt der Leitrhythmus („Klopf des Schicksals“). der Ton verwandelt sich in einen Triumphmarsch (G.P. Finale). |
|
IV. Teil |
Entwicklung,"Episode des Kampfes" - schließen Sie sich der heroischen Linie an neues Thema und hämmern Schicksalsmotiv. Code. Der pulsierende Leitrhythmus wird zur Siegesmusik. |
BEETHOVENS SYMPHONIE
Beethovens Symphonien sind auf dem Boden entstanden, den der gesamte Verlauf der Entwicklung der Instrumentalmusik im 18. Jahrhundert, insbesondere seine unmittelbaren Vorgänger Haydn und Mozart, bereitet hat. Der Sonaten-Symphonie-Zyklus, der schließlich in ihrer Arbeit Gestalt annahm, seine angemessen schlanken Konstruktionen, erwies sich als solide Grundlage für die massive Architektur von Beethovens Symphonien.
Beethovens musikalisches Denken ist eine komplexe Synthese der ernsthaftesten und fortschrittlichsten, geboren aus dem philosophischen und ästhetischen Denken seiner Zeit, mit der höchsten Manifestation des nationalen Genies, eingeprägt in die breiten Traditionen der jahrhundertealten Kultur. Viel künstlerische Bilder Auch die Realität veranlasste ihn - die revolutionäre Ära (3, 5, 9 Sinfonien). Beethoven war besonders besorgt über das Problem "Der Held und das Volk". Beethovens Held ist untrennbar mit dem Volk verbunden, und das Problem des Helden entwickelt sich zum Problem des Individuums und des Volkes, des Menschen und der Menschheit. Es kommt vor, dass ein Held stirbt, aber sein Tod wird von einem Sieg gekrönt, der der befreiten Menschheit Glück bringt. Neben den heroischen Themen fand das Naturthema die reichste Reflexion (4, 6 Sinfonien, 15 Sonaten, viele langsame Sinfonienpartien). In Verständnis und Wahrnehmung der Natur steht Beethoven den Ideen von J.-J. Rousseaus. Die Natur ist für ihn keine gewaltige, unbegreifliche Kraft, die sich dem Menschen widersetzt; es ist die Quelle des Lebens, durch deren Kontakt man moralisch gereinigt wird, den Willen zur Arbeit gewinnt und mutiger in die Zukunft blickt. Beethoven dringt tief in die subtilste Sphäre menschlicher Gefühle ein. Aber indem er die Welt des inneren, emotionalen Lebens eines Menschen enthüllt, zeichnet Beethoven denselben Helden, stark, stolz, mutig, der niemals Opfer seiner Leidenschaften wird, da sein Kampf um persönliches Glück von demselben Gedanken an die geleitet wird Philosoph.
Jede der neun Symphonien ist ein außergewöhnliches Werk, das Ergebnis langer Arbeit (zum Beispiel hat Beethoven 10 Jahre lang an der 9. Symphonie gearbeitet).
Sinfonien
In der ersten Sinfonie C-dur die Züge des neuen Beethoven-Stils erscheinen sehr bescheiden. Laut Berlioz „ist das hervorragende Musik … aber … noch kein Beethoven“. Spürbare Vorwärtsbewegung in der zweiten Symphonie D-dur . Der selbstbewusst männliche Ton, die Dynamik der Entwicklung, die Energie offenbaren das Bild Beethovens viel heller. Aber der eigentliche kreative Start fand in der Dritten Symphonie statt. Beginnend mit der Dritten Symphonie inspiriert das heroische Thema Beethoven zu herausragenden Werken symphonische Werke- Fünfte Symphonie, Ouvertüren, dann wird dieses Thema in der Neunten Symphonie mit unerreichter künstlerischer Perfektion und Weite wiederbelebt. Gleichzeitig offenbart Beethoven andere figurative Sphären: die Poesie des Frühlings und der Jugend in der Sinfonie Nr. 4, die Dynamik des Lebens in der Siebten.
In der Dritten Symphonie, so Becker, verkörperte Beethoven „nur das Typische, Ewige … – Willenskraft, Todesmajestät, Schaffenskraft – er verbindet und schafft daraus sein Gedicht über alles Große, Heroische, was überhaupt sein kann dem Menschen innewohnend“ [Paul Becker. Beethoven, T. II . Sinfonien. M., 1915, S. 25.] Der zweite Teil ist der Trauermarsch, ein musikalisches heroisch-episches Bild von unübertroffener Schönheit.
Die Idee des heroischen Kampfes wird in der Fünften Symphonie noch konsequenter und gezielter durchgeführt. Wie ein Opernleitmotiv zieht sich das vierstimmige Hauptthema durch alle Teile des Werks, verändert sich im Verlauf der Handlung und wird als Symbol des Bösen wahrgenommen, das auf tragische Weise in das Leben eines Menschen eindringt. Es besteht ein großer Kontrast zwischen der Dramatik des ersten Teils und dem langsam nachdenklichen Gedankenfluss im zweiten.
Sinfonie Nr. 6 "Pastorale", 1810
Das Wort „Hirten“ bezieht sich auf das friedliche und sorglose Leben der Hirten und Hirtinnen zwischen Kräutern, Blumen und fetten Herden. Seit der Antike war die Pastoralmalerei mit ihrer Regelmäßigkeit und Ruhe ein unerschütterliches Ideal für einen gebildeten Europäer und blieb es auch zu Beethovens Zeiten. „Niemand auf der Welt kann das Dorf so lieben wie ich“, gab er in seinen Briefen zu. - Ich kann einen Baum mehr lieben als einen Menschen. Allmächtig! Ich bin glücklich in den Wäldern, ich bin glücklich in den Wäldern, wo jeder Baum von dir spricht.
Die „pastorale“ Symphonie ist ein Meilenstein und erinnert daran, dass der echte Beethoven keineswegs ein revolutionärer Fanatiker ist, der bereit ist, alles Menschliche für den Kampf und den Sieg aufzugeben, sondern ein Sänger der Freiheit und des Glücks in der Hitze des Kampfes , ohne das Ziel zu vergessen, für das Opfer gebracht und Erfolge erzielt werden. Aktiv-dramatische Kompositionen und pastoral-idyllische Kompositionen sind für Beethoven zwei Seiten, zwei Gesichter seiner Muse: Aktion und Reflexion, Kampf und Kontemplation bilden für ihn wie für jeden Klassiker eine verbindliche Einheit, die das Gleichgewicht und die Harmonie der Naturkräfte symbolisiert .
Die „pastorale“ Sinfonie trägt den Untertitel „Erinnerungen an das Landleben“. So klingen im ersten Teil ganz selbstverständlich Anklänge an die Dorfmusik: Pfeifenmelodien begleiten ländliche Spaziergänge und Tänze der Dorfbewohner, träge watschelnde Melodien von Dudelsäcken. Aber auch hier ist die Handschrift Beethovens, des unerbittlichen Logikers, sichtbar. Sowohl in den Melodien selbst als auch in ihrer Fortsetzung tauchen ähnliche Züge auf: Wiederholung, Trägheit und Wiederholung dominieren die Darstellung von Themen, in kleinen und großen Phasen ihrer Entwicklung. Nichts wird zurückweichen, ohne sich mehrmals zu wiederholen; Nichts wird zu einem unerwarteten oder neuen Ergebnis kommen - alles wird wieder normal, schließen Sie sich dem faulen Kreislauf bereits bekannter Gedanken an. Nichts akzeptiert einen von außen auferlegten Plan, sondern folgt einer etablierten Trägheit: Jedes Motiv kann unbegrenzt wachsen oder zunichte werden, sich auflösen und einem anderen ähnlichen Motiv weichen.
Sind nicht alle natürlichen Prozesse so träge und ruhig gemessen, schweben nicht Wolken gleichförmig und träge am Himmel, schwankende Gräser, rauschen Bäche und Flüsse? natürliches Leben Im Gegensatz zum Leben der Menschen offenbart es keinen klaren Zweck und ist daher spannungslos. Hier ist es, ein Leben bleiben, ein Leben frei von Wünschen und Streben nach dem, was gewünscht wird.
Entgegen dem vorherrschenden Geschmack, Beethoven im letzten kreative Jahre schafft Werke von außergewöhnlicher Tiefe und Erhabenheit.
Obwohl die Neunte Symphonie noch lange nicht da ist letzte Arbeit Beethoven, sie war die Komposition, die die ideologischen und künstlerischen Suchen des Komponisten vervollständigte. Die in den Symphonien Nr. 3 und 5 skizzierten Probleme bekommen hier einen universellen, universellen Charakter. Die Gattung der Symphonie selbst hat sich grundlegend gewandelt. IN Instrumentalmusik Beethoven stellt vor Wort. Diese Entdeckung Beethovens wurde mehr als einmal von Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts genutzt. Beethoven ordnet das übliche Kontrastprinzip der Idee des Kontinuierlichen unter figurative Entwicklung, daher der ungewöhnliche Stimmenwechsel: zuerst zwei schnelle Teile, in denen sich die Dramatik der Symphonie konzentriert, und der langsame dritte Teil bereitet das Finale vor - das Ergebnis komplexester Prozesse.
Die Neunte Symphonie ist eine der herausragendsten Schöpfungen in der Geschichte der Weltmusikkultur. An Größe der Idee, Weite des Konzepts und kraftvoller Dynamik musikalischer Bilder übertrifft die Neunte Symphonie alles, was Beethoven selbst geschaffen hat.
+ MINIBONUS
BEETHOVENS KLAVIERSONATEN.
Späte Sonaten zeichnen sich durch große Komplexität aus. musikalische Sprache, Kompositionen. Beethoven weicht in vielerlei Hinsicht von den für die klassische Sonate typischen Formationen ab; die damalige anziehung zu philosophischen und kontemplativen bildern führte zu einer leidenschaft für polyphone formen.
STIMME KREATIVITÄT. "ZUM FERNEN GELIEBTEN". (1816?)
Das erste in einer Reihe von Werken des letzten Schaffenszeit Es gab einen Zyklus von Liedern "KDV". Völlig originell in Konzept und Komposition, war es ein früher Vorläufer der romantischen Vokalzyklen von Schubert und Schumann.
Das Konzept des "Symphonismus" ist etwas Besonderes, da es keine Entsprechungen in der Theorie anderer Künste gibt. Es bezeichnet nicht nur das Vorhandensein von Symphonien im Werk des Komponisten oder den Umfang dieser Gattung, sondern eine besondere Eigenschaft der Musik. Symphonie ist eine besondere Dynamik der Bedeutungs- und Formentfaltung, der inhaltlichen Tiefe und Entlastung der Musik, emanzipiert vom Text, Literarische Handlung, Charaktere und andere semantische Realitäten von Opern- und Gesangsgattungen. Musik, die sich an den Zuhörer zur gezielten Wahrnehmung richtet, sollte eine viel größere und spezifische Menge an künstlerischer Information enthalten als Hintergrundmusik, die soziale Rituale schmückt. Eine solche Musik bildete sich allmählich in den Tiefen der westeuropäischen Kultur heraus und fand ihren höchsten Ausdruck im Werk der Wiener Klassiker und den Höhepunkt ihrer Entwicklung - im Werk von Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Natürlich hervorragend instrumentale Werke Händel und vor allem Bach sind voll davon tiefe Bedeutung, kolossale Energie des Denkens, die uns oft erlaubt, über ihre philosophische Natur zu sprechen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Inhalt der Musik von der Tiefe der Kultur der Person abhängt, die sie wahrnimmt. Und Beethoven war derjenige, der Komponisten nachfolgender Generationen lehrte, großangelegte instrumentale „Dramen“, „Tragödien“, „Romane“ und „Gedichte“ zu schaffen. Ohne seine Sonaten und Symphonien, Konzerte, Variationen, die die Symphonie des Denkens verkörpern, gäbe es nicht nur die romantische Symphonie von Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Strauss, Mahler, sondern auch Komponisten des 20. Jahrhunderts. - Schostakowitsch, Penderetsky, Schnittke, Kantscheli.
Beethoven schrieb in den neuen Gattungen der Klassik – Sonaten für Pianoforte, Sonaten für Pianoforte und Violine, Quartette, Symphonien. Divertissements, Kassationen, Serenaden waren nicht seine Gattungen, wie auch sein Leben, das sich in enger Nachbarschaft zu den Wiener Adelskreisen abspielte, kein Hofmannsleben war. Demokratie war das ersehnte Ziel des Komponisten, der sich große Sorgen um seine "niedrige" Herkunft machte. Aber er strebte nicht nach dem Titel, wie zum Beispiel der russische Dichter A. Fet, der sein ganzes Leben lang den Adel suchte. Parolen der Französischen Revolution liberte, egalite, fraternite (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit), die er persönlich begrüßte, waren ihm zutiefst nahe und verständlich. In seiner letzten, Neunten Symphonie führte er den Chor bis zum Finale zu den Worten von F. Schiller „Umarmung, Millionen“. Solche „Materialisierungen“ des Wortgehalts in Instrumentalgattungen hat er nicht mehr, aber viele Sonaten und Symphonien sind von einem heroischen, heroisch-pathetischen Klang durchdrungen. Ja, in der Tat ist dies die figurativ-inhaltliche Hauptsphäre von Beethovens Musik, die von Bildern einer hellen Idylle abgesetzt wird, die oft einen für die Zeit charakteristischen pastoralen Ton haben. Aber auch hier, in den lyrischsten Fragmenten, spürt man immer innere Stärke, gebändigte Willenskraft, Kampfbereitschaft.
Beethovens Musik wurde in unserem Land, insbesondere in der Zeit der UdSSR, mit einem revolutionären Impuls und sogar mit konkreten Bildern sozialer Kämpfe identifiziert. Im zweiten Teil der Dritten Symphonie – dem berühmten Trauermarsch – hörten sie die Beerdigung eines im revolutionären Kampf gefallenen Helden; über die Sonate Nr. 23 "Arrazzyupaa" die Worte der Bewunderung von V.I. Lenin, der Anführer der Oktoberrevolution, als Beweis ihres sozialen Pathos. Ob dem so ist oder nicht, ist nicht die Frage: musikalische Inhalte konventionell und unterliegt sozialpsychologischen Dynamiken. Aber die Tatsache, dass Beethovens Musik eindeutig spezifische Assoziationen mit dem Seelenleben des Handelnden hervorruft und denkender Mensch- definitiv.
Wenn es so wichtig ist, Mozarts Musik zu verstehen, um sich sein Theater vorzustellen, dann musikalische Themen Beethoven hat eine andere "Adresse": Um ihre Bedeutung zu entschlüsseln, muss man die Sprache der Opernvene kennen, die Opern von Händel, Gluck und vielen ihrer Zeitgenossen, die typische Affekte mit typisierten Motivformeln ausdrückten. Barockzeit Mit ihrem Pathos, tragischen Texten, heroischen Rezitationen und idyllischen Anmut entwickelte sie Bedeutungsfiguren, die dank Beethoven die Form eines musikalischen Sprachsystems angenommen haben, das Originalität und Perfektion besitzt, um Bilder-Ideen auszudrücken, und nicht Charaktere und ihre " Verhaltensweisen". Viele von Beethovens Musik- und Sprachfiguren erhielten später die Bedeutung von Symbolen: Schicksal, Vergeltung, Tod, Trauer, perfekter Traum, Liebesfreude. Es ist kein Zufall, dass L. Tolstoi seine Erzählung „Die Kreutzer-Sonate“ der Neunten Violinsonate gewidmet hat, aus der ich bedeutsame Worte zitieren möchte: „Ist es möglich, dieses Presto im Wohnzimmer unter tiefbesetzten Damen zu spielen? 1 Spielen und dann klatschen und dann Eis essen und über den neuesten Klatsch reden Diese Dinge können nur unter bestimmten, wichtigen, signifikanten Umständen gespielt werden, und wenn es erforderlich ist, bestimmte wichtige Aktionen auszuführen, die dieser Musik entsprechen worauf diese Musik gesetzt hat.“
Mit dem Begriff „Symphonie“ verbindet sich auch jene besondere auditive Instrumentalphantasie, die bei Beethoven auffällt, der schon früh sein Gehör verlor und viele seiner Meisterwerke mit völliger Taubheit schuf. Zu seinen Lebzeiten kam das Klavier zum Einsatz, das in den folgenden Epochen zum Hauptinstrument werden sollte. musikalische Kultur. Alle Komponisten, auch die mit feinem Timbre-Ohr, werden darauf ihre Werke für Orchester komponieren - sie werden am Klavier komponieren, und dann "Instrument", d.h. Musik für Orchesterstimmen schreiben. Beethoven sah die Kraft des zukünftigen "Orchesterklaviers" so voraus, dass seine Klaviersonaten in der Konservatoriumspraxis den Studenten als Übungen zur Orchestrierung gegeben werden. Auffallend ist bereits seine frühe Sonate Nr. 3 in C-Dur, bei der man im ersten Teil den Eindruck gewinnt, es handele sich hier um das „Klavier“ eines Klavierkonzerts; in diesem Zusammenhang kann die Sonate Nr. 21 (bekannt unter dem Namen „Aurora“) (als R. Schumann eine seiner Sonaten) „Konzert ohne Orchester“ genannt werden. Überhaupt sind die Themen von Beethovens Sonaten selten „Arien“ oder gar „Lieder“, sie zeichnen sich durch ihren prinzipiell orchestralen Charakter aus.
Jeder kennt Beethovens Instrumentalwerke, obwohl es nicht so viele sind: 9 Sinfonien, 32 Klaviersonaten, 5 Klavierkonzerte, 1 Violinkonzert, 1 Tripel (für Klavier, Violine und Violoncello), 10 Sonaten für Klavier und Violine, 5 - für Klavier und Violoncello, 16 Quartette. Alle von ihnen wurden viele Male aufgeführt und werden noch heute aufgeführt. Zeitgenössische Beethoven-Interpretationen stellen ein interessantes kulturelles Phänomen dar.
Beethovens Beitrag zu Weltkultur vor allem durch seine symphonischen Werke bestimmt. Er war der größte Symphoniker, und das war in symphonische Musik verkörperte sowohl seine Weltanschauung als auch die Hauptsache am besten künstlerische Prinzipien. Der Weg Beethovens als Symphoniker umfasste fast ein Vierteljahrhundert (1800 - 1824), sein Einfluss erstreckte sich jedoch auf das gesamte 19. und in weiten Teilen sogar bis ins 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert musste jeder Symphoniker für sich entscheiden, ob er eine der Linien von Beethovens Symphonik weiterführt oder versucht, etwas grundlegend anderes zu schaffen. So oder so, aber ohne Beethoven wäre die symphonische Musik des 19. Jahrhunderts eine ganz andere gewesen. Beethoven hat 9 Sinfonien (10 blieben in Skizzen). Im Vergleich zu 104 von Haydn oder 41 von Mozart ist das nicht viel, aber jedes davon ein Ereignis. Die Bedingungen, unter denen sie komponiert und aufgeführt wurden, waren radikal anders als unter Haydn und Mozart. Für Beethoven ist eine Symphonie zunächst eine Gattung, eine rein öffentliche, die hauptsächlich in großen Sälen aufgeführt wird; Beethoven beabsichtigte, seine Symphonien in offenen Akademiekonzerten aufzuführen (sie fanden normalerweise entweder vor Weihnachten oder während der Fastenzeit statt, als Bühnenaufführungen verboten waren). in Theateraufführungen), ein ziemlich solides Orchester für damalige Verhältnisse; und zweitens ist das Genre ideologisch sehr bedeutsam, was es nicht erlaubt, solche Kompositionen auf einmal in Serien von 6 Stücken zu schreiben. Daher sind Beethovens Symphonien in der Regel viel größer als sogar Mozarts (mit Ausnahme der 1. und 8.) und grundsätzlich individuell konzipiert. Jede Sinfonie gibt einzige Entscheidung sowohl figurativ als auch dramatisch. Zwar finden sich in der Abfolge von Beethovens Symphonien gewisse Muster, die Musikern schon lange aufgefallen sind. Ungerade Symphonien sind also explosiver, heroischer oder dramatischer (mit Ausnahme der 1.), und gerade Symphonien sind „friedlicher“, genretypischer (vor allem 4., 6. und 8.). Dies lässt sich damit erklären, dass Beethoven Symphonien oft paarweise konzipiert und sogar gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander geschrieben hat (5 und 6 haben bei der Uraufführung sogar Nummern „vertauscht“; 7 und 8 folgten hintereinander). Jedes symphonische Werk Beethovens ist das Ergebnis einer langen, manchmal langjährigen Arbeit: Die Heroic entstand innerhalb von anderthalb Jahren, Beethoven begann die Fünfte 1805 und beendete sie 1808, und die Arbeit an der Neunten Symphonie dauerte fast zehn Jahre . Hinzuzufügen ist, dass die meisten Sinfonien, von der Dritten bis zur Achten, ganz zu schweigen von der Neunten, auf die Blütezeit und den höchsten Aufstieg von Beethovens Schaffen fallen. In der Ersten Sinfonie in C-Dur treten die Züge von Beethovens neuem Stil noch sehr schüchtern und bescheiden auf. Die Erste Symphonie, so Berlioz, sei „hervorragend geschriebene Musik, aber noch nicht Beethoven“. In der Zweiten Sinfonie in D-Dur, die 1802 erschien, gibt es eine bemerkenswerte Vorwärtsbewegung. Der souverän maskuline Ton, das Ungestüm der Dynamik, all seine progressive Energie offenbaren viel klarer das Gesicht des Schöpfers zukünftiger triumphal-heroischer Kreationen, aber eines echten kreativer Aufbruch, trat in der Dritten Symphonie auf. Durch das Labyrinth geistiger Suche gelangt, fand Beethoven sein heroisch-episches Thema in der Dritten Symphonie. Erstmals in der Kunst wurde mit einer solchen Verallgemeinerungstiefe das leidenschaftliche Drama der Epoche, ihre Umbrüche und Katastrophen gebrochen. Auch der Mann selbst wird gezeigt, der sich das Recht auf Freiheit, Liebe und Freude erkämpft. Beginnend mit der Dritten Symphonie inspiriert das heroische Thema Beethoven zu den herausragendsten symphonischen Werken – der Fünften Symphonie, den Egmont-, Coriolanus- und Leonore-Ouvertüren. Bereits am Ende seines Lebens lebt dieses Thema in der Neunten Symphonie in unerreichter künstlerischer Perfektion und Weite wieder auf. Gleichzeitig erhebt sich Beethoven in symphonischer Musik und anderen Schichten. Die Poesie des Frühlings und der Jugend, die Freude des Lebens, seine ewige Bewegung – das ist der Komplex poetischer Bilder der Vierten Symphonie in B-Dur. Die Sechste (Pastorale) Sinfonie widmet sich dem Thema Natur. In der nach Glinka „unfassbar hervorragenden“ Siebten Sinfonie in E-Dur erscheinen Lebensphänomene in verallgemeinerten Tanzbildern; Die Dynamik des Lebens, seine wundersame Schönheit verbirgt sich hinter dem hellen Funkeln wechselnder rhythmischer Figuren, hinter unerwarteten Wendungen Tanzbewegungen. Selbst die tiefste Traurigkeit des berühmten Allegrettos vermag das Funkeln des Tanzes nicht auszulöschen, das feurige Temperament des Tanzes der das Allegretto umgebenden Stimmen zu mäßigen. Neben den mächtigen Fresken der Siebten steht die subtile und elegante Kammermalerei der Achten Symphonie in F-Dur. Die Hauptmerkmale von Beethovens symphonischer Methode. 1. Das Bild in der Einheit von gegensätzlichen Elementen zeigen, die sich bekämpfen. Beethovens Themen bauen oft auf gegensätzlichen Motiven auf, die eine innere Einheit bilden. Daher ihr innerer Konflikt, der als Voraussetzung für eine Zeitform dient weitere Entwicklung. 2. 2. Die große Rolle der Ableitung Kontrast. Der abgeleitete Kontrast ist ein solches Entwicklungsprinzip, bei dem ein neues kontrastierendes Motiv oder Thema das Ergebnis der Transformation des vorherigen Materials ist. Das Neue erwächst aus dem Alten, das sich in sein eigenes Gegenteil verkehrt. Zum Beispiel Hauptthema Symphonie 5 in 1 Satz, dann im dritten Satz leicht verändert „du kannst es spielen“, und im 4. Satz der Symphonie klingt es wie eine Erinnerung aus sowohl 1 Satz als auch 3. 3. 3. Kontinuität der Entwicklung und qualitative Veränderungen Bilder. Die Entwicklung von Themen beginnt buchstäblich mit ihrer Präsentation. In der 5. Sinfonie im 1. Teil gibt es also keinen einzigen Takt der eigentlichen Exposition (mit Ausnahme des „Epigraphs“ - der allerersten Takte). Bereits im Hauptteil wird das Ausgangsmotiv auffallend transformiert - es wird sowohl als „fatales Element“ (Schicksalsmotiv) als auch als Symbol des heroischen Widerstands, also des beginnenden widerstrebenden Schicksals, wahrgenommen. Äußerst dynamisch ist auch das Thema des Hauptteils der „Heroischen“ Symphonie, was sich im Verlauf der rasanten Entwicklung auch sofort ergibt. Deshalb sind trotz der Lakonie von Beethovens Themen die Parteien der Sonatenform sehr entwickelt. Der Entwicklungsprozess umfasst ab der Ausstellung nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Reprise und den Code, der gleichsam zu einer zweiten Entwicklung wird. Das heißt, es gibt eine Art Durchentwicklung, die typisch für Beethovens Symphonik ist. 4. 4. Eine qualitativ neue Einheit des Sonaten-Symphonie-Zyklus im Vergleich zu den Zyklen von Haydn und Mozart. Die Symphonie wird zu einem „Instrumentaldrama“, in dem jeder Teil ein notwendiges Glied in einer einzigen musikalischen und dramatischen „Aktion“ ist. Der Höhepunkt dieses "Dramas" ist das Finale. Das leuchtendste Beispiel für Beethovens Instrumentaldrama ist die „Heroische“ Symphonie, deren alle Teile miteinander verbunden sind gemeinsame Linie Entwicklung hin zu einem grandiosen Bild des nationalen Triumphs im Finale. Apropos Beethovens Symphonien, man sollte seine orchestrale Innovation hervorheben. Von den Neuerungen: die eigentliche Bildung des Kupferkonzerns. Obwohl die Trompeten immer noch zusammen mit den Pauken gespielt und aufgenommen werden, beginnt man, sie und die Hörner funktionell als eine einzige Gruppe zu behandeln. Dazu gesellen sich Posaunen, die nicht dabei waren Symphonieorchester Haydn und Mozart. Posaunen spielen im Finale der 5. Symphonie (3 Posaunen), in der Gewitterszene der 6. (hier sind es nur 2), und auch in einigen Teilen der 9. (im Scherzo und in der Gebetsepisode der Finale sowie in der Coda). Die Verdichtung der „mittleren Schicht“ macht es erforderlich, die Vertikale von oben und unten zu erhöhen. Oben erscheint die Piccoloflöte (in allen angegebenen Fällen, mit Ausnahme der Gebetsepisode im Finale der 9.) und unten - das Kontrafagott (im Finale der 5. und 9. Symphonie). Aber in jedem Fall gibt es in einem Beethoven-Orchester immer zwei Flöten und Fagotte. In Fortführung der Traditionen von Haydns Londoner Symphonien und Mozarts späten Symphonien verstärkt Beethoven die Eigenständigkeit und Virtuosität der Stimmen fast aller Instrumente, einschließlich der Trompete (das berühmte Off-Stage-Solo in den Leonore-Ouvertüren Nr. 2 und Nr. 3) und der Pauke. Er hat oft wirklich 5 Saitenteile (Kontrabässe sind von Cellos getrennt) und manchmal mehr (Divizi-Spiel). Alle Holzbläser, einschließlich Fagott, sowie Hörner (im Chor, wie im Scherzo-Trio der 3. Symphonie, oder separat) können solo spielen und sehr helles Material spielen. Merkmale der Musiksprache. Melodika. Das Grundprinzip seiner Melodie liegt in Trompetensignalen und Fanfaren, in beschwörenden oratorischen Ausrufen und Marschwendungen. Die Bewegung entlang der Klänge des Dreiklangs wird oft verwendet (der Hauptteil der Heroischen Symphonie; das Thema des Finales der 5. Symphonie, der Hauptteil des ersten Teils der 9. Symphonie). Aber das ist nicht einmal ein Merkmal Beethovens, es war vor ihm nur Beethoven im Besonderen. Beethovens Zäsuren sind Satzzeichen in der Rede. Beethovens Fermaten sind Pausen nach pathetischen Fragen. Beethovens musikalische Themen bestehen oft aus gegensätzlichen Elementen. Die kontrastierende Themenstruktur findet sich auch bei Beethovens Vorgängern (insbesondere Mozart), aber bei Beethoven wird sie bereits zum Muster. der Kontrast innerhalb des Themas entwickelt sich zu einem Konflikt zwischen Haupt- und Nebenpartei. Der Metrorhythmus trägt eine Ladung der Männlichkeit, des Willens und der Aktivität. Marschrhythmen sind sehr verbreitet. Tanzrhythmen (in den Bildern des Volksspaßes - das Finale der 7. Symphonie, das Finale der Aurora-Sonate, wenn nach langem Leiden und Kampf ein Moment des Triumphs und der Freude kommt. Was Harmony betrifft, die lakonische Verwendung von Nicht- Akkordklänge verwendet) - eine kontrastreiche und dramatische Interpretation der harmonischen Folge (Verbindung mit dem Prinzip der Konfliktdramaturgie). Scharfe, kühne Modulationen in entfernten Tonarten. Was die Formen betrifft, ist Beethoven der Schöpfer der Form der freien Variationen (final Klaviersonate Nr. 30, Variationen über ein Thema von Diabelli, Sätze 3 und 4 der 9. Symphonie). Auch Variationen sind im Symphoniezyklus weit verbreitet, z. B. die 5. Symphonie, in der 7. Symphonie, dem 2. Teil, das Thema ändert sich dort nicht, nur die Orchestrierung ändert sich. Ihm wird die Einführung der Variationsform in zugeschrieben große Form. Evolution Symphonische Kreativität Beethoven. 1 Sinfonie. Hier führt Beethoven einen Dialog mit der Tradition, zum Beispiel sollte man traditionell eine Symphonie mit dem Zeigen der Tonika beginnen, und in 1 beginnt die Symphonie mit dem Zeigen der Subdominante, was Kritik von Kritikern hervorruft, genauso war es mit der 5. Symphonie, weil des Es-Dur, dem in der Durchführung eine besondere Bedeutung zukommt, die schließlich zur Tonika führt. Auch in der 1. Symphonie fällt ein merkwürdiges Menuett auf, das aber eigentlich wie ein Scherzo wirkt. Die 2. Symphonie ist natürlich traditioneller. Das ist die sogenannte Federprobe, und hier tritt Beethoven am deutlichsten als Wiener Klassiker auf, weil hier die Sukzessionslinien der Wiener Klassik am deutlichsten sind. Ferner wird Beethoven ab der 3. Symphonie gewissermaßen er selbst, das liegt vor allem daran, dass er sein heroisch-dramatisches Thema zugleich aber schon ab der 3. Symphonie gefunden hat, er findet seinen eigenen Typus des Symphonikzyklus, nämlich wenn der klassische Typus der Symphonik der Zyklus nach dem Typus der Bogendramaturgie aufgebaut ist, das heißt, wenn 1 4 Teile einen Rahmen oder Bogen der gesamten Symphonie bilden, geht es beim Typus Beethoven um Übertragung den Schwerpunkt nur auf das Finale der Symphonie, und alles ist darauf ausgerichtet, und um diesen Anspruch heller und logischer zu machen, können Sie Teile vertauschen, Teile 2 und 3, es ist unnötig, einen endgültigen Schluss zu ziehen Teil 1, als Beispiel, das Ende der 3. Sinfonie ist insbesondere das Finale.
Die Sechste, Pastorale Symphonie (F-dur, op. 68, 1808) nimmt einen besonderen Platz in Beethovens Schaffen ein. Von dieser Symphonie haben sich die Vertreter der romantischen Programmsinfonie weitgehend abgestoßen. Ein begeisterter Bewunderer der Sechsten Symphonie war Berlioz.
Das Thema Natur findet in der Musik Beethovens, eines der größten Naturdichter, eine breite philosophische Verkörperung. In der Sechsten Symphonie erlangten diese Bilder den vollständigsten Ausdruck, denn das eigentliche Thema der Symphonie sind Natur und Bilder des ländlichen Lebens. Die Natur ist für Beethoven nicht nur ein Objekt, um malerische Gemälde zu schaffen. Sie war für ihn der Ausdruck eines umfassenden, lebensspendenden Prinzips. Im Einklang mit der Natur fand Beethoven die Stunden reiner Freude, nach denen er sich sehnte. Aussagen aus Beethovens Tagebüchern und Briefen sprechen von seiner enthusiastischen pantheistischen Einstellung zur Natur (siehe S. II31-133). Mehr als einmal treffen wir in Beethovens Notizen auf Äußerungen, sein Ideal sei "frei", das heißt natürliche Natur.
Das Naturthema verbindet sich in Beethovens Werk mit einem anderen Thema, in dem er sich als Anhänger Rousseaus ausdrückt - das ist schlichte Poesie, natürliches Leben in Gemeinschaft mit der Natur, die geistige Reinheit des Bauern. In den Anmerkungen zu den Skizzen der Pastorale weist Beethoven mehrfach auf „Erinnerungen an das Leben auf dem Lande“ als Hauptmotiv für den Inhalt der Symphonie hin. Dieser Gedanke ist im vollständigen Titel der Symphonie weiter erhalten Titelblatt Manuskripte (siehe unten).
Die Rousseau-Idee der Pastoralsinfonie verbindet Beethoven mit Haydn (Oratorium Die vier Jahreszeiten). Aber bei Beethoven verschwindet jene Patina des Patriarchats, die bei Haydn zu beobachten ist. Das Thema Natur und Landleben interpretiert er als eine der Varianten seines Hauptthemas vom „freien Menschen“ – damit ist er mit den „Stürmern“ verwandt, die in Anlehnung an Rousseau in der Natur einen befreienden Anfang sahen, sich ihr entgegenstellten die Welt der Gewalt, Zwang.
In der Pastoralsinfonie wandte sich Beethoven der Handlung zu, die in der Musik mehr als einmal vorkommt. Unter den Programmwerken der Vergangenheit widmen sich viele Naturbildern. Aber Beethoven löst das Prinzip der Programmierung in der Musik auf eine neue Art und Weise. Von der naiven Anschaulichkeit geht er zur poetisch vergeistigten Verkörperung der Natur über. Beethoven drückte seine Sicht auf das Programmieren mit den Worten aus: "Mehr Gefühlsausdruck als Malerei." Der Autor hat eine solche Vorwarnung und ein solches Programm im Manuskript der Sinfonie gegeben.
Allerdings sollte man nicht meinen, dass Beethoven hier die bildnerischen, bildnerischen Möglichkeiten der Tonsprache aufgegeben hat. Beethovens sechste Sinfonie ist ein Beispiel für die Verschmelzung von Ausdrucks- und Bildprinzipien. Ihre Bilder sind stimmungsvoll, poetisch, von einem großen inneren Gefühl beseelt, von einer Verallgemeinerung durchdrungen philosophisches Denken und zugleich malerisch.
Das Thema der Symphonie ist charakteristisch. Beethoven bezieht sich hier auf Volksmelodien (obwohl er sehr selten echte Volksmelodien zitierte): In der Sechsten Symphonie finden Forscher slawische Volksursprünge. Insbesondere B. Bartok, ein großer Kenner Volksmusik verschiedenen Ländern, schreibt, dass der Hauptteil des ersten Teils der Pastorale ein kroatisches Kinderlied ist. Andere Forscher (Becker, Schönewolf) verweisen auch auf die kroatische Melodie aus der Sammlung von D. K. Kukhach „Lieder der Südslawen“, die der Prototyp des Hauptteils des I-Teils der Pastorale war:
Das Erscheinungsbild der Pastoralsinfonie ist geprägt von einer breiten Umsetzung volksmusikalischer Gattungen - Lendler (die Extremteile des Scherzos), Gesang (im Finale). Liedursprünge sind auch im Scherzo-Trio sichtbar - Nottebohm gibt Beethovens Skizze des Liedes "Glück der Freundschaft" ("Glück der Freundschaft", op. 88), das später in der Sinfonie verwendet wurde:
Die malerische thematische Natur der Sechsten Symphonie manifestiert sich in der breiten Einbeziehung von ornamentalen Elementen - gruppetto verschiedene Sorten, Figurationen, lange Vorschlagsnoten, Arpeggios; Diese Art von Melodie bildet zusammen mit dem Volkslied die Grundlage der Thematik der Sechsten Symphonie. Dies macht sich besonders im langsamen Teil bemerkbar. Sein Hauptteil erwächst aus dem Gruppetto (Beethoven sagte, er habe hier die Melodie des Pirols eingefangen).
Die Aufmerksamkeit für die koloristische Seite zeigt sich deutlich in harmonische Sprache Sinfonien. Es wird auf die tertiären Tonalitätsvergleiche in den Durchführungsteilen hingewiesen. Sie spielen eine wichtige Rolle sowohl in der Entwicklung von Satz I (H-Dur - D-Dur; G-Dur - E-Dur) als auch in der Entwicklung von Andante ("Szene am Bach"), das eine farbenfrohe Zierde ist Variation über das Thema des Hauptteils. In der Musik der Sätze III, IV und V steckt viel helle Bildhaftigkeit. Somit verlässt keiner der Teile den Plan der Programmbildmusik, während die gesamte Tiefe der poetischen Idee der Symphonie erhalten bleibt.
Das Orchester der Sechsten Symphonie zeichnet sich durch eine Fülle solistischer Blasinstrumente (Klarinette, Flöte, Horn) aus. In Scene by the Stream (Andante) nutzt Beethoven den Reichtum der Streichinstrumente auf neue Weise. Er verwendet Divisi und Mutes in der Stimme der Celli und reproduziert das "Rauschen des Baches" (Anmerkung des Autors im Manuskript). Solche Techniken des Orchesterschreibens sind typisch für spätere Zeiten. Im Zusammenhang damit kann man von Beethovens Vorwegnahme der Züge eines romantischen Orchesters sprechen.
Die Dramaturgie der Symphonie als Ganzes unterscheidet sich stark von der Dramaturgie der Heldensymphonien. In Sonatenform (Teil I, II, V) werden Kontraste und Kanten zwischen den Abschnitten geglättet. "Hier gibt es keine Konflikte oder Kämpfe. Fließende Übergänge von einem Gedanken zum anderen sind charakteristisch. Dies ist besonders ausgeprägt in Teil II: Der Seitenteil setzt den Hauptteil fort und tritt vor demselben Hintergrund ein, vor dem der Hauptteil erklang:
Becker schreibt in diesem Zusammenhang über die Technik des „Melodienbesaitens“. Die Fülle der Thematik, die Dominanz des melodischen Prinzips ist in der Tat das charakteristischste Merkmal des Stils der Pastoralsymphonie.
Diese Merkmale der Sechsten Symphonie manifestieren sich auch in der Methode der Themenentwicklung - die Hauptrolle gehört der Variation. In Satz II und im Finale führt Beethoven die Variationsteile in Sonatenform ein (Durchführung in „Scene by the Stream“, Hauptstimme im Finale). Diese Kombination von Sonate und Variation wurde zu einem der Grundprinzipien in Schuberts lyrischer Symphonik.
Die Logik des Zyklus der Pastoralsinfonie mit den typischen klassischen Kontrasten wird jedoch durch das Programm bestimmt (daher ihre fünfteilige Struktur und das Fehlen von Zäsuren zwischen den Teilen III, IV und V). Sein Zyklus zeichnet sich nicht durch eine so effektive und konsequente Entwicklung aus wie in den heroischen Symphonien, wo der erste Teil im Mittelpunkt des Konflikts steht und das Finale seine Auflösung ist. Bei der Abfolge der Teile spielen Faktoren der Programm-Bild-Ordnung eine wichtige Rolle, obwohl sie der verallgemeinerten Idee der Einheit des Menschen mit der Natur untergeordnet sind.